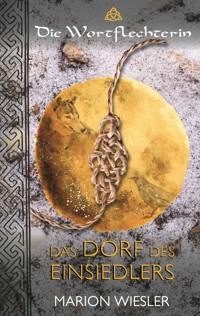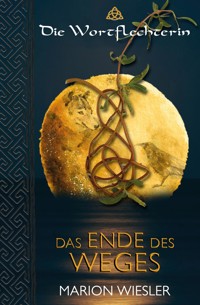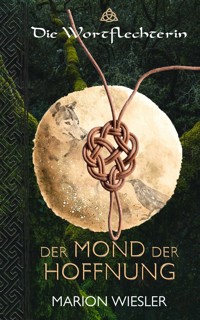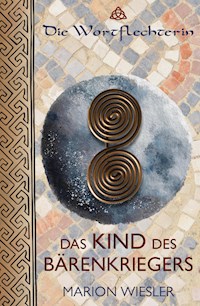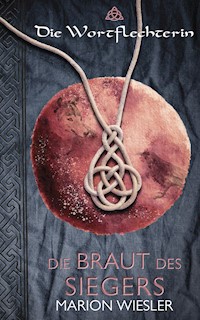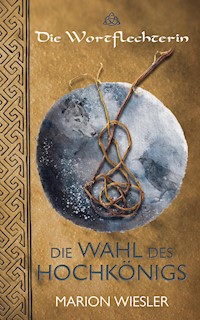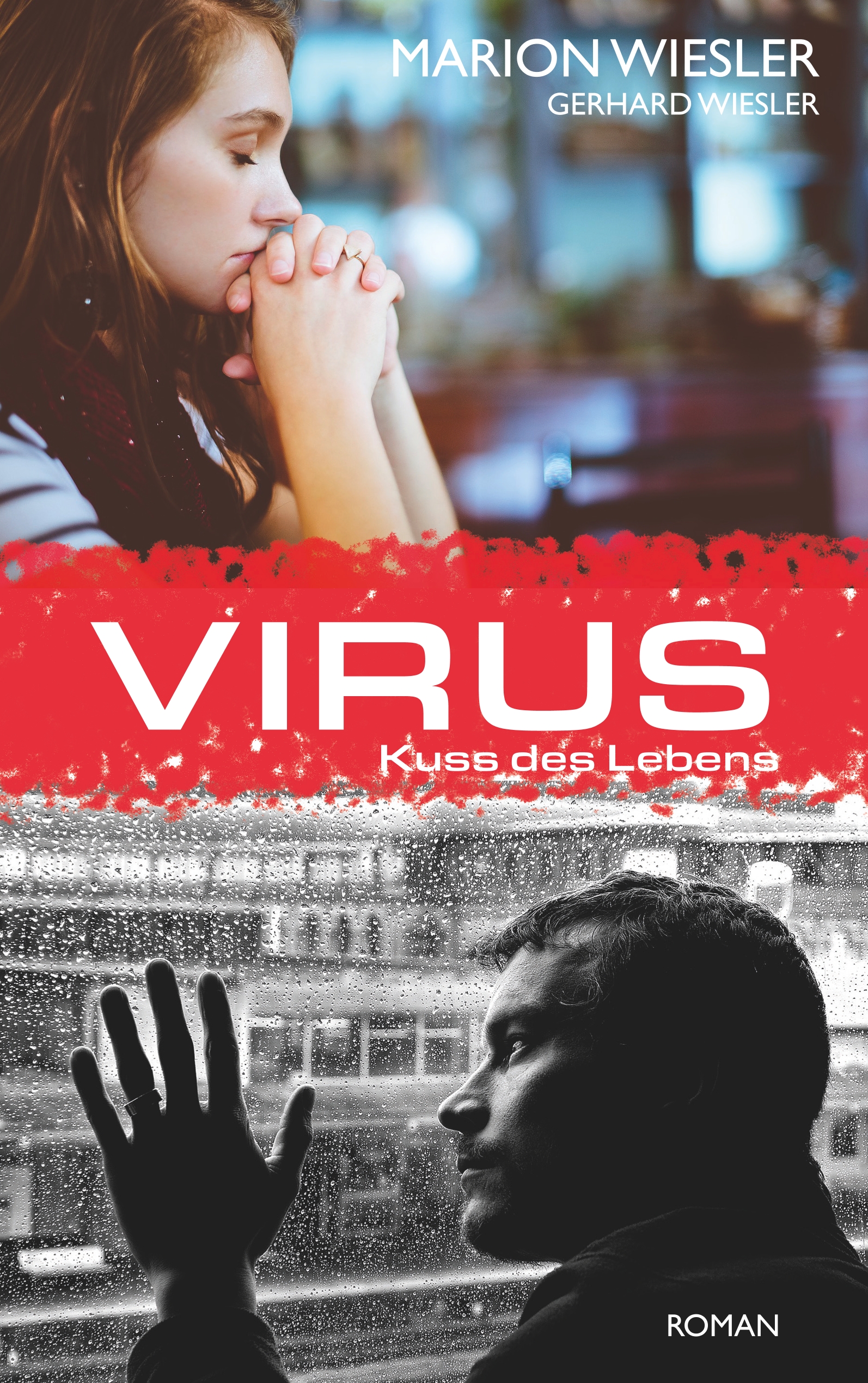6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Machtvolle Wort sind die Gabe der Bardin, der Mond ihre Herrin, ein Fluch ihr Antrieb. Noricum, im Jahr 38 vor unserer Zeitrechnung. Die Bardin Arduinna ist dazu verflucht, nie länger als einen halben Mond an einem Ort zu bleiben, will sie den Mann ihres Herzens schützen. Nach Zeiten der einsamen Wanderschaft verschlägt es sie mit ihren Gefährten – einem Wolfshund und einem Raben – nach Solva, einem Markt, der bereits sehr unter römischem Einfluss steht, obwohl er in Noricum liegt. Trotz ihrer Angst vor den Römern will sie bleiben. Denn erstmals nimmt nicht nur die Stimme ihrer Träume Gestalt an, sondern sie findet auch jemanden, der ihr helfen kann, die Zeichen und Symbole zu deuten, die sie seit Jahren auf einem Stück Leder gesammelt hat. Aber sie erfährt auch, dass sie gesucht wird … Band 2 der Keltenroman-Serie »Die Wortflechterin« Wem der Geschichtenreichtum in »Der Name des Windes« von Patrick Rothfuss gefallen hat, findet hier Ähnliches in einem real historischen Kontext. Tauch ein in die Welt der Kelten und fühle den Pulsschlag jener Zeit in dir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Marion Wiesler
Der Markt der Lügner
Keltenroman
Band zwei der Keltenroman-Serie"Die Wortflechterin"Inhaltsverzeichnis
Noricum
im Jahre 38 vor unserer Zeitrechnung
Prolog: In einem Dorf der Silurer, viele Jahre, ehe die Geschichte beginnt
Kapitel 1: Ankunft
Kapitel 2: Eine erste Geschichte
Kapitel 3: Der Ambactos
Kapitel 4: Die Fremde
Kapitel 5: Gegenüber dem Glasperlendreher
Kapitel 6: Der Nordmann
Kapitel 7: Ein erstes Gespräch
Kapitel 8: Das Abendritual
Kapitel 9: Der Habicht
Kapitel 10: Ein Traum
Kapitel 11: Spaziergang am Markt
Kapitel 12: Hilfe
Kapitel 13: Nähe
Kapitel 14: Belauschte Gespräche
Kapitel 15: Unerwartete Hilfe
Kapitel 16: Die Einladung
Kapitel 17: Nächtliche Gedanken
Kapitel 18: Besuch im Tempel
Kapitel 19: Das Orakel
Kapitel 20: Ungeduld
Kapitel 21: Im Wald
Kapitel 22: Die Käufliche
Kapitel 23: Unterricht
Kapitel 24: Padrig
Kapitel 25: Unruhe
Kapitel 26: Bedürfnisse
Kapitel 27: Beschwerden
Kapitel 28: Gemeinsam im Wald
Kapitel 29: Eine sonderbare Entdeckung
Kapitel 30: Der Empfang
Kapitel 31: Bei Brugius
Kapitel 32: Rabenfedern
Kapitel 33: Der Fremde
Kapitel 34: Freundschaft
Kapitel 35: Besuch beim Barden
Kapitel 36: Ein beunruhigendes Geschenk
Kapitel 37: Beutehort
Kapitel 38: Bingelkraut
Kapitel 39: Ein eigenartiges Verhalten
Kapitel 40: Anklage
Kapitel 41: Der Dieb
Kapitel 42: Ein kurzes Gespräch
Kapitel 43: Trauer
Kapitel 44: Der Maler
Kapitel 45: Das Caiobarna
Kapitel 46: Veränderung
Kapitel 47: Aufschub
Kapitel 48: Aussprache
Kapitel 49: Eine lange Nacht
Kapitel 50: Das Urteil
Kapitel 51: Der Schrecken
Kapitel 52: Vollstreckung
Kapitel 53: Das Angebot
Kapitel 54: Abschied
Kapitel 55: Aufbruch
Lust ...
GLOSSAR
GESCHICHTEN
PERSONEN
Weitere Bücher der Serie
»Die Wortflechterin«
Bücher aus der
»Welt der Wortflechterin«
Geschichtliches
Danksagung
Marion Wiesler
Impressum
Ich bin Arduinna, die Wortflechterin.
Geboren von Seelen, die niemand kennt,
Gefunden im Wald unterm Ulmenbaum.
Ewig getrieben vom Wandel des Monds,
Vom Maistir verflucht, nie sesshaft zu sein.
Die Bäume des Waldes sind mir ein Dach,
Die Früchte der Erde mein Brot,
Begleitet von Wesen der Luft und der Nacht
Durchquere ich Täler, Berge und Seen.
Träumend von ihm, dessen Ruf ohne Klang,
Dessen Sein ohne Bild, das Ende des Fluchs.
Ich folge den Göttern, den Menschen zu dienen,
Sie zu erfreuen, doch mir zur Einsamkeit.
Ich bin Arduinna, die Wortflechterin.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie, detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
©2021 Marion Wiesler
Covergestaltung: Veronika Tanton
Landkarten: unsplash/Hans Braxmeier
Herstellung und Verlag:
BoD – Books on Demand, Norderstedt
ISBN 9783754352595
Noricum
im Jahre 38 vor unserer Zeitrechnung
(für die Geschichte bedeutsame Orte)
Bragnreica:
Das heutige Deutschlandsberg, das ich als Herrschersitz des Voccio erkoren habe
Solva:
Später Flavia Solva, bei Leibnitz
Murus:
Der Fluss Mur
Arrabo und Aba acos:
Raab und Feistritz
GLOSSAR am Ende des Buches
Weitere Bände der Serie
Die Wortflechterin
Die Zeit des Aufbruchs
(Kurzband)
Die Wahl des Hochkönigs
Der Markt der Lügner
Die Braut des Siegers
Prolog: In einem Dorf der Silurer, viele Jahre, ehe die Geschichte beginnt
»Sie ist meine Tochter«, sagte Tegid und legte seine Hand auf meine schmale Schulter. Erstaunt sah ich zu ihm auf. Was sagte er da? Jeder wusste doch, dass das nicht stimmte.
Der Fremde sah von mir zu meinem Maistir, als suche er nach Ähnlichkeiten.
»Und ihre Mutter?«, fragte er.
Es verwirrte mich, dass dieser Mann solche Fragen stellte. Er war heute Morgen in unser Dorf gekommen und von Haus zu Haus gegangen, hatte mit allen Leuten geredet. Tegid und ich waren unter dem vorgezogenen Dach im Schatten gesessen und er hatte mir ein neues Lied beigebracht. Es war eine schwierige Melodie und meine Finger quälten sich damit, schnell genug über die Saiten der Leier zu laufen. Und nun stand der Mann vor uns mit seinem staubigen Umhang und stellte eigentümliche Fragen.
»Sie ist gestorben, vor drei Wintern«, sagte Tegid. Der Druck seiner Finger auf meiner Schulter verstärkte sich. Ich wurde immer verwirrter. Ich hatte doch nie eine Mutter gehabt.
»Vögelchen«, fuhr er fort und lächelte mich an. »Lauf rüber zu Heledd, sie hat Eintopf für uns. Nimm deine Leier mit und übe, bis ich dich hole.«
Er gab mir einen leichten Stups.
Zu gerne hätte ich gewusst, was Tegid mit dem Fremden sprach, doch ich folgte, wie ich ihm immer gehorchte. Die kleine Leier fest an mich gedrückt, lief ich hinüber zum Haus der Nachbarin, die uns abwechselnd mit den anderen Frauen oft Essen brachte.
Heledd saß mit einer großen Schüssel im Schoß auf der Bank in der Sonne und schnitt Gelbwurzeln in kleine Stücke. Sie hatte die Ärmel ihres Kleides aufgekrempelt, ein schönes Kleid war es, fand ich. Es hatte ganz feine Streifen, die sich aus den unterschiedlich gefärbten Fäden ergaben. Seit Heledd versuchte, mir das Spinnen beizubringen, bewunderte ich all die ebenmäßig gewebten Stoffe der Frauen um mich. Mochte Tegid mir auch immer wieder sagen, wie geschickt und talentiert ich an der Leier und beim Erzählen war, das Spinnen war gewiss nicht meine Stärke.
Heledd sah auf und lächelte ihr gemütliches Lächeln.
»Ach, kommst du bereits Essen holen? Schon so hungrig, kleine Arduinna?«
»Tegid schickt mich.«
»Du wirst warten müssen, es ist noch zu früh.«
Ich setzte mich neben Heledd auf die Bank, ließ die Beine baumeln und schwieg. Ihre beiden Kleinsten spielten vor uns mit ein paar Hölzern, während Heledds Älteste an der Hauswand lehnte und die Handspindel tanzen ließ. Sie war ungemein geschickt damit.
»Heledd«, sagte ich scheu nach einer Weile des Schweigens. »Ist Tegid mein Vater?«
»Was?« Die rundliche Nachbarin sah mich erstaunt an. »Aber nein, wie kommst du denn darauf? Das ganze Dorf kennt doch die Geschichte, wie er dich im Wald fand und hierher brachte, nackt und hilflos … ach, du warst entzückend, mit deinen großen Augen und diesem neugierigen Blick, gerade mal laufen konntest du ...« Ihr Blick wurde warm und sie legte mir für einen Moment ihre Hand auf das Knie. »Ich kann ja verstehen, dass du es dir wünschst, einen echten Vater zu haben. Und Tegid ist besser, als so mancher es wäre.«
»Er hat es dem Fremden gesagt. Und dass meine Mutter vor drei Wintern gestorben wäre. Warum?«
Heledd zuckte die Schultern. Ihr kleines Messer ruhte für keinen Augenblick, eine dunkelgelbe runde Scheibe nach der anderen stürzte abgeschnitten in die Schüssel.
»Er wird seine Gründe haben. Aber Arduinna, ich kann dir versichern, auch wenn du nicht seine Tochter bist …« Sie lachte leise. »Seine Tochtertochter würde wohl eher passen … Die Götter haben euch zueinander geführt, das weiß ich. Du wärst gewiss gestorben, hätte er dich nicht gefunden. Und er … er war einsam. Außerdem bist du eine Schülerin, wie sie sich jeder Barde nur wünschen kann.«
Meine Wangen wurden warm. Ohne viel nachzudenken, strichen meine Finger über die Saiten meiner Leier. Heledd seufzte zufrieden und die beiden Kleinen sahen auf, lauschten.
»Heledd«, sagte ich nach einer Weile. »Tegid will nun, dass ich lerne, Knotenmuster zu flechten.«
Es war mir beinahe unangenehm, darüber zu reden. Vor einigen Tagen, als wir uns gerade schlafen legten, hatte ich meinem Maistir erzählt, dass mir manchmal ganz eigenartige Wörter durch den Kopf flogen, wenn ich bestimmte Menschen ansah. Ich hatte ihm von dem Buben berichtet, der letztens nach dem Tod seines Hundes so traurig gewesen war, und da hatten mich alle dann so komisch angesehen, weil ich nur dagesessen war und vor mich hinstarrte und plötzlich »WolfsHerz« gesagt hatte. Und alle hatten gelacht, nur der kleine Junge, er hatte gelächelt, als würde er sich freuen.
Tegid hatte sich abrupt aufgesetzt und den Kopf geschüttelt.
»Ist das schlimm?«, hatte ich gefragt, doch er hatte nur gelächelt, hatte das Feuer in der Feuerstelle noch einmal angefacht und sich aus einer Amphore, die er nur zu ganz seltenen Gelegenheiten öffnete, etwas von dem teuren Wein aus dem Land der Mittagssonne in seine bronzene Schale gegossen.
»Ich wusste von Anfang an, dass du etwas Besonderes bist«, hatte er gesagt und wieder davon erzählt, wie ich mit keinen drei Sommern bereits seine Geschichten zu Ende erzählt hatte. Und am nächsten Morgen hatte er begonnen, mir Knotenmuster beizubringen, in die ich eines Tages würde solche Worte flechten können.
Heledd lächelte. »Du wirst dabei gewiss so geschickt sein wie auf der Leier.«
Sanft streichelte ich das glatte Holz des kleinen Instruments, das Tegid für mich gefertigt hatte, ich war verlegen.
»Ich weiß nicht, Heledd. Ich bin furchtbar schlecht im Spinnen und Weben, wie soll ich dann erst lernen, schwierige Knoten zu flechten?«
»Du wirst eine große Bardin werden, du musst nicht spinnen und weben können – die Herrscher der Stämme werden dich mit Reichtümern für deine Lieder und Geschichten belohnen. So wie unser Stamm Tegid und dich versorgt und schätzt und ehrt.« Plötzlich lachte sie auf. »Wenn ich an deine gesponnene Wolle denke, dann werden dir Knoten leicht fallen.«
Nun lachte auch ich. Ja, Knoten machen, das konnte ich, die kamen ganz von selbst beim Spinnen.
Ich sah Tegid auf das Haus zueilen, mit seinen langen Schritten und dem freundlichen Nicken, das er jedem, an dem er vorbeikam, zuwarf. Hastig nahm ich meine Leier wieder zur Hand und ließ die Saiten klingen.
Beinahe scheu blickte ich zu meinem Maistir auf, als er vor mir stand und mich nachdenklich ansah.
»Und die Geschichte ist wahr, auch wenn sie nie geschehen ist«, sagte Tegid, wie so oft bei seinen Erzählungen.
Ich wagte nicht, weiter zu fragen. Er hatte zugegeben, den Fremden belogen zu haben. Er würde mir wohl nicht sagen, warum. Oder hatte er mich und das Dorf belogen, die vier Sommer lang, seit er mich hierher gebracht hatte? War er doch mein Vater?
War es wichtig, was wirklich wahr war?
»Und sie lebten glücklich, solange es den Göttern gefiel«, antwortete ich.
Kapitel 1: Ankunft
Der Lärm war das Erste, das mir auffiel. Wir hatten noch nicht einmal die Palisade erreicht, da standen schon Marktstände entlang der Straße. Dahinter, auf einem freien Feld, waren eine erhöhte Plattform und hölzerne Absperrungen, wie sie bei Viehmärkten verwendet wurden. Im Augenblick grasten ein paar Ochsen und Pferde darin.
Branna, die auf dem kleinen Handwagen gesessen hatte, flatterte auf meine Schulter und rieb ihren schwarzen Kopf an meiner Wange.
»Buup«, machte die Rabin und Federn kitzelten meine Nase.
Cú sprang, wenn auch etwas schwerfällig, aus dem Handwagen und trottete neben mir her. Der Hund mochte immer noch ein wenig hinken, doch unter so vielen Menschen war sein Platz an meiner Seite.
Das Zweite, das mir auffiel, war die Pflasterung, die bereits einige Mannlängen vor dem breiten Tor begann und so aussah, als würde weiter an ihr gebaut werden. Solche Straßen kannte ich von den Römern, in mühevoller Arbeit von Sklaven Stein für Stein gebildet.
Ich trat zur Seite, ließ einen Mann auf seinem Ochsenkarren vorbei. Schwer stützte ich mich auf meinen langen Haselstab, mochte nach müder Wanderin wirken, und ließ doch meine Augen flink und aufmerksam über alles ringsum gleiten.
Es war immer gut, sich einen Überblick zu verschaffen, ein erstes Gespür für einen Ort zu entwickeln. Ich warf einen Blick den Weg zurück, den ich gekommen war. Ja, es war wohl eindeutig, dass die Götter mich heute Morgen hierher gesandt hatten. Ich war wie immer ihrem Willen gefolgt und empfand nun dennoch ein flaues Gefühl in meinem Bauch, als ich mich solch einer großen Ansiedlung gegenübersah.
Der Ort war anders als Bragnreica, das ich vor gut einem Mond verlassen hatte. Bragnreica war eine Duron auf einem hohen Hügel gewesen, umgeben von zwei mächtigen Wällen. Der Sitz des Reix Voccio, des Herrschers über die norischen Stämme. Dieser Ort hier lag in einer Ebene, und genau wie bei Bragnreica war das Umfeld kahl und gerodet. Doch bei Voccios Festung war die Ebene rings um den Hügel längst fruchtbares Weideland, hier sah der Boden neben der Straße aus wie ein Getreidefeld im Herbst, nur dass statt der Stoppel der Gerstenhalme Baumstümpfe aus dem Boden ragten. Ein leiser Schauder lief über meinen Rücken. Dieses freie Feld war kein Ort, an dem ich des Nachts sein wollte. So sehr ich es liebte, abends von den Stimmen der Bäume in den Schlaf gesungen zu werden, das Lied all dieser Baumstümpfe musste ein trauriges sein.
Vieles von dem Holz fand sich wohl in der neu wirkenden Palisade wieder, deren Spitzen noch hell nach frischem Holz aussahen. Es schien, als hätte man diesen Ort erst vor kurzem aus dem Boden gestampft. Zumindest in dieser Größe. Dies war keine langsam gewachsene Ansiedlung.
In der klaren Luft über dem Ort flimmerten Säulen von der Hitze vieler Feuer, nur wenige rauchten sichtbar in den Himmel. Man besaß also ausreichend trockenes Holz, um wirklich heiße Flammen zu erzeugen. Ein reicher Ort, was mir auch der Anblick der Menschen bestätigte, die an mir vorbeieilten oder mir entgegen kamen.
Gewiss, da waren Bauersleute in grob gewebtem Gewand, doch zwischen ihnen gingen reich geschmückte Männer und Frauen, deren Umhänge mit Pelz besetzt waren. Ich sah goldenen Schmuck an Armen und Füßen, reich verzierte Gürtelbleche, Schwerter an den Seiten mancher Männer, Sklaven neben den Frauen. Viele, deren Hautfarbe dunkler war, viele, die etwas Römisches an sich hatten. Doch gewiss war ich noch im Gebiet der Noricer, das römische Reich begann erst südlich der Alpen. Der Ort hatte nichts Kriegerisches an sich, nicht wie Bragnreica, das schon von weitem verkündete, eine uneinnehmbare Festung zu sein.
Nun denn, ich würde sehen, was der Ort für mich bereithielt und weshalb die Götter mich hierher geschickt hatten.
Seit ich den Handkarren besaß, musste ich meinen Besitz nicht mehr in dem großen Ziegenfellbeutel tragen, doch nun schlang ich ihn mir dennoch um. Ich fühlte mich wohler, alles an mir zu haben, was ich besaß. Und ich zog ein Tuch aus meinem Beutel, das ich in Bragnreica erstanden hatte. Das kühle Leinen glitt weich durch meine Finger wie ein sanfter Wasserstrahl. Mit drei schlichten Nadeln befestigte ich den dunklen Stoff in meinen aufgesteckten Haaren. Meine Finger tasteten, ob ich das Tuch auch weit genug vorgezogen hatte, meine Schläfen zu bedecken.
»Kommt«, sagte ich schließlich zu meinen Begleitern. »Heute werden wir schlemmen.«
Die Götter hatten mir die letzten Tage stetig den Weg ein wenig südlich des Sonnenaufgangs gewiesen. Nach dem halben Mond in Bragnreica hatte ich das Alleinsein in den Wäldern genossen, aber nun war ich hier. Große Ansiedlungen und Menschen machten mich immer kribbelig.
Vielleicht fand ich ein Zeichen … So oft fanden sich die Zeichen, wenn ich unter Menschen war.
»Es ist ein cynnedyf«, sagte ich zu Cú, der die Ohren spitzte. »Es ist kein Fluch. Es ist ein Gebot und lösbar …« Ich lachte leise. »Das hörst du oft von mir, nicht wahr?«
Cú legte den Kopf schief. Ich kraulte ihn hinter den Ohren und seufzte. Seit drei-mal-drei Jahren schon versuchte ich, jenes Gebot aufzuheben, das Morfran der Habicht, Barde der Carnuten, über mich gesprochen hatte. Die Sehnsucht, endlich länger als einen halben Mond an einem Ort bleiben zu dürfen, war durch meine Zeit in Bragnreica wieder einmal drückend schwer geworden. Hoffnung schlich sich in meine Brust. Vielleicht war ja dies der Ort ...
Nachdem ich noch ein wenig den Zug an Händlern und Bauern beobachtet hatte, schritt auch ich durch das große Tor, das von zwei Kriegern mit Speeren bewacht wurde. Die beiden ließen ihre Augen träge über die vielen Menschen gleiten, die an ihnen vorbeiströmten. Es musste Markttag sein. Branna beäugte mit schief gelegtem Kopf eine Schar Gänse, die ein Bursche durch das Tor trieb. Fast schien die Rabin über das weiße Federvieh zu lachen, das da schnatternd daherwatschelte, während sie selbst bequem auf der Schulter ihrer Herrin saß.
Es war wirklich ein sonderbarer Ort, ein großes Dorf, das zu wuchern schien wie Hefe im Teig. Kleine Hütten und Häuser drängten sich aneinander, als wolle das eine das andere zur Seite schieben, dazwischen Werkstätten und Pferche für Tiere. Alles schien sich um einen großen Platz zu gruppieren, der jedoch so mit Ständen vollgepackt war, dass man ihn kaum als Platz erkannte. Ich hielt mich eher am Rand, um mir einen Überblick zu verschaffen. Es gab schlichte Tische, auf Böcken aufgelegte Bretter, an denen Bäuerinnen ihre Rüben und Äpfel verkauften. Das mussten die Frauen aus der Umgebung sein. Dann standen da Wagen, ihre Planen hochgerollt und voll mit den verschiedensten Waren. Doch keine Pferde oder Ochsen dazu, das waren wohl die Tiere draußen im Bereich des Viehmarktes. Das sprach dafür, dass dies ein Markt war, der mehr als einen Tag dauerte. Und dann sah ich noch rund um den Platz Geschäfte in festen Häusern, keine notdürftig und rasch aufgebauten Hütten, sondern solide gezimmerte Gebäude. Manche sogar aus Stein, weiß verputzt oder mit bunten Malereien darauf, die das Warenangebot darin widerspiegelten. Sie alle wirkten neu, einige sogar erst in Bau.
Erneut dachte ich an Bragnreica. Dies hier war der erste größere Ort, in den ich kam, seit ich Voccios Duron verlassen hatte. Erstmals wieder unter Menschen, seit ich den Fluch gesprochen hatte, um Voccio zu retten. Bis jetzt hatte ich keine Auswirkungen davon gespürt, doch ich ahnte, dass sich hier zeigen würde, welche Folgen der Fluch auf mich, die Sprecherin der Worte, hatte. Ich hatte den Fluch nicht an mich gebunden, wie Morfran es damals getan hatte, vielleicht blieb ich daher verschont, selbst zusehr darunter leiden zu müssen.
Cú hob schnuppernd seine Schnauze. Die Düfte waren auch für mich überwältigend. In Garküchen dampfte und zischte es, brutzelten Köstlichkeiten über dem Feuer. Im Vorbeigehen an manchen der Wagenstände roch ich fremdländische Gewürze und über allem lag der Geruch nach Menschen, nach Schweiß und Rauch.
Ich hatte unter meinem Kleid Schmuck und auch einige wertvolle Geldstücke in einem versteckten Beutel und könnte mir sogleich ein ausgiebiges Mahl leisten. Doch das würde ich nicht tun. Ich trug mein altes, vielfach geflicktes Kleid, darüber den schmalen Peplos, der auch schon bessere Tage erlebt hatte und locker meinen Umhang umgeworfen, dem man ansah, dass ich die letzten Nächte im Wald darauf geschlafen hatte.
Wenn jemand, der aussah, wie ich es tat, mit einem Goldstück zahlte, und sei es noch so klein, läge sogleich der Verdacht auf der Hand, dass ich unrechtmäßig zu dem Geld gekommen war.
Ich würde mir erst einmal ein genaueres Bild von diesem Ort verschaffen und ein paar Münzen verdienen.
Kapitel 2: Eine erste Geschichte
Nach einem raschen Rundgang, bei dem ich nur einen kurzen Blick auf das Angebot der verschiedenen Stände warf, fand ich einen Platz, der ein wenig freier war als die engen Zwischenräume ringsum. Hinter mir befand sich eine Ausschank für Getränke, ein gemauertes Haus, durch dessen offene Türe ich einige Männer an derben Tischen sitzen sah.
Ich stellte den Handwagen hinter mich und hieß Cú, darauf achtzugeben. Als ich meinen großen Ziegenfellbeutel hinein zu der Rolle aus Rehhaut legte, die mir als Bett diente, ließ sich die Rabin sofort darauf nieder.
»Kraaah!«, machte Branna so laut, dass sich einige Leute umdrehten.
Schließlich legte ich auch meinen Umhang ab, obwohl der Tag kühl war. Ich mochte es, mich frei bewegen zu können, wenn ich erzählte. Die Geschichte hatte ich schon bei meinem Rundgang gewählt, als ich all die Bäuerinnen an ihren Ständen sah und die Männer mit ihren Trinkhörnern voll Bier.
Ich klatschte in die Hände und stampfte mit den Füßen, als wolle ich zu tanzen beginnen. So merkten nicht nur die Götter, sondern auch die Menschen ringsum, dass hier erzählt werden würde. Noch mehr Leute sahen zu mir her, zwei Frauen stellten ihre schweren Körbe ab.
»Höret ihr Leute und lauschet, ich bin Arduinna aus Albion von jenseits des schmalen Meeres, gekommen, euch mit Geschichten zu erfreuen!«
Drei Kinder liefen auf mich zu und setzten sich vor mir auf den Boden, die nackten Beine verschränkt. Der eine zeigte auf Branna, lachte. Ich sah aus dem Augenwinkel zu der Rabin hin, die auf dem Handwagen auf und ab stolzierte und mit den Flügeln schlug.
Hinter den Kindern fanden sich nun auch einige Erwachsene ein, die mich abwartend ansahen.
»Die Geschichte, die ich euch nun berichten möchte, ist wahr – auch wenn sie nie geschehen ist.«
Wie jedes Mal, wenn ich diese Worte sprach, musste ich an Tegid denken. Eines der Kinder lachte.
Ich spürte die Neugier der Zuhörer, ließ sie für einen Augenblick des Schweigens noch wachsen.
»Vor langer Zeit lebte einmal ein Mann, der war ein ganz besonderer Mann, von einer Art, wie es ihn heute gar nicht mehr gibt.«
Die Menge rund um mich wurde größer, drängte sich näher. Mein Blick glitt über Männer, die kaum mehr als Lumpen am Leib hatten, bloßfüßig und teilweise ohne Braccae unter ihren Hemden. Doch es standen auch welche in der Menge, die wohl von weit her kamen, mit weiten Beinkleidern statt der geraden Braccae, und welche mit kostbaren Umhängen. Manche, denen der Römer nur so aus dem Gesicht sprach, und einige wenige, deren Haut und Haar blass und hell war. Es war eine gewagte Geschichte vor so vielen Männern, doch es würde mir auch sofort zeigen, unter was für Menschen ich mich hier befand.
»Ja, eine Art, wie es sie heute nicht mehr gibt, denn dieser Mann … war ein Dummkopf.«
Eine der Bäuerinnen, die sich auf ihren Tragkäfig voller Hühner gesetzt hatte, lachte laut auf.
»Da kennst den meinen nicht!«, rief sie.
»Er war so ein Dummkopf, dass er sich immer in die schlimmsten Probleme brachte und seine Mutter hatte die größten Sorgen, was denn aus ihm werden würde, wenn sie eines Tages nicht mehr lebte.«
Ein altes Weib nickte seufzend. Ich verbiss mir ein Schmunzeln.
»Doch als die Mutter einmal vom Markt heimkehrte, da hatte sie gute Neuigkeiten. Tief im Wald, der das Dorf umgab, sollte es eine weise alte Frau geben, die Wünsche erfüllte. Und so sandte die Mutter ihren Sohn, den Dummkopf, dorthin, damit er um ein wenig Verstand bitte.«
Inzwischen hatten sich so viele Menschen um mich geschart, dass der Lärm des Marktes wie von einer Wand abgehalten wurde. Es freute mich, an einem Ort zu sein, der gerne Geschichten hörte.
»Der Dummkopf machte sich also auf den Weg und er fand die Alte. Er bemühte sich, höflich zu sein, doch da ihm nicht viel Höfliches zu sagen einfiel, platzte er recht schnell damit heraus, dass er gerne etwas Verstand hätte. ›Gerne‹, sagte sie. ›Aber du musst auch selbst etwas dazu tun. Du musst mir das Herz dessen bringen, das dir das Liebste ist auf der Welt.‹«
Ich hatte mich leicht vorgebeugt, wie ein altes, buckliges Weib und meine Stimme schnarren lassen. Einer der Buben, der vor mir saß, starrte mich erschrocken an. Ein etwas älterer, der dahinter stand, rief frech: »Was für ein hässliches Weib, von dem nähme ich nicht mal einen goldenen Armreif!«
Ich ignorierte ihn.
»Der Dummkopf machte sich wieder auf den Weg nach Hause und er tat etwas, das er nur sehr selten tat: er dachte nach. Seine Mutter fragte natürlich sofort, ob er denn seinen Verstand erhalten hätte, und ihr Sohn antwortete, dass er das Herz dessen bringen müsse, das ihm das Liebste sei. ›Mutter‹, sagte er, ›ich denke, wir müssen das Schwein schlachten, denn Speck ist mir das Liebste auf der Welt.‹«
Die Menge lachte. Der ältere Bub verdrehte die Augen und blies laut die Luft aus.
»Und so schlachteten sie das Schwein und der Dummkopf brachte das Herz der weisen Frau. ›Gut‹, sagte sie, ›dann will ich dir eine Frage stellen und wir werden sehen, ob du deinen Verstand erhalten hast.‹ Sie sah den Dummkopf lange an.«
Ich ließ den Blick über die Menschen gleiten.
»›Sage mir, was ist das? Es sieht aus wie eine Katze, es miaut wie eine Katze, doch es ist keine Katze.‹«
Es war riskant, nun eine Pause zu machen, denn es verdarb die Geschichte, wenn jemand die richtige Antwort wusste. Ich wagte es dennoch.
»Was für eine blöde Frage!«, rief der ältere Bub.
»Das dachte auch der Dummkopf«, nahm ich den Faden wieder auf, »denn er wusste die Antwort nicht.«
Der Junge zog eine Grimasse und verschränkte beleidigt die Arme. Jemand hinter ihm lachte.
»Also musste er ohne Verstand wieder nach Hause gehen. Er war noch nicht daheim angekommen, da kam ihm sein Nachbar entgegengelaufen, denn seine Mutter lag im Sterben. Der Dummkopf trat ins Haus und tatsächlich, da lag die Mutter im Bett und lächelte, denn sie war überzeugt, dass ihr Sohn nun seinen Verstand erhalten hätte, und sie schloss beruhigt die Augen und starb.«
Die alte Frau, die vorhin so wissend genickt hatte, schüttelte betrübt den Kopf.
»Wie der Dummkopf da so neben seiner toten Mutter saß, da musste er an all das denken, das er an seiner Mutter so liebte … ihr knuspriges Brot … ihr köstlicher Eintopf …«
Ein paar Zuhörer lachten.
»Und da wurde ihm bewusst, dass seine Mutter das war, das er am meisten liebte. Also brachte er ihr Herz zu der weisen Frau. ›Gut‹, sagte diese, ›hier deine Frage: Welches Getränk ist am stärksten?‹ Der Dummkopf dachte nach, doch er fand keine Antwort und musste wieder gehen. Ach, wie war er unglücklich! Er setzte sich an den Wegesrand und weinte. Da kam eine junge Frau vorbei und fragte ihn, was ihn betrübe und er erzählte seine Geschichte. ›Oh, so bist du nun ganz alleine‹, sagte die junge Frau. ›Ich will dich heiraten, denn man sagt, Dummköpfe geben die besten Ehemänner ab.‹«
Wie erwartet, lachten die Frauen und die Männer verzogen das Gesicht. Nur ein dünner Greis ließ ein belustigtes, lang anhaltendes Gackern hören.
»Als die junge Frau und der Dummkopf das Band der Ehe gebunden hatten und gemeinsam das Bett teilten, da wurde dem Dummkopf bewusst, dass er seine Braut am liebsten hatte auf der Welt und er hatte Sorge, nun ihr Herz der weisen Alten bringen zu müssen. ›Aber was‹, sagte seine Braut, ›wir gehen einfach gemeinsam zu ihr und beantworten ihre Fragen.‹ – ›Oh, es sind schwere Fragen, nichts für Weiberköpfe!‹ Und er stellte ihr zum Beweis die erste Frage, was denn aussehe wie eine Katze, miaute wie eine Katze, aber keine Katze sei. Zu seiner Überraschung lachte seine Braut nur und sagte: ›Das ist doch einfach, das ist der Kater!‹«
Ich gab dem Gemurmel in meiner Zuhörerschaft kurz Zeit, sich wieder zu beruhigen. Manche schüttelten belustigt den Kopf, einer schlug sich mit der Hand gegen die Stirne.
Der ältere Bub rief laut: »Das wusste ich!«
»So stellte der Dummkopf auch die zweite Frage – was denn das stärkste Getränk sei – und als seine Braut antwortete: ›Das Wasser, denn es trägt ganze Schiffe‹, da wusste er, dass sie wohl die Fragen der Alten beantworten konnte, ohne dass er ihr Herz darbringen musste. So gingen sie am nächsten Tag zu der weisen Frau.
›Dies ist mir das Liebste auf der Welt‹, sagte der Dummkopf, ›aber sie will nicht, dass ich ihr das Herz herausschneide.‹ Die Alte nickte und sagte: ›Wir wollen sehen, ob du deinen Verstand erhalten hast. Was ist das? Vorne eine Heugabel, in der Mitte ein Fass und am Ende ein Besen.‹
Der Dummkopf dachte nach, doch er hatte keine Ahnung. Da stieß seine Frau ihn in die Seite und sagte: ›Das ist die Kuh.‹ – ›Die Kuh?‹, wiederholte der Dummkopf verdutzt. ›Richtig, die Kuh‹, sagte die Alte. ›Wie ich sehe, hast du deinen Verstand erhalten.‹
›Wo?‹, fragte der Dummkopf und sah sich um. ›Nun, er ist im Kopf deiner Frau, gib gut darauf acht und du wirst ein glückliches Leben haben.‹ Und so war es, der Dummkopf lebte lange und zufrieden und er war sehr glücklich, denn er hatte nicht nur seinen Verstand erhalten, sein Verstand war auch noch hübsch und konnte gut kochen.«
Ich schlug einmal laut die Hände zusammen und verbeugte mich. Branna hinter mir flatterte mit den Flügeln und krächzte. Die Menge lachte und klatschte.
Eine Bäuerin reichte mir lächelnd einen Apfel, eines der Kinder kam mit einer schrumpeligen Rübe angerannt. Die Menge zerstreute sich in einer Stimmung guter Laune, plaudernd und kichernd. Viele verneigten sich dankend vor mir und legten etwas zu meinen Füßen – ein Stück Brot, eine kleine Münze, ein paar Nüsse.
Die Kinder, die sich vor mir hingesetzt hatten, sahen mich abwartend an. Ich lächelte.
»Lauft. Vielleicht lauert ja woanders noch eine Geschichte auf euch.«
Ich packte zusammen, was man mir gegeben hatte. Nun konnte ich guten Gewissens in einer der Garküchen ein Essen bezahlen.
Cú hatte sich hinter dem Handwagen aufgerichtet. Er knurrte ganz leise. Ich sah auf. Nur noch wenige Menschen standen um mich herum. Eine junge Frau, die neben der Türe der Ausschank an der Wand lehnte und mich lächelnd betrachtete. Und ein Mann, der mit verschränkten Armen vor mir stand.
Kapitel 3: Der Ambactos
»Wir legen hier Wert auf Ordnung«, sagte der Mann harsch. Er trug einen Schnurrbart nach der hier gebräuchlichen Art, doch sein Haar war kurz geschnitten und nach vorne gekämmt, wie es die Römer taten. Und er wirkte gar nicht angetan von meiner Anwesenheit.
»Ordnung ist immer etwas sehr Löbliches«, sagte ich höflich.
Der Mann nickte, beinahe irritiert.
»Ja. Wer hier auf dem Markt seine Waren feilbietet, hat sich zuvor einzutragen. Voccio, Herr der Noricer, hat diesen Markt ins Leben gerufen, um Händlern aus aller Welt einen Ort zu geben, wo sie sicheren Handel betreiben können, ohne sich in kriegsführende oder verfeindete Gebiete wagen zu müssen. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, ist es nötig, dass jeder, der hier Waren zum Kauf anbietet oder mit Vorführungen und Dienstbarkeiten Geld einnimmt, der Marktaufsicht namentlich bekannt ist und in die entsprechenden Aufzeichnungen eingetragen wurde.«
Er hatte diese Rede gewiss schon oft gehalten.
»Das tut mir leid«, sagte ich, freundlich lächelnd. »Hätte ich das gewusst, wäre ich selbstredend sogleich zur Marktaufsicht gegangen. Wenn du so liebenswürdig wärst, mir den Weg dorthin zu weisen?«
Ich war angespannt. Auch wenn der Mann Voccio genannt hatte und ich den Reix der Noricer schätzte, seit ich einen halben Mond auf seiner Duron verbracht hatte, ein derartiges Maß an Ordnung und offenbar schriftlichen Aufzeichnungen war für meinen Geschmack doch zu römisch. Von solchen Dingen hatte ich in Gallien genug erlebt.
Der Mann setzte ein zufriedenes Lächeln auf.
»Du brauchst mir nur zu folgen, meine Schreibstube ist gleich dort drüben.«
Eine Schreibstube. Kein Wunder, dass einige der anderen Stammesführer Voccio vorgeworfen hatten, er wäre ein Verbündeter der Römer. Und das hier war wohl sein Ambactos, sein Verwalter und Aufseher. Dies hier war gewiss jener Markt, von dem Voccio erzählt hatte. Ein Ort, den er vor einigen Jahren geschaffen hatte, um römische Händler anzuziehen und von den Dörfern fernzuhalten.
Ich überlegte, ob ich tatsächlich hier bleiben wollte. Doch die Götter hatten meinen Weg hierher gelenkt. Meine Neugierde und die Hoffnung, ein Zeichen zu finden, war zu groß, als dass ich sogleich wieder weiterzöge.
»Das trifft sich gut«, sagte ich daher, als ich mit meinem Handkarren und meinen beiden Begleitern dem Ambactos an den Rand des Marktes folgte. »Als Aufseher über den Markt bist du wohl die rechte Person, mir zu sagen, wo eine alleine reisende Frau eine sichere Unterkunft finden mag.«
»Wir werden sehen«, sagte er und hieß mich in ein gemauertes Haus eintreten. Das Zimmer war klein, doch es verfügte über eine große Fensteröffnung zum Markt hin, die dem Ambactos nicht nur einen guten Blick über das Geschehen dort erlaubte, sondern auch Licht genug zum Schreiben, wenn die Fensterläden geöffnet waren.
Ich ließ den Handkarren in der offenen Türe stehen, mit Cú und Branna als Aufsicht. Drinnen wäre nicht genug Platz für uns alle.
Die Rückwand des Raumes war bis zur niedrigen Decke mit schweren Regalen gefüllt, in deren Fächern Pergament- und Papyrusrollen lagen. Seit ich das erste Mal solch eine Rolle mit den geschriebenen Zeichen gesehen hatte, war ich davon fasziniert gewesen. Es widersprach den Ansichten und Geboten der Druiden, Wichtiges aufzuschreiben, und auch Tegid hatte immer wieder betont, dass nur, was man wissend im Herzen trägt, nicht verloren gehen kann. Allzu oft geschah es, dass Niedergeschriebenes einem Feuer oder dem Wasser zu Opfer fiel. Aber die Fähigkeit, Gesprochenes für lange Zeit auf einer Tierhaut oder verflochtenen Grasfasern zu erhalten, schien mir immer schon so sehr wie Zauberei, dass Morfran mich gelehrt hatte, lateinische Buchstaben zu schreiben. Niemals unsere Geschichten, hatte er mir eingeprägt, niemals Dinge, die Feinde nicht wissen dürfen oder den Göttern missfielen, wenn sie auf dünnem Gewebe eingefangen würden.
Meine Augen glitten über die Regalfächer. Das Pergament hatte die unterschiedlichsten Farben, ich erkannte den gelben Schimmer der Schafshaut und einige, die beinahe weiß geworden waren von Kalk und Bimsstein. Gewiss gab es auch Rollen aus Vellum, die Römer legten auch in ihren Aufzeichnungen Wert darauf, dass Wichtiges auf edlem Pergament niedergeschrieben wurde. Und was gab es Edleres als das Pergament aus ungeborenen Kälbern?
Es kribbelte in meinen Fingern. Nur zu gerne würde ich den Tag in diesem Kämmerchen verbringen und versuchen, meine Kenntnisse im Schreiben und Lesen zu verbessern. Und nun würde der ernst dreinsehende Ambactos auch meinen Namen auf solch einer Rolle verewigen… Während meine Geschichten mit dem Wind davonflogen, würde mein Name hier bestehen bleiben.
Doch der Marktaufseher hatte die großen Fensterläden geöffnet und bückte sich, um aus einem der unteren Fächer einen hölzernen Rahmen herauszunehmen. Er entknotete zwei gewebte Bänder, die einen dünnen Holzdeckel hielten. Eine Wachstafel, wie auch Morfran sie benützt hatte, mich die Buchstaben zu lehren.
Der Ambactos sah zu mir hin, den Griffel in der Hand.
»Solltest du dich auf Dauer hier in Solva niederlassen, so müssten wir deinen Namen in das Register des Ortes eintragen. Aber ich gehe davon aus, dass du eine Umherziehende bist?«
Ich nickte mit einem leisen Seufzen.
»Dein Name, der Grund deiner Anwesenheit hier und die Ware, die du bietest?«
Er hatte sich auf den niedrigen Hocker gesetzt und erwartete meine Antwort.
»Ich bin Arduinna, geboren im Stamm der Silurer in Albion, jenseits des schmalen Meeres.«
Ich wartete ab, bis er alles in die dünne Wachsschicht geritzt hatte. Ich wünschte, ich könnte sehen, was er schrieb, mir selbst beweisen, dass ich das Lesen noch nicht wieder verlernt hatte, doch er hielt die Tafel so, dass ich nur den hölzernen Rücken sah. Doch ich hörte ihn »Aus Britannien« murmeln und es missfiel mir sehr, dass er den Namen benutzte, den die Römer Albion gegeben hatten.
»Grund der Anwesenheit? Welcher Tätigkeit gehst du nach?«
In Voccios Duron hatte die Bezeichnung Bardin mir Ehrerbietung und Wertschätzung verschafft, wie an so vielen Orten, die fern der römischen Herrschaft waren. Doch hier … es schien mir gefährlich, jene Bezeichnung zu benützen. In Gallien waren Druiden getötet und den Barden verboten worden, ihre alten Lieder zu singen. Bei Römern hatte ich keinerlei gute Erfahrungen gemacht mit dem Wort Barde.
»Ich erzähle Geschichten.«
Der Ambactos musterte mich von unten herauf.
»Das war nicht zu überhören. Ich rate dir, deine Geschichten klug zu wählen.«
Ich nickte.
»Ich trage Gaukelspieler ein. Und als Ware Geschichten und Scherze. Singst du Lieder?«
Was er tat, war sehr freundlich, das wusste ich, auch wenn seine Stimme nach wie vor streng und korrekt klang.
»Nein. Keine Lieder. Ich besitze auch keine Leier.«
Nie wieder, das hatte ich mir geschworen.
Er sah erneut auf. »Das ist gut. Wir wollen Frieden hier auf dem Markt, keinen Unmut und keine Streitereien. Wer in Raufhandel verwickelt wird oder trunken Unruhe stiftet, wird bestraft und muss Solva verlassen.«
Er legte den Deckel wieder auf die Wachstafel und band die Bänder herum, um das Niedergeschriebene zu schützen.
»Es gibt keinen Markt nördlich der Alpen, der solch eine Vielzahl von Händlern aus aller Welt sieht. Hier herrschen Sicherheit und Ordnung, für Händler und Käufer. Wertvolle Waren werden hier verkauft, für die ein Händler sonst ein großes Aufgebot an Schutzgeleit und Wachen bräuchte, um sie in diesen Mengen weit in den Norden zu transportieren. So sind es die Käufer, die nur mit einem kleinen Teil davon reisen. Dies verdanken wir unserem Magosreix Voccio, Hochkönig über mehr als ein Dutzend Stämme. Und ich dulde nichts, absolut nichts, was diese Sicherheit und Vorrangstellung dieses Marktes in Gefahr bringt.«
Er war zur Türe gegangen und ich folgte ihm hinaus, mit einem letzten sehnsüchtigen Blick auf all die Pergamente.
Der Ambactos deutete eine schmale Gasse hinab.
»Das Haus gegenüber dem Glasperlendreher. Sag, dass ich dich schicke.«
Kapitel 4: Die Fremde
Aiulf war zur anderen Seite des Marktes unterwegs gewesen, als er die Erzählerin hörte. Nur das Ende der Geschichte, und doch freute es ihn. Das war etwas, das er in Solva bislang vermisst hatte. Es gab Musiker und Sänger, doch auch die waren meist im Dienste reicher Händler und spielten in deren Häusern auf. Auf dem Markt fand man nur – Stümper. Kinder mit Flöten aus Zweigen des Elhorn Strauches, oder den beinlosen Bettler, der auf einer Knochenflöte vor sich hin spielte.
In seiner Heimat wurde viel erzählt. Und gesungen. Hier in Solva wurde gehandelt, ein guter Handel mit Wein begossen, und Würfel gespielt.
Die Fremde hatte einen Raben bei sich. Der Vogel Odins. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass die Menschen hier den Raben als Zeichen der Göttin des Krieges sahen, als Todesboten. Für ihn als Nordmann war er Begleiter seines obersten Gottes, des weisen Odin. Allein das hatte schon seine Aufmerksamkeit geweckt. Eine Erzählerin mit einem Raben, doch mit ihrem rotbraunen Haar und der weichen Sprachmelodie gewiss nicht eine aus dem Norden … Er hoffte, sie würde noch öfter ihre Kunst darbieten.
Kapitel 5: Gegenüber dem Glasperlendreher
Das Haus, das der Ambactos mir gewiesen hatte, war ein Tempel. Es wäre einfacher gewesen, direkt auf das frei stehende Gebäude mit den römischen Säulen vor der Türe hinzuweisen, als auf die kleine, unscheinbare Werkstatt des Glasperlendrehers gegenüber. Und zwar um so viel einfacher, dass ich mehrfach die Gasse auf und ab ging, um mich zu vergewissern, dass ich hier richtig war.
Der Tempel war nicht allzu groß und neu gebaut. Und so römisch im Aussehen, dass ich mein Tuch noch weiter ins Gesicht zog. Hatten die Römer hier schon ihre eigene Götterstelle. Dennoch. Solange ich mich nicht als Bardin offenbarte, war ich als Frau wohl auch in einem Tempel der Römer gut und sicher untergebracht. Gewiss sicherer als in einer der Schenken.
Ich klopfte an die rot bemalte Türe. Der ganze Markt brummte und summte wie ein Bienenschwarm und selbst hier in dieser Gasse herrschte reges Treiben – ich fühlte mich müde und hungrig. Erneut fragte ich mich, weshalb die Götter meinen Weg hierher geführt hatten und überlegte, ob ich nicht doch besser weiterzog.
Ich hatte keine Schritte gehört, als die Türe sich öffnete. Vor mir stand eine kleine, ältere Frau, in einem schlichten, ungefärbten Kleid mit einem karierten Peplos darüber. Sie hatte die langen Haare in einem Zopf um ihren Kopf geschlungen, an den Schläfen waren die ersten grauen Strähnen zu erkennen und ihre Augen blickten vorsichtig und durchdringend.
»Verzeiht«, sagte ich und senkte höflich den Blick. »Der Mann, der die Aufsicht über den Markt hat, schickt mich – zumindest hat er mir das Haus gegenüber dem Glasperlendreher als sichere Unterkunft gewiesen.«
Ein jugendliches Lächeln legte sich auf die Lippen der Frau.
»Soso, hat er. Beim Wort Tempel hätte ihm ja die Zunge abfallen können, beim Wort Nemeton hätte ihn wohl der Schlag getroffen … Kommt nur herein, ihr drei. Ihr seid schon am rechten Ort.«
Die geradlinige Warmherzigkeit dieser Frau traf mich mit solcher Wucht, dass ich schlucken musste. Es war selten, dass man mich mit meinen beiden Gefährten so offen aufnahm. Dass meine Gastgeber nicht zögerten beim Anblick der Rabin, die oft den Eindruck des Todesvogels erst durch ihre verspielte Art ausmerzen musste. Und auch Cú mit seiner imposanten Größe und dem wolfsähnlichen Aussehen sorgte meist für Zurückhaltung bei Fremden. Was mir oft durchaus recht war.
Die Frau schloss hinter uns die schwere Türe und augenblicklich umfing mich eine angenehme Ruhe. Der Raum, in dem wir uns befanden, war zwar so römisch von der Anlage und dem Stil, dass mein Magen sich verknotete, aber meine Ohren genossen die Stille und meine Augen, die von dem vielfältigen, bunten Angebot des Marktes ermüdet waren, das schlichte Halbdunkel.
»Furchtbar, nicht wahr?«, sagte die Frau. »Vorigen Sommer stand hier noch ein Nemeton, wie wir es gewöhnt sind, aber sie bilden sich ein …« Sie seufzte. »Nun, das hier zählt, nicht wahr?« Sie deutete auf ihre Brust und ihren Kopf. »Nicht das.« Ihre Hand umfasste den Raum.
Doch kein römischer Tempel, schoss es mir durch den Kopf und ich wurde ruhiger.
»Kommt nur weiter«, sagte sie und schritt vor uns in einen kleinen Innenhof, in dem ein paar junge Bäume aller möglichen Arten in tönernen Töpfen wuchsen. »Nehmt Platz, ihr seht so aus, als könntet ihr alle eine Erfrischung gebrauchen.«
Sie wies auf eine Bank aus Stein, die an einer der Wände stand. Als ich mich setzte, trat durch eine andere Türe eine weitere Frau, alt und runzelig. Die beiden sprachen kurz miteinander, dann verschwand die Alte wieder.
»So«, sagte jene, die mir die Türe geöffnet hatte, und setzte sich neben mich, den Blick über den Handkarren und die beiden Tiere gleiten lassend.
Cú hatte sich zu meinen Füßen hingelegt, ich fand es immer beruhigend, wenn der Hund keine Anzeichen von Vorsicht zeigte. Auf seine Meinung zu einem Ort war so gut wie immer Verlass. Branna inspizierte die Töpfe mit den Pflanzen, auch wenn ich versuchte, sie zu mir zu locken.
»Ich bin Doreann, die Druidin dieses ungewöhnlichen Nemetons.« Sie lachte leise. »Verzeih, Priesterin, wie der Ambactos, den du ja schon kennengelernt hast, möchte, dass ich mich bezeichne. Priesterin des Tempels.«
Ich lächelte. Eine Druidin.
»Du hast mich für eine Tempeldienerin gehalten, nicht wahr?«, fragte Doreann.
Ich nickte ertappt.
»Das macht nichts. Ich mag das. Die Zeiten, wo wir Druiden großmächtig auftraten, sind hier vorbei. Aber das hast du ja wohl selbst schon gemerkt, nicht wahr?«
Ihr Blick glitt zu meiner Schläfe. Unwillkürlich fuhr ich mit den Fingern dorthin, stellte jedoch fest, dass die Druidin unmöglich die drei blau eingeritzten Punkte gesehen haben konnte, das Bardenzeichen. Vielleicht meinte sie ja die dünne Narbe auf meiner Wange. Dennoch nahm ich nun das Tuch ab, legte es gemeinsam mit den drei Haarnadeln in meinen Schoß.
»Ja. Ich bin Arduinna, Bardin geboren vom Stamm der Silurer in Albion, jenseits des schmalen Meeres und seit drei-mal-drei Jahren auf Wanderschaft.«
Doreann nickte. »Du hast einen weiten Weg hinter dir.« Sie lächelte mit Wärme in den Augen. »Und nun bist du hier.«
Die alte Frau kehrte zurück, ein Tablett in Händen, auf dem drei Trinkschalen und eine Schüssel mit Obst standen. Sie reichte je eine Schale der Druidin und mir, stellte die dritte auf den Boden für Cú. Sofort kam Branna angehüpft und krächzte freudig. Die beiden Frauen lachten leise.
»Rusa wird ein Zimmer für dich richten. Es sind hübsche Zimmer, die Padrig hier bauen ließ. Aber es wird dich vielleicht ein wenig Gewöhnung kosten, innerhalb von Steinwänden zu schlafen.« Sie beugte sich zu mir, senkte die Stimme. »Manchmal verlasse ich abends Solva, um draußen im Wald zu nächtigen.«
Die Alte stellte die Schüssel mit Obst zwischen die Druidin und mich und schlurfte wieder davon.
Ich nippte an der Schale. Es war verdünnter Met, süß und golden, wohltuend für den Durst.
Wir schwiegen, sahen beiden Cú und Branna zu, die sich am Wasser labten.
Was für ein eigenartiger Ort dies war. Wie eine andere Welt und doch nur ein paar Tagesmärsche von Voccios Duron entfernt. Dort herrschten die Druiden noch in ihrer vollen Macht, sangen die Barden ihre Lieder. Hier hatten die Römer bereits nach dem Ort gegriffen, ohne auch nur einen Soldaten geschickt zu haben. Ich fragte mich, ob Voccios Weg der rechte war. Gewiss, die Römer brachten Reichtum und Luxus, und der Handel mit ihnen hatte vielen diesseits der Alpen Wohlstand beschert. Hier war nicht wie in Gallien mit Gewalt die römische Lebensart eingeführt worden und doch war sie hier, wagte eine Druidin in einem norischen Tempel nicht, sich offen so zu nennen. Ließ sie es zu, dass ihr Nemeton zu einem Steinhaus umgebaut wurde …
Doreann sah mich ernsthaft an, als errate sie meine Gedanken.
»Alles ändert sich, ständig. So müssen auch wir uns ändern, wollen wir nicht im Strudel der Geschichte untergehen. Es ist egal, wie die Dinge genannt werden, finde ich. Eine Eiche ist eine Eiche, egal wie wir sie nennen, nicht wahr?«
Ich ließ den Blick über den Innenhof gleiten. Über die Bäumchen, die eigentlich mächtige Bäume in einem heiligen Hain sein sollten und nun nur noch Symbole ihrer selbst waren. Über die bemalten Wände, die fehlende Himmelsweite.
»Verzeih, wenn ich da nicht deiner Meinung bin. Worte haben Macht, große Macht.«
Doreann lachte. »Oh, welch Freude, jemanden zu Gast zu haben, der mir widerspricht! Es ist lange her, dass ich mit jemandem vom gleichen Stand gesprochen habe! Wir werden wunderbare Abende miteinander haben, das sehe ich schon. Doch nun …«
Sie trank ihre Schale leer und erhob sich.
»Ich will dir noch rasch alles zeigen, dann kannst du deine Sachen in dein Zimmer geben. Wir sehen uns dann zu Sonnenuntergang, wenn du willst, bei den Abendriten. Aber nun erwarte ich in Kürze einen Gast, dem ich meine volle Aufmerksamkeit widmen muss.«
Ich leerte ebenfalls rasch meine Schale und stellte sie auf die Bank. Doreann reichte mir einen Apfel aus der Obstschüssel.
»Nimm nur. Du kannst deine Freunde und deinen Karren ruhig hier im Atrium lassen, bis wir zurück sind.«
Ich folgte der Druidin auf einen Rundgang durch den Tempel. Hinter dem Innenhof befand sich der Raum, der den Göttern geweiht war. Er strahlte ein sonderbares Gefühl aus, obwohl wir nur in der Türe standen und gar nicht eintraten. Man hatte einen flachen Felsen in der Mitte des großen quadratischen Raumes platziert, darauf brannte Feuer in einer Schale. Es gab keine Fenster, nur kleine Lüftungsöffnungen knapp unter dem Dach. Ich schluckte. Das hatte so wenig mit einem heiligen Hain zu tun wie das stumpfe Messer eines Knaben mit dem Schwert eines Kriegers.
Doreann warf mir nur einen kurzen Blick zu und führte mich weiter, zeigte mir, wo ich die Küche fand, um Wasser zu holen, das in einem großen, bronzenen Gefäß aufbewahrt wurde, und zeigte mir schließlich meine Kammer.
Eine kleine Öffnung, mit Gittern und einem Fensterladen gesichert, blickte über die schmale Gasse auf ein hölzernes Haus, vor dem ein Korbbinder saß. Das Zimmer hatte einen Boden aus Stein und verputzte Wände, auf denen Symbole und Bilder gemalt waren. Und ein Bett. Ein richtiges Bett, kein aufgeschüttetes Stroh oder eine Erhöhung aus Erde mit Fellen darauf, nein, ein Bett aus Holz mit kunstvoll geschnitzten Beinen und einer dicken Matratze aus Leinen. Meine Hand strich vorsichtig darüber. Das war kein grobes Stroh darin, das waren feine Spelzen. Neben dem Bett stand eine offene, leere Truhe für den Besitz des Gastes, und diese Truhe verfügte sogar über ein Schloss. Auf einem kleinen Tisch standen eine weitere Schüssel mit Obst und eine Öllampe, an der Wand waren zwei Halterungen für Kienspäne.
»Das ist ein Zimmer, wert für einen Reix …«, sagte ich.
Doreann lachte. »Es ist kein Wunder, dass so viele den Verlockungen der Römer erliegen, nicht wahr? Aber es ist tot … es fehlt die Seele der Göttin, auch wenn ich mich bemühe, sie hereinzuholen.« Ihr Blick glitt zu den Symbolen an der Wand. »Wahrscheinlich mögen die Götter den Wald immer noch lieber. So, nun findest du dich zurecht. In der Gasse hinter dem Tempel befinden sich Latrinen – ich schätze, du weißt, was das ist. Wenn du etwas benötigst, Rusa findest du meistens in der Küche. Ich freue mich sehr, wenn du abends mit mir speisen möchtest und noch mehr, wenn ich dich bei den Riten sehe.«
»Ich werde da sein«, sagte ich. »Was schulde ich dir für die Unterkunft?«
Die Druidin lächelte. »Deine Gesellschaft. Vielleicht eine Geschichte. Einen Hauch früherer Zeiten.«
»Du bist zu großzügig«, sagte ich.
»Ich kann es mir leisten. Und sei versichert, eure Gesellschaft bereitet mir mehr Vergnügen als Münzen im Tempelschatz.«
Doreann wandte sich bereits zum Gehen, drehte sich dann aber noch einmal um.
»Sei vorsichtig auf dem Markt. Und vergiss dein Kopftuch nicht …« Sie lächelte.
Kapitel 6: Der Nordmann
Der Ziegenfellbeutel fühlte sich ungewohnt leicht an, da ich meinen Umhang und jene Dinge, die weder besonders wertvoll noch für einen Gang über den Markt nötig waren, in der verschließbaren Truhe gelassen hatte. Das dünne Stück Eisen mit den zwei hochgebogenen Hörnern vorne, das genau in das Schloss der Truhe passte, hing kühl an meiner Brust. Cú trottete nahe an meinem Knie neben mir her, Branna saß wie so oft auf meiner Schulter. Ich war es gewohnt, dass man mir misstrauische Blicke zuwarf mit meinen Gefährten, doch nun traf ich auch auf lächelndes Nicken, vor allem von Frauen. Ich erkannte das eine oder andere Gesicht wieder, das vorhin meiner Geschichte gelauscht hatte.
An einer kleinen Garküche kaufte ich mir etwas Getreidebrei, den die Standfrau mir in die bronzene Schale füllte, die ich immer an meinem Gürtel trug. Sehr großzügig füllte sie noch einen zusätzlichen Schöpflöffel voll hinzu, mit einem kleinen Zwinkern in den Augen. Ich setzte mich auf eine Kiste vor einem Laden und aß rasch, ehe Branna zu lästig wurde mit ihrer Bettelei. Jedes Mal, wenn ich meine Finger in die warme Masse tauchte, schoss Brannas großer Schnabel dazu. Ich hätte den Tieren zuerst etwas kaufen sollen, doch der Duft der Gerste mit den Erbsen und dem Schweinefett war zu verlockend gewesen. Cú schleckte die Schale aus und ich kaufte an einem Stand am Rande des Marktes ein Huhn für die beiden, das Hund und Rabe genüsslich gemeinsam zerlegten. Zwei weitere Hunde näherten sich, magere Streuner, blieben in der Nähe, solange Cú sie mit seinem leisen Knurren auf Abstand hielt, und stürzten sich auf die Reste, sobald ich meine Begleiter zum Weitergehen rief.
Ohne Handkarren und Haselstab war es ein Vergnügen, über den Markt zu schlendern. All die fremdländischen Waren ließen in meinem Kopf Geschichten entstehen, voller Bilder und Düfte. Ich könnte den mir zugestandenen halben Mond hier nur damit verbringen, die Menge an unterschiedlichen Menschen zu beobachten und Geschichten zu erfinden.
Vor einem der hölzernen Häuser sah ich den Jungen wieder, der während meiner Geschichte immer seine Meinung kundgetan hatte. Er erhielt gerade eine Ohrfeige von einem Mann, der wohl sein Vater war, wenn man nach der Ähnlichkeit der Gesichtszüge ging. Schmollend setzte sich der Junge auf einen Schemel vor dem Haus und ritzte etwas in ein Kuhhorn.
Als er sah, dass ich ihn beobachtete, streckte er mir die Zunge heraus. Ein äußerst kindisches Benehmen für einen Jungen, der wohl bald ein Dutzend Sommer zählte.
Ich wandte mich dem Haus daneben zu, das ebenfalls aus Holz war. Die Fensterläden waren nicht seitlich, sondern oben und unten an einer großen Öffnung befestigt, sodass sie nun offen einen Ladentisch mit Regendach ergaben. Eine bunte Auswahl an den verschiedensten Dingen lag da, Tiegeln mit Salben, Armbänder aus Glasperlen, dunkle Blöcke mit Aschenseife. Doch was mir ins Auge stach, war ein Käfig, der an einem Haken hing. Darin saß ein prächtiger Vogel, ein Habicht. Branna begann aufgeregt zu keckern, als sie ihn sah.
»Mooorgn!«, rief sie und trippelte von einer meiner Schultern zur anderen.
»Einen hübschen Raben hast du da«, sagte der Händler, der gerade eine Schüssel mit fremdartigen Gewürzen zurechtrückte.
Seine Augen leuchteten so blau aus dem Dunkel des Hauses heraus, dass sie mich an das Meer erinnerten, das ich so vermisste. Er sprach mit einem harten Akzent und die beiden hellblonden Zöpfe, die über seine Schultern reichten, verrieten, dass er wohl weit aus dem Norden kam.
»Danke. Du hast einen Habicht.«
Er sah zu dem Käfig hin.
»Ja. Ich habe den Habicht bezwungen. Nun ist er in meiner Hand.«
Meine Knie wurden weich. War dies ein Zeichen? Hier war ein Mann, der den Habicht bezwungen hatte, und Morfran der Habicht, Barde der Carnuten, war es gewesen, der vor drei-mal-drei Jahren das cynnedyf über mich verhängt hatte.
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte und konnte nur auf den Mann und den Habicht starren.
Der Nordmann lächelte. »Ich hab dich erzählen hören. Gute Geschichte. Hat schon mal jemand die Rätsel erraten?«
Immer noch verwirrt, nickte ich.
»Das passiert immer wieder. Nicht oft, aber doch.«
Ich riss meine Augen von dem Habicht los und betrachtete die Waren, die ausgelegt waren. Meine Finger glitten über ein Messer, in dessen Griff ungewohnte Zeichnungen geschnitzt waren. Mein Herz klopfte und ich zwang mich, all meine Aufmerksamkeit auf die Gegenstände vor mir zu legen und nicht an den Vogel und die Worte des Nordmanns zu denken.
»Du hast schöne Waren.«
Ich wünschte, dass ich etwas davon benötigen würde, um noch länger hier stehen zu können, doch ich hatte mich erst vor kurzem in Bragnreica mit allem eingedeckt, das ich für den bevorstehenden Winter brauchte.
»Wie hast du den Habicht gefangen?«, fragte ich deshalb jene Frage, die mich beschäftigte.
Das Lächeln des Nordmanns wurde noch breiter. Er strahlte eine Ruhe aus, wie ich es auf dem ganzen Markt nicht erlebt hatte. Ruhe und Zufriedenheit. Dieses Gefühl spürte ich hier und da in meinen Träumen, wenn die Stimme mich umfing und mir versprach, dass wir einander finden würden und dann alles ein Ende fände. Loïcs Stimme.
Anstatt sofort zu antworten, nahm der Nordmann den Käfig von seinem Haken und trat damit aus dem Haus heraus, zu mir her. Er stellte den Habicht auf seine Ladentheke, direkt vor mir. Branna schlug aufgeregt mit den Flügeln, krächzte und konnte sich kaum beruhigen. Der Habicht hinter den Stäben aus festem Weidengeflecht saß beinahe reglos, als ginge ihn das alles nichts an. Es kam mir so vor, als hätte sich die Seele des Vogels längst aus dieser Enge erhoben und würde den Körper wohl bald nach sich holen, obwohl das glänzende Gefieder noch von guter Gesundheit sprach. Es war die Gefangenschaft, die dieses prächtige Tier zugrunde richtete. So schön der Vogel war und so leid er mir in dieser engen Behausung tat, für einen kurzen Augenblick fühlte ich Genugtuung, als säße tatsächlich Morfran der Habicht hier eingesperrt, den Launen des Nordmanns ausgeliefert.
Ich beugte mich vor, um dem Habicht in die Augen zu sehen, doch er schloss sie, verweigerte sich meinem Blick. Branna hüpfte von meiner Schulter auf meinen Kopf, verkrallte sich in dem Tuch, das ich über den Haaren trug, sodass ich sie von dort oben wegscheuchte.
Neben mir reckte Cú neugierig die Schnauze, um zu riechen, was seine Gefährten da oben auf der Ladentheke so gespannt betrachteten.
»Ich muss gestehen, es war keine Heldentat, kein Kampf auf Leben und Tod. Ich hatte Fallen ausgelegt, um Hasen zu fangen … und dieses Prachtexemplar hat sich in einer der Schlingen verfangen. Aber er hat mir einen ganz schönen Kampf geliefert, bis ich ihn hier hatte.« Er zeigte auf einige tiefe Kratzer auf seinem Unterarm. »Und nun ist er mein.«
Ich bemerkte nun bei genauerer Betrachtung die blutige Kruste am Bein des Vogels, wo dieser wohl verzweifelt versucht hatte, sich von der Schlinge zu befreien.
»Und was machst du jetzt mit ihm?«
Ich sah dem Händler in die Augen. Er hatte wirklich einen Blick wie die ruhige See.
Er zuckte die Schultern. »Mal sehen. Vielleicht verkaufe ich ihn. Vielleicht behalte ich ihn auch, so wie du deinen Raben. Er zieht offenbar Kundschaft an …«
Sein Lächeln war warm. Der Mann, der den Habicht bezwungen hatte … Meine Knie waren immer noch weich. Noch nie hatte ich ein deutlicheres Zeichen von den Göttern erhalten. Sollte ich wirklich, nach drei-mal-drei Jahren, endlich denjenigen gefunden haben, der mir helfen würde, das cynnedyf zu lösen?
Jemand näherte sich dem kleinen Laden, zwei Frauen, die edle Tücher um die Schultern geschlungen hatten, und hinter ihnen zwei Burschen, die in Körben die Einkäufe ihrer Herrinnen trugen. Mutter und Tochter, schätzte ich auf einen kurzen Blick.
Der Nordmann lächelte mir erneut zu und nahm den Habicht wieder in das Haus hinein.
»Ich schätze, wir sehen uns wieder«, sagte er und wandte sich dann den beiden Frauen zu. »Ich habe die Kräuterpaste erhalten, um die ihr mich gebeten habt, mein Bote ist gestern Nacht angekommen.«
Verwirrt und ein wenig schwindlig ging ich weiter.
Cú stupste mir mit seiner feuchten Schnauze gegen die Hand, als verstünde er nicht, was mit mir war.
Ich lachte nervös.
»Er hat den Habicht bezwungen, was sagt man dazu.«
Kapitel 7: Ein erstes Gespräch
All die bunten Stände und die Düfte und Klänge, die mich noch vor wenigen Augenblicken mit Geschichten erfüllt hatten, waren nun verschwunden. Ich sah nur noch die Augen des Nordmanns und den Habicht in seinem Käfig vor mir, als ich mich wie im Traum über den Marktplatz weiterbewegte. Branna krächzte und beinahe stieß ich gegen einen Mann, der einen Karren hinter sich herzog, auf dem Enten in geflochtenen Kisten aufgeregt schnatterten.
Ich holte tief Luft. Drei-mal-drei Jahre. Die Möglichkeit, dass die Zeit des erzwungenen Wanderns, die Zeit der Heimatlosigkeit, sich einem Ende nähern könnte, machte mir Angst, obwohl es doch war, was ich mir erhoffte, seit Morfran mich mit dem cynnedyf belegt hatte.
Ich setzte mich auf eine schmale Bank, den Rücken gegen die Hauswand gelehnt, und versuchte, mein klopfendes Herz wieder zur Ruhe kommen zu lassen.