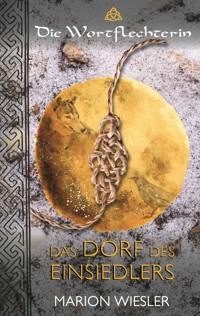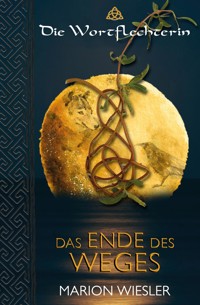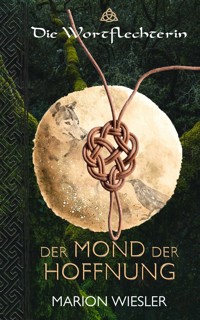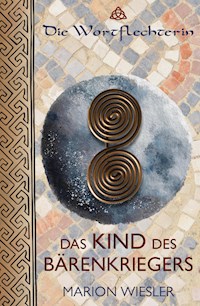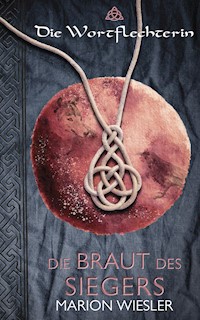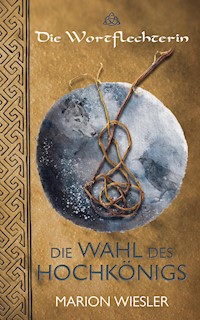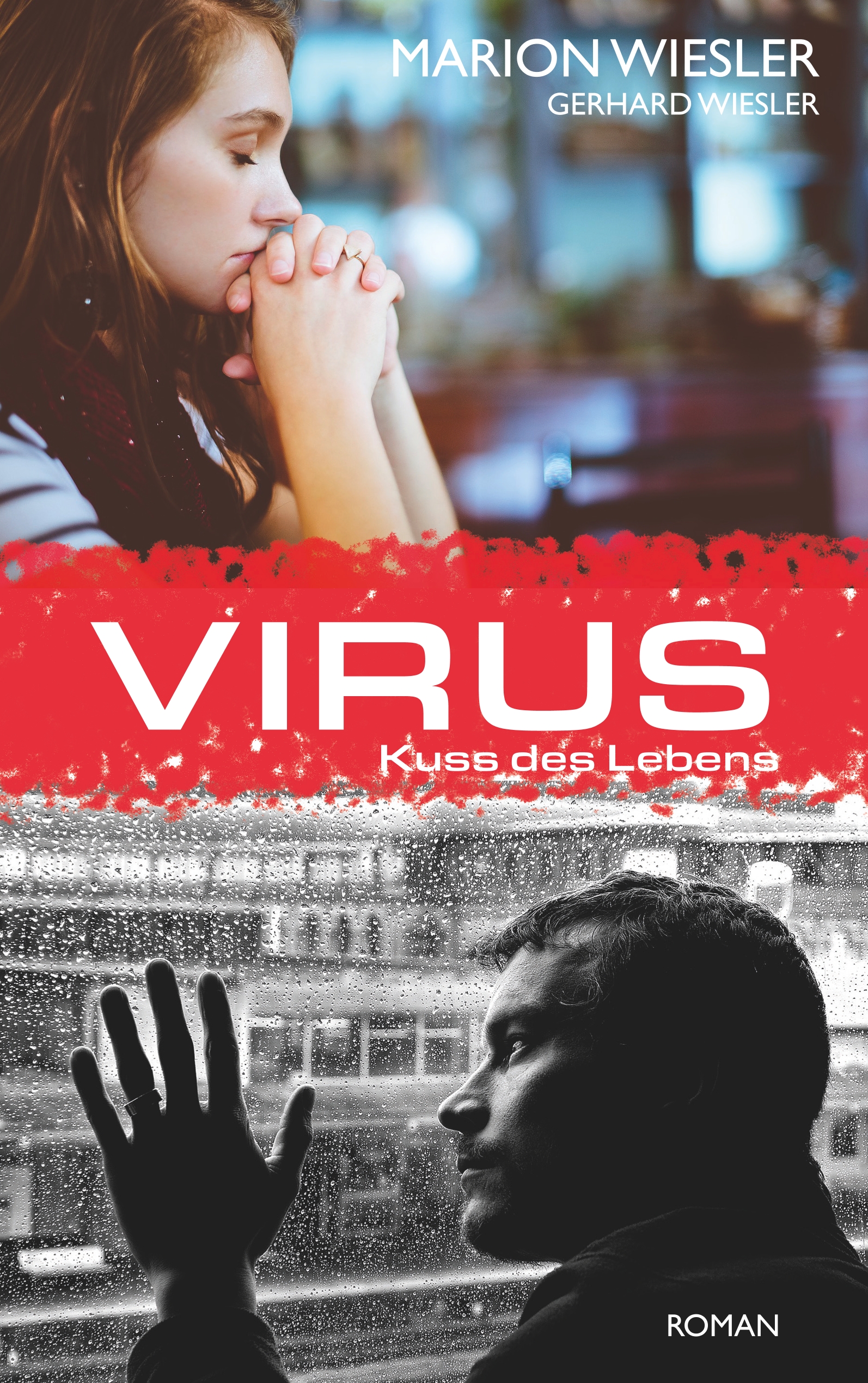2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Machtvolle Worte sind die Gabe der Bardin, der Mond ihre Herrin, ein Fluch ihr Antrieb. Gallien, im Jahr 47 vor unserer Zeitrechnung Ihr eigener Meister hat ein grausames Gebot über die junge Bardin verhängt: nur durch ihre ständige Wanderschaft kann sie den Mann schützen, den sie liebt. Von nun an ist sie auf sich gestellt, als Frau alleine unterwegs in einer gefährlichen Welt, abhängig von ihren eigenen Fähigkeiten, um zu überleben. Noch hat sie keine Ahnung, welche Abenteuer und Aufgaben auf sie warten. Die Macht ihrer Worte und ihre Entschlossenheit, den Fluch eines Tages zu lösen, sind ihre einzigen Waffen. Es wird sich weisen, ob diese stark genug sind, sie zu befreien. Ein Kurzband der Keltenroman-Serie "Die Wortflechterin". Wem der Geschichtenreichtum in »Der Name des Windes« von Patrick Rothfuss gefallen hat, findet hier Ähnliches in einem real historischen Kontext. Tauch ein in die Welt der Kelten und fühle den Pulsschlag jener Zeit in dir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Marion Wiesler
Die Zeit des Aufbruchs
Keltenroman
Prequel der Keltenroman Serie "Die Wortflechterin"Inhaltsverzeichnis
Gallia im Jahre 47 vor unserer Zeitrechnung
Weitere Bände der Serie Die Wortflechterin
Ich bin Arduinna
Kapitel 1: In Vesontio
Kapitel 2: Ein fremder Mann
Kapitel 3: Der Hof
Kapitel 4: Feldarbeit
Kapitel 5: Eingewöhnung
Kapitel 6: Die Schleuder
Kapitel 7: Besuch
Kapitel 8: Regentag
Kapitel 9: Die Schafe
Kapitel 10: Fallenstellen
Kapitel 11: Grannus' Rückkehr
Kapitel 12: Bei Matunus
Kapitel 13: Im Wald
Kapitel 14: Zurück in Vesontio
Kapitel 15: Zeit des Lernens
Kapitel 16: Eine Hochzeit
Kapitel 17: Die Schweine
Kapitel 18: Ein Knoten
Lust,
Lust,
Lust,
GLOSSAR
PERSONEN
GESCHICHTEN
Weitere Bücher der Serie
»Die Wahl des Hochkönigs«
»Der Markt der Lügner«
»Die Braut des Siegers«
»Das Fest der Sonnwend«
»Das Kind des Bärenkriegers«
»Der Mond der Hoffnung«
»Das Ende des Weges«
Weitere Bücher im selben »Universum« wie
Geschichtliches
Danksagung
Marion Wiesler
Impressum
Gallia im Jahre 47 vor unserer Zeitrechnung
Dubris:
Hafenort in Britannia, wie die Römer die Insel Albion nannten
Autricum:
Hauptort der Carnuten
Alesia:
Ort der Niederlage für Vercingetorix 52 v. Chr. und
Hauptort der Mandubier
Vesontio:
Hauptort der Sequaner
Weitere Bände der Serie Die Wortflechterin
Die Wahl des Hochkönigs
Der Markt der Lügner
Die Braut des Siegers
Das Fest der Sonnwend
Das Kind des Bärenkriegers
Der Mond der Hoffnung
Das Ende des Weges
Ich bin Arduinna
Ich bin Arduinna, die Wortflechterin.
Geboren von Seelen, die niemand kennt,
Gefunden im Wald unterm Ulmenbaum.
Ewig getrieben vom Wandel des Monds,
Vom Maistir verflucht, nie sesshaft zu sein.
Die Bäume des Waldes sind mir ein Dach,
Die Früchte der Erde mein Brot,
Begleitet von Wesen der Luft und der Nacht
Durchquere ich Täler, Berge und Seen.
Träumend von ihm, dessen Ruf ohne Klang,
Dessen Sein ohne Bild, das Ende des Fluchs.
Ich folge den Göttern, den Menschen zu dienen,
Sie zu erfreuen, doch mir zur Einsamkeit.
Ich bin Arduinna, die Wortflechterin.
Kapitel 1: In Vesontio
Soeben hatte mein Leben ein Ende gefunden, zum zweiten Mal in drei Jahren. Ich hatte vergessen, wie schmerzvoll es war, wenn alles um einen zusammenbrach.
»Pack deine Sachen. Noch ehe Bel in seinem Sonnenwagen den höchsten Stand erreicht hat, verlässt du die Dunon.« Morfrans Worte dröhnten in meinem Ohr, obwohl er sie nur leise gezischt hatte. »Bevor sie es sich noch anders überlegen … Mögen die Götter mit dir sein.«
Ich taumelte, als er seinen Griff um meinen Arm losließ. Da standen sie alle und starrten mich an, schweigend. Die ganze Festung hatte sich vor der Großen Halle versammelt, als die Krieger mich und Loïc herbei geschleppt hatten. Zu ihm wäre ich nun am liebsten gestürzt, in seine Arme, denen sie mich erst am Morgen entrissen hatten. Doch Morfran stieß mich in die andere Richtung. Die Dringlichkeit in seiner Stimme ließ mich folgen, wie ich ihm bis tags zuvor immer gefolgt hatte.
Ich begann zu laufen, erinnerte mich im letzten Moment daran, dass meine Sachen hier waren und nicht im Gästehaus. Wie betrunken wechselte ich die Richtung, stolperte über den Saum meines ungegürteten Kleides. Neben den beiden Pferden stand einer der Krieger, die uns heute aus dem Schlaf gerissen hatten. Er stellte sich mir in den Weg, den Speer auf mich gerichtet. Sein Blick glitt über mich hinweg. Jemand hinter mir deutete ihm wohl, dass er mich gewähren lassen sollte, denn er trat einen Schritt zur Seite. Ich nestelte an den Knoten der Riemen, die meinen Beutel und meine Leier am Rücken des Packpferdes hielten. Ich konnte kaum etwas erkennen. So sehr ich mich auch bemüht hatte, nicht zu weinen, nun war da doch nur Wasser vor meinen Augen. Eine Hand erschien, löste den Knoten, gerade konnte ich noch rechtzeitig hingreifen, ehe meine Leier in ihrem dicken Tuchsack zu Boden fiel.
Das Instrument und meinen Beutel an mich gepresst, stolperte ich weiter. All die Menschen, die sich um uns gedrängt hatten, wichen zur Seite, machten mir Platz. Die eisige Stille, die mich umgab, wurde durchbrochen von der Stimme des Reix der Mandubier.
»So lasst uns in die Halle gehen, auf dass die Feierlichkeiten beginnen!«
Wie eine Welle schwoll nun der Lärm an, nur dort, wo ich weitertaumelte, schwiegen die Menschen einen Augenblick. Ich wagte nicht, mich umzuwenden, so sehr mein Herz nichts mehr wünschte, als noch einmal einen Blick auf Loïc zu werfen. Doch ich wollte nicht sehen, wie sie ihn und seine Braut nun in die Halle geleiteten. Schoben vielleicht. Wehrte er sich? Wie sollte er sich wehren, ohne sein Schwert, zwei Speere in den nackten Rücken gepresst … Der Sohn des Herrschers, behandelt wie ein wildes Tier. Weil er mich liebte.
Ich lief weiter, auf den großen Torbau der Palisade zu. Man ließ mich hindurch, wortlos. Die Luft schien ein wenig kälter, als ich Vesontio hinter mir ließ. Solange ich konnte, lief ich, dann sank ich erschöpft am Rande eines Feldes nieder. Der Boden war frisch umgeackert, erste grüne Triebe schoben sich hoffnungsvoll aus der dunklen Erde, mir zum Hohn.
Mein Atem schlug um sich wie ein trotziges Kleinkind. Würgte mich in der Kehle, fiel tief in meinen Magen, beutelte mich wie ein Hund einen Hasen, den er erwischte.
Er hatte es tatsächlich getan. Mein eigener Maistir, mein Lehrmeister, hatte mich verflucht.
Ich erbrach mich, saures Wasser, das sich auf die kleinen grünen Pflänzchen ergoss. Tief atmete ich ein, zitternd kroch die Luft in meinen Körper.
»Nein, Arduinna, nein«, murmelte ich. »Es war kein Fluch. Ganz gewiss, kein Fluch.«
Ich klammerte mich an das Wort, das Morfran gesprochen hatte. Cynnedyf. Ein Gebot, wie man es in meiner Heimat jenseits des schmalen Meeres nannte. Worte hatten Macht, große Macht. Und auch wenn Morfran behauptet hatte, ein cynnedyf sei ein Fluch, es war nur ein Gebot und konnte gelöst und aufgehoben werden.
»Durch den Tod oder ein eindeutiges Zeichen der Götter«, hatte er gesagt.
Also doch beinahe ein Fluch.
In meinem Kopf drehte sich alles. Vor Sonnenaufgang hatte ich noch in Loïcs Armen gelegen und nun saß ich hier, nur in meiner Camisia, bloßfüßig an diesem kühlen Frühlingstag. Selbst Sonnengott Lug verbarg sich hinter Wolken, die eilig über den Himmel flohen. Sterben hätte ich wollen.
Ich sah zurück zu der Dunon, der großen Siedlung, die auf dem Hügel geschützt hinter ihrer mächtigen Palisade lag. Fast meinte ich, Musik herabklingen zu hören, doch es war zu früh für Musik. Sie feierten Vermählung dort. Der Mann, der zu mir gehörte wie die Finger meiner Hand, und die Tochter des Reix der Mandubier, dieses blasse, rundliche Mädchen.
Erneut würgte es mich.
Ich würde sterben.
Das cynnedyf verlangte, dass ich nie länger als einen halben Mond an einem Ort bliebe. Sonst geschähe den Menschen, die meinem Herzen nahe standen, großes Unheil.
Es gab nur einen Menschen, der meinem Herzen nahe stand, und das war Loïc. Ich würde alles tun, um ihn zu schützen.
Ich wischte mir die bittere Spucke vom Mund. Der Vater der Braut hatte meinen Tod gefordert, weil Loïc mit mir vor der Vermählung geflohen war und damit meinetwegen einen Krieg riskiert hätte. Wahrscheinlich dachte Morfran, ich wäre ihm noch dankbar, dass er die Forderung in ein cynnedyf gewandelt hatte, mein Leben gerettet hatte. Bei den Göttern! Hätten sie mich doch gleich getötet, anstatt mich alleine in die Welt zu schicken! Wie sollte ein junges Weib von zwei-mal-sieben Sommern alleine in der Fremde überleben?
Mein Blick fiel auf das Bündel, das dick in ein Tuch gewickelt vor mir auf dem Boden lag. Meine Leier.
All das Elend hatte doch schon begonnen, als Tegid starb, mein geliebter Tegid, Vatervater, Barde und mein erster Maistir. Mit ihm endete erstmals mein Leben, wie ich es bis dahin kannte. Seines Todes wegen war ich vor drei Sommern bei Morfran gelandet, Morfran, der Habicht, Barde der Carnuten, jung, streng und herzlos. Doch hätte Morfran mich nicht hierher zu den Sequanern mitgenommen, wäre mir Loïc nie begegnet, der mein Herz zum Klingen brachte wie meine Finger die Saiten meiner geliebten Leier.
Ich würde Morfran nicht siegen lassen.
Nach Tegids Tod war ich verloren gewesen, doch ich hatte weiter geatmet, weiter gelebt. Ich würde es wieder schaffen, solange die Hoffnung bestand, Loïc wiederzusehen.
Ich war Bardin, meine Lieder und Geschichten würden mich nähren. Ich würde die Götter gnädig stimmen und sie würden mir eines Tages das Zeichen schicken, dass das cynnedyf gelöst war. Und dann würde ich zu Loïc zurückkehren.
Ich weigerte mich, an die junge Frau zu denken, mit der er heute noch das Band der Ehe binden würde.
Mein Körper zitterte nach wie vor, als ich mich schwerfällig und mühsam erhob. Feuchte Erde klebte an meinem Kleid. Immer war sie da, die Erde, uns aufzufangen, wenn wir fielen. Ich kniete erneut nieder, grub meine Hände in den kalten, dunklen Boden und zog mit den Fingern erdige Striche über meine Wangen, über meine Stirn.
»Beschütze mich, Göttin. Lass mich stark sein.«
Kapitel 2: Ein fremder Mann
Eine Weile war ich verunsichert dagestanden, was ich nun tun sollte. Wohin sollte ich gehen? Das Land rund um Vesontio war durch einen Fluss von der Dunon getrennt und bestand aus Feldern, Weiden und Wäldern. Eine Straße links von mir verband die befestigte Siedlung der Sequaner mit dem Rest der Welt, führte über den hohen Hügel, der den einzigen Freiraum füllte, den der Fluss in seiner Schleife offen ließ. Es widerstrebte mir, dem breiten, lehmigen Weg zu folgen, auf dem Menschen unterwegs waren, die zu den Feierlichkeiten auf der Dunon eilten.
Benütze deinen Verstand, hörte ich Tegids Stimme in meinem Kopf. Was habe ich dich gelehrt?
Oh, er hatte mich so viel gelehrt! Der Gedanke an ihn tröstete mich. Ich sah ihn vor mir, den dunkelblauen Umhang um seine Schultern geschwungen, von einer mit Korallen verzierten Fibel gehalten. Seine blauen Augen, die über dem grauen Bart immer herzlich und fröhlich blitzten, mit lauter kleinen Fältchen daneben. Die Art, wie er mir von klein auf die Welt erklärt hatte, wie ich an seiner Hand sicher durch meine Kindheit ging.
Ich weiß nicht, wie lange ich da stand und vor mich hinstarrte, in Gedanken zurück daheim bei den Silurern. Mein Körper hörte irgendwann auf zu schmerzen oder ich merkte einfach nicht mehr, wie sehr ich zitterte. Ich presste immer noch die Leier an mich, als müsste ich sie wärmen.
Ich hörte auf zu bestehen, nahm Zuflucht in der Vergangenheit, um der Zukunft nicht ins Auge zu blicken. Es gab keine Zukunft in diesem Moment.
Erst als Schritte auf mich zueilten, schreckte ich hoch. In einiger Entfernung auf der Straße stand ein Ochsenkarren, der Ochse hielt den Kopf gesenkt, als döse er. Ein Mann lief quer durch die Felder auf mich zu. Er war klein für die Männer der Sequaner, hatte einen buschigen Schnurrbart und einen kurzen Hals. Seine Braccae fielen mir auf, die Beinkleider waren von einem satten Rot, als wäre er einem Blutbad entstiegen.
Er blieb vor mir stehen, betrachtete mich.
»Dacht ich mir, dass du das bist«, sagte er.
Ich starrte ihn an. Ich kannte ihn nicht. Er sah besorgt aus, wie Tegid, wenn ich krank gewesen war.
Sein Blick glitt meinen Körper hinab. Ich presste die Leier fester an mich. Plötzlich waren da all die Geschichten, die ich gehört hatte. Was Männer mit Frauen taten.
»Ich bin Bardin«, krächzte ich zu meiner Verteidigung und meinem Schutz. Meine Stimme klang wie ein heiserer Rabe, keineswegs wie eine Herrin der Lieder und Geschichten, deren Worte Menschen verzauberten.
»Ich weiß«, sagte er und lächelte. Traurig sah er aber aus. »Hab dich gehört, gestern.«
Ich nickte.
Gestern. Das war ewig her. Da hatten sie mich bejubelt. Hatten gebeten, mehr zu hören. Gestern noch hatte Loïc mich im Arm gehalten, mich angefleht, mit ihm davonzureiten. Hatte mich wie so oft sein Rotkehlchen genannt. Nun, der Habicht fraß kleine Vögel.
»Hab dich auch gesehen … heute Morgen«, fügte er hinzu. »Schlimme Sache.«
Die Tränen schossen erneut in meine Augen, dabei hatte ich gedacht, ich hätte bereits alle vergossen.
»Du wirst dir den Tod holen.«
Sein Kopf nickte zu meinen bloßen Füßen, der dünnen Camisia. Ich zuckte die Schultern. Der Wind blies mir die Haare ins Gesicht.
»Ich fürchte mich nicht vor diesem cynnedyf. Wenn du magst, kannst du einen halben Mond bei mir bleiben«, sagte er.
Meine Arme schlossen sich noch enger um meine Leier. Er sah freundlich aus, hatte graues Haar wie Tegid es gehabt hatte. Aber er war ein Mann. Und ich eine Frau, alleine. Eine junge, wehrlose Frau.
»Meine Tochter und mein Weib freuen sich gewiss, wenn ich dich mitbringe. Es gibt viel Arbeit um diese Zeit des Jahres. Und deine Lieder und Geschichten … Was willst denn sonst? Alleine da stehen, bis die Kälte dich krank macht?«
Ich wies ihn nicht ab, als seine Hand sich um meinen Arm legte. Vom Boden hob er meinen Beutel auf, in dem sich alles befand, was ich noch besaß. Alles, was ich gestern Nacht rasch gepackt hatte, um mit Loïc … Ich ließ mich willenlos zu seinem Karren schieben. Er musste mir hinauf helfen, so steif und kalt war mir. Ich kauerte mich zwischen die leeren Körbe und Kisten, die auf der Ladefläche standen. Erst als er eine dicke Decke über mich breitete, merkte ich, wie sehr ich fror.
Ich schloss die Augen, als er vorne auf den Bock kletterte und den Ochsen antrieb. Doch der Drang war zu groß, obwohl ich es nicht wollte, drehte mein Kopf sich der Dunon zu und mein Blick hielt sich daran fest, bis Vesontio hinter dem hohen Hügel verschwand.
Eines Tages würde ich wiederkommen, das schwor ich mir.
Kapitel 3: Der Hof
Es war bereits früher Abend, als wir einen Weiler erreichten. Ich musste zwischendurch eingeschlafen sein. Als ich erwachte, brauchte ich eine Weile, bis ich wieder wusste, was geschehen war.
Der fremde Mann hielt vor einem der vier Häuser an. Zwei davon waren wohl Ställe oder Lager, ihr Mauerwerk bestand nur aus Weidengeflecht, doch zwei waren feste Gebäude, mit Lehm verputzt. Alle vier umschlossen sie einen freien Platz, rundum wuchs eine hohe Hecke, die diese kleine Siedlung von der Welt abschnitt.
Ich hatte keine Ahnung, wo wir uns befanden.
Bei beiden Häusern öffnete sich die Türe und Menschen traten heraus.
Im Dämmerlicht sah ich einen Haufen Kinder aus dem einen Haus strömen, lachend und neugierig. Drei Männer und drei Frauen verschiedenen Alters ebenso. In der Türe des anderen Hauses standen zwei Frauen, eine ältere und eine junge, vielleicht so alt wie ich oder einen Sommer älter. Der Mann kletterte vom Karren, ein wenig steif und stöhnend. Ich vergrub mich tiefer in der Decke.
Er redete leise mit der einen Frau. Ich konnte nicht hören, was sie sprachen, aber über den Rand der Decke hinweg sah ich ihr Gesicht hart werden. Die junge, wohl ihre Tochter, reckte neugierig den Kopf.
Von der anderen Seite kamen die Kinder angelaufen. Ein Bursche machte sich sogleich am Geschirr des Ochsen zu schaffen. Er sprach freundlich zu dem Tier, versprach ihm Heu und Wasser. Auch er mochte kaum älter sein als ich, sein Bart hatte gerade erst begonnen zu sprießen. Drei der kleineren Kinder kletterten hinten auf den Wagen. Erschrocken quietschte einer auf, als er mich sah.
»Da ist wer!«, rief er den Erwachsenen zu.
Ich schälte mich aus der Decke, presste immer noch die Leier an mich.
»Eine Frau!«, rief der Jüngste.
»Ein Mädchen!«, antwortete ein Älterer.
Der Mann, der mich mitgenommen hatte, kam zum Karren zurück. Er sah abwechselnd zu allen, die umherstanden.
»Sie wird ein paar Tage bei uns bleiben.«
Er half mir vom Karren und führte mich zu seinem Haus hinüber. Meine Füße stolperten, als wäre ihnen das Gehen neu.
Seine Frau nickte, als ich vor ihr stand. Sie musterte mich ebenso misstrauisch wie ihre Tochter. Ich hatte den Kopf gesenkt, wollte niemanden sehen. Aus dem Augenwinkel bemerkte ich dennoch, dass beide Frauen die gleichen dunklen Haare und die gleichen Augen hatten, wie ein Eschenblatt.
»Kommt«, hörte ich jemanden hinter mir sagen.
»Ich bring nur den Ochsen in den Stall«, sagte eine junge Männerstimme, wahrscheinlich der Bursche.
»Ich stell rasch den Kessel vom Feuer«, rief eine Frauenstimme von weiter weg.
Es dauerte nicht lange, bis alle im Haus des Mannes waren.
Es war ein hübsches Haus, mit einer großen Feuerstelle in der Mitte, über der auf einem Eisenrost ein großer Kessel stand. Es duftete nach einem dicken Fleischeintopf, doch ich verspürte keinen Hunger.
Meine Augen nahmen wahr, dass es zwei Betten gab, hinten unter einer Zwischendecke, auf der volle Säcke und Körbe gelagert waren. Felle lagen rund um die Feuerstelle auf dem Bretterboden, ein Gewichtswebstuhl stand neben der Türe an die Wand gelehnt. In einem Regal waren reich verzierte Schüsseln gestapelt und allerlei Dosen und kleine Körbe. Ich sah diese Dinge und wusste, dass dies keine armen Leute waren, nicht so reich wie ein Reix oder manch hoher Krieger, aber sie lebten gut, besser, als solch ein kleiner Hof vermuten ließ. Drei Hunde waren aufgesprungen, als alle eintraten, legten sich aber auf den Befehl des Mannes gleich wieder nieder. Ich sah und bemerkte dies alles, wie ich es durch jahrelange Übung gewohnt war. Die Aufgabe der Barden ist es nicht nur, Geschichten zu erzählen und Lieder zu singen, sondern mit wachem Auge alles um sich aufzunehmen, um die verborgenen Geschichten darin zu entdecken, hatte Tegid mehr als einmal gesagt. Und doch weigerte sich alles in mir, das, was meine Augen sahen, aufzunehmen. Ich sollte nicht hier sein. Ich sollte nun mit Loïc schon weit weg sein, hinter ihm auf seinem Pferd sitzen, das Packpferd am Zügel, und dem Meer entgegen reiten. Für einen Augenblick meinte ich, seinen Geruch in meiner Nase zu spüren, nach Wind und Pferd und – ihm. Meine Augen suchten ihn, ehe mir bewusst wurde, dass meine Wünsche mir einen Streich spielten.
Der Mann sagte offensichtlich zum wiederholten Male etwas zu mir. Ich hatte nichts gehört. Er drückte mich sanft aber bestimmt auf eines der Felle, reichte mir eine Schale mit Eintopf. Um sie entgegenzunehmen, hätte ich meine Leier ablegen müssen. Ich zögerte, seiner Aufforderung Folge zu leisten und er hielt mir die Schale noch näher hin, drängte sie mir auf.
»Du musst etwas essen«, sagte er.
Ich legte meine Leier auf meine verschränkten Beine, nahm das tönerne Gefäß, das mit einem weißen Muster verziert war.
Alle saßen sie bereits rund um das Feuer, sahen mich mit neugierigen Augen an.
Ich zwang meine Lippen zu einem Lächeln.
»Danke«, sagte ich.
Vom Rest des Abends bekam ich nicht viel mit. Sie redeten aufgeregt durcheinander, der Mann berichtete, was in Vesontio geschehen war, ihre Blicke sprangen immer wieder zu mir, wie ein Hund nach einem Knochen. Das Gesicht der Frau verschloss sich immer mehr, die Tochter rückte weiter weg von mir.