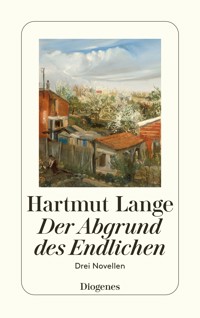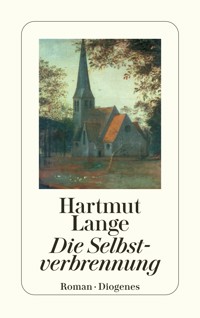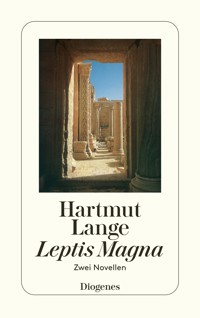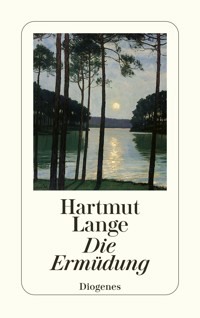7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fünf Novellen, die im Südwesten von Berlin spielen und durch die sich der Teltowkanal mit seinen schwarzen Krähen, versteckten Villen und unwegsamen Waldstücken wie ein roter Faden zieht. Darüber ein Himmel, der durch eine Aschewolke plötzlich verschlossen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 88
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Hartmut Lange
Das Hausin derDorotheenstraße
Novellen
Die Erstausgabe erschien 2013 im Diogenes Verlag
Covermotiv: Illustration von Gustave Caillebotte,
›Homme nu-tête vu de dos à la fenêtre‹, 1875
Foto: Copyright ©Private Collection/
The Bridgeman Art Library
Alle Rechte vorbehalten
Copyright ©2016
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24361 1 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60287 6
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Ich bedanke mich
[7] Inhalt
Die Ewigkeit des Augenblicks[9]
Der Bürgermeister von Teltow[45]
Das Haus in der Dorotheenstraße[71]
Die Cellistin
[9] Die Ewigkeitdes Augenblicks
[11] 1
Auf der Knesebeckbrücke, die Teltow und Zehlendorf miteinander verbindet, überquert man ein schmales Gewässer. Es ist keine dreißig Meter breit, dichtes Laubwerk drängt über die Ufer. Es sind Erlen und junge Weiden, aber vor allem ist es der Japanische Staudenknöterich, der alles überwuchert und der den Spaziergänger daran hindert, mit dem Wasser, auf dem Blätter treiben, in Berührung zu kommen. Der Kanal verläuft im Süden Berlins gute siebenunddreißig Kilometer von der Havel bis zur Spree, und wer ein Lexikon zur Hand nimmt, erfährt, dass er auf Initiative eines Herrn von Stubenrauch um die Jahrhundertwende erbaut wurde. Das ist lange her. Heute wirkt die Gegend verlassen, und wenn man an dem Geländer der Knesebeckbrücke verweilt, dauert es einige Zeit, ehe man ein Motorboot oder einen Schleppkahn zu Gesicht bekommt. Die Wege am Ufer sind holprig. Man muss darauf achten, nicht über Wurzelwerk zu stolpern, und wenn man sich von der Brücke in Richtung Nordosten hundert Meter entfernt hat, öffnet sich [12] gegenüber, auf der anderen Seite des Kanals, eine Art Lichtung mit einem Schild, auf dem man die Zahl vierzehn erkennt, offenbar ein Hinweis für die Schifffahrt. Vögel fliegen darüber hin, genauer: Zunächst tauchen über der Lichtung, die von Pappeln eingegrenzt wird, vier, fünf einzelne, dann eine ganze Schar Krähen auf. Man hört ein energisches, unruhiges Flügelschlagen, hebt den Kopf, versucht, das Auftauchen der Vögel, von dem man überrascht wurde, nicht aus den Augen zu verlieren. Aber nach einigen Sekunden ist alles vorbei. Dann sind sie in entgegengesetzter Richtung, also nach Norden zu, verschwunden, und der Himmel über den Pappeln ist wieder frei.
Zugegeben: Wer interessiert sich schon, und ausgerechnet in dieser Gegend, für ein flüchtiges, ganz und gar belangloses Phänomen, wäre da nicht eine Besonderheit: Jetzt, Mitte August, tauchte der Schwarm Krähen, von dem hier die Rede ist, über den Pappeln der Lichtung immer zur gleichen Zeit, immer Punkt acht Uhr abends, bevor es zu dämmern begann, auf, und es gab durchaus jemanden, nämlich den Taxichauffeur Michael Denninghoff, der mit einem Blick auf die Armbanduhr hätte bezeugen können, dass sich hier ein paar Vögel unter freiem Himmel, was schwer zu erklären war, an eine vorgegebene Zeit hielten.
[13] Nachdem Michael Denninghoff sein Taxi an der Einfahrt zur Knesebeckbrücke geparkt hatte, ging er zum Kanalufer, stieg über das knöchelhohe Wurzelwerk hinweg, um die Lichtung mit dem Schild zu erreichen, und hier setzte er sich auf einen umgestürzten Baumstamm, schlug die Beine übereinander und wartete. Er bereute, dass er zu spät gekommen war. Keine der Krähen wollte sich mehr zeigen.
›Sie sind längst über alle Berge‹, dachte Denninghoff, und nachdem er wieder im Taxi saß, nachdem er in einem mühsamen Wendemanöver, ja warum musste dies ausgerechnet auf der Brücke, die viel zu eng war, geschehen, nachdem er auf dem Teltower Damm nach Zehlendorf zurückfuhr, überließ er sich der Nüchternheit des Allzubekannten.
Anfangs, in der Nähe von Schönow, gab es noch dichten Baumbestand. Dahinter begannen die Vorgärten. Man passierte Einfamilienhäuser hinter mannshohen Drahtzäunen, und hinter dem Postgebäude, oder war es das Altenheim am Heinrich Laehrpark, näherte man sich schon der Mühlenstraße und damit der S-Bahn-Unterführung, und von hier aus, da die Dunkelheit eingesetzt hatte, war man gezwungen, auf den von Scheinwerfern erleuchteten Asphalt zu achten.
Denninghoff war es gewohnt, aus den [14] Augenwinkeln heraus, auch die Bürgersteige nicht außer Acht zu lassen, um, falls ihm jemand zuwinkte, sofort nach rechts auszuscheren und zu halten, aber meist fuhr er weiter über die Clayallee, überquerte irgendwann das Roseneck, wo der Hohenzollerndamm begann, und erst hinter dem Fehrbelliner Platz, es waren immerhin noch ein, zwei Kilometer, bog er nach links ab, um sich in der Pariser Straße in einen Taxistand einzureihen. Von hier aus, ein Blick in den Rückspiegel genügte, um sich dessen zu vergewissern, von hier aus sah man den von Bäumen umstandenen Platz mit der St.Ludwigskirche. Man sah die imposante Fassade mit dem Glockenturm, und weiter nach rechts zu, in der Pfalzburger Straße, die Denninghoff allerdings nicht mehr im Blick hatte, waren es nur wenige Schritte bis zu dem Hauseingang mit der Nummer sieben, an dem sich, wenn man auf den Knopf über dem Namen Dr.Biederstein drückte, eine Tür öffnete. Man hörte das Knacken einer Sprechanlage, wurde von einer Stimme auf den dritten Stock im Vorderhaus verwiesen, in eine Wohnung, die Denninghoff nur allzu gut kannte. Dort hatte er die letzten Jahre mit seiner Frau verbracht, und wie oft hatte er gewünscht, sich in den Räumen, die ihm vertraut waren, nochmals umzusehen. Er hatte sich des Öfteren bemerkbar gemacht, aber die Stimme, die er zu hören bekam, klang [15] gereizt, so dass er es unterlassen hatte, sich dem Fremden gegenüber, der an der Sprechanlage Fragen stellte, zu erklären.
Jetzt ärgerte er sich darüber, dass er es wieder vorgezogen hatte, vor dem Hotel Domus auf Kundschaft zu warten. Ein letzter Blick in den Rückspiegel. Er beschloss, den Taxistand zu wechseln, startete den Motor, fuhr in die Hardenbergstraße, wendete mehrmals, und am Kranzlereck, wo der Verkehr am stärksten war, fühlte er sich besser.
Michael Denninghoff fuhr sein Taxi auf eigene Rechnung. Er benutzte, obwohl er beschlossen hatte, sich ein neueres Modell anzuschaffen, immer noch einen alten Volvo. Wie lange war er schon mit diesem Wagen unterwegs?
›Ein Dreivierteljahr‹, dachte Denninghoff, drückte auf den Zigarettenanzünder, und nachdem er das Fenster einen Spaltbreit geöffnet hatte, sah man, wie er den Rauch ins Freie blies.
Er wirkte nachdenklich, und vielleicht erinnerte er sich an die Zeit, in der er in einem Büro tätig gewesen war, in einem Raum, kaum zwanzig Meter im Quadrat, so dass er, um das Gefühl von Eingesperrtheit loszuwerden, gezwungen war, immer wieder vor die Tür zu treten. Zugegeben, ein Taxi war an Begrenztheit nicht zu übertreffen. Hier gab es überhaupt nur vier Sitzgelegenheiten, und hinter dem [16]
[17] 2
Die Freiheit zum Hierhin und Dorthin? Das ständige Unterwegssein in einer Welt, die nichts weiter als die Gelegenheit bot, Fahrgäste zu transportieren? War dies tatsächlich etwas, das Denninghoff veranlasst haben könnte, seinen Beruf aufzugeben?
Natürlich nicht, und dass es durchaus andere Gründe gab, warum er sich entschlossen hatte, tagein, tagaus durch die Straßen einer Großstadt zu fahren, dies erfuhr man spätestens an einem Winterabend, als ihm jemand vom Bürgersteig aus zuwinkte. Es war ein älterer Herr, der einen tadellosen Anzug trug, das Hemd wirkte frisch gebügelt, und die Stimme, mit der er verlangte, in die Pfalzburger Straße gefahren zu werden, klang gereizt. Sie kam Denninghoff irgendwie bekannt vor.
Und tatsächlich: Als sie den Hauseingang Nummer sieben erreicht hatten und nachdem Denninghoff ausgestiegen war, um dem anderen beim Schließen der hinteren Wagentür behilflich zu sein, als er fragte: »Sie sind Dr.Biederstein?«, antwortete der [18] ältere Herr ungeduldig, so wie Denninghoff es von der Sprechanlage her gewohnt war:
»Das ist doch jetzt unwichtig. Ich habe Sie bezahlt und wünsche eine gute Weiterfahrt.«
Michael Denninghoff sah ihm nach, sah, wie umständlich er mit dem Schlüsselbund, das er aus der Jackentasche gezogen hatte, beschäftigt war. Dann, es war nur ein dumpfes, unangenehmes Klicken, war er hinter der Haustür verschwunden. Als Denninghoff wieder im Auto saß, bemerkte er, dass er die Scheinwerfer ausgeschaltet hatte und dass er mit dem Wagen etwas zu weit von der Bordsteinkante entfernt stand. Aber er ließ alles, wie es war, und er überlegte, ob er sich das Benehmen des anderen gefallen lassen sollte. Aber was hätte er tun können? Hätte er geltend machen sollen, dass er berechtigt war, sich in einer Wohnung, die er vor Monaten gekündigt hatte und in der längst, wie er jetzt sah, ein anderer wohnte, dass er berechtigt war, sich dort, nur weil er gewisse Erinnerungen nicht loswerden konnte, umzusehen? Denninghoff musterte die Hausfassade.
›Die Küche ging auf den Hof hinaus‹, dachte er, ›und sie war zu eng, so dass wir gezwungen waren, einen kleineren Geschirrschrank zu kaufen.‹
Aber das Berliner Zimmer, das wusste er noch, war geräumig. Dort hatte der Kleiderschrank [19] gestanden, der eine halbe Wand einnahm, daneben das Bücherbord und schräg gegenüber hing die Reproduktion eines Gemäldes.
›Der Flur hatte keine Fenster und war immer zu dunkel‹, dachte Denninghoff. Und nun hatte er die Ecke mit der Kommode vor Augen, an deren Kante sich seine Frau, bevor sie zu Boden fiel, festgehalten hatte. ›Zehn Minuten später brachte man sie ins Krankenhaus. Kein Wort des Abschieds. Als mich der Arzt zur Seite nahm, war sie tot‹, dachte Denninghoff, der gegen ein Gefühl von Fassungslosigkeit ankämpfte, ein Gefühl, das ihn immer noch daran hinderte, um Kathrin, wie es angemessen gewesen wäre, zu trauern. Und dann:
›Nie hätte ich einwilligen dürfen‹, dachte Denninghoff, ›dass man sie, obwohl es ihr Wunsch gewesen war, auf hoher See bestattet.‹
Auf hoher See, die man, es war die Gegend um Helgoland, mit einem Motorboot durchkurvt hatte. Ein kurzer Halt, ein paar Worte des Gedenkens, dann wurde, was der Angestellte in der Hand hielt, dem Wasser übergeben, und erst, als Denninghoff das Motorboot verlassen hatte, spürte er, dass es hier oben an der Küste lausig kalt war und dass er vergessen hatte, einen Pullover unterzuziehen. Auch war er versucht gewesen, sein Handy aus der Manteltasche zu ziehen, um Kathrins Nummer anzurufen.
[20]
[21] 3
Kathrin war einen Meter fünfundsiebzig groß, und sie hatte wunderschöne Haare. Sie reichten ihr bis über die Schultern, und wenn sie sie hochsteckte, wirkte sie noch größer, und ihr Gesicht bekam einen Ausdruck von Unnahbarkeit. Aber sie war überaus gesellig, man kam schnell mit ihr ins Gespräch, und wenn sie lachte, sah man, dass ihre Lippen etwas zu schmal waren.