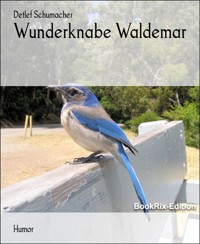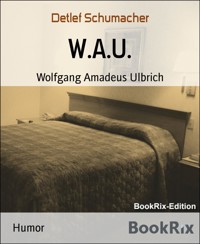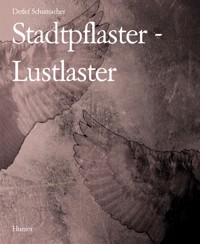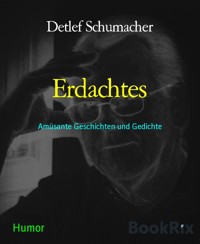0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ernst genommen haben ihn nur Wenige. Viele machten sich über ihn lustig. Auch dieses Buch zeigt sich respektlos. Kein Wort sollte jedoch auf die Goldwaage gelegt werden. Wer die Wahrheit sucht, findet sie dort, wo sie geschrieben steht. Alles andere ist an den Haaren herbeigezogen, also höchst unglaubwürdig.
Dieses Buch erfasst die erste Lebenshälfte des Protagonisten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das schier unglaubliche Leben des Walter Bricht
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenMorgenrot
Die Nacht wich einem neuen Tag. Walter verließ das Bett, kratzte sich kurz am Sack und betrat im Morgenmantel den Balkon. Die Sonne war im Begriff aufzugehen. Er nutzte die Übergangsphase von der Nacht zum Tag, dem Körper die Schlafschlaffheit zu nehmen. Fünf Kniebeugen mit dazugehörigem Pups, sodann gestreckte Haltung am Balkongeländer. Den Blick geradeaus nach Osten gerichtet, dorthin, wo das sowjetische Brudervolk lebt und in wenigen Augenblicken die Sonne zum Vorschein kommen wird.
Der Balkon befand sich ursprünglich auf der entgegengesetzten Seite der Villa. Der Stahlfabrikant, der sie während der letzten Kaiserzeit errichten ließ, guckte gern gen Westen. Während des Ersten Weltkrieges vornehmlich in Richtung Westfront. Solange dort die Waffen nicht schwiegen, stiegen die Gewinne. Was er nicht wissen konnte, dass sich in Richtung des Sonnenuntergangs nach dem Zweiten Weltkrieg der Goldene Westen befinden wird. Den erlebte dann dessen Sohn, der aber nicht des Vaters Villa bewohnte.
Die bekam als neuen Besitzer den Genossen Walter Bricht, den die siegreichen Russen an die Parteispitze der Sowjetzone stellten. Seine Spitzenstellung verdeutlichte auch sein Spitzbart. Der wurde zum Gespött der subversiven Elemente. Sie reimten: Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht des Volkes Wille!
Den entfernte Walter nicht; Hitler trug seine Rotzbremse auch bis ans Lebensende.
„Walter“, drang die Stimme seiner Gemahlin Lilo an sein Ohr, „das Frühstück steht bereit! Vergiss nicht, dich zu waschen und die Zähne zu putzen!““
„Noch ein Minütchen, mein Goldzahn“, sächselte Walter - Lilo hatte einen Goldzahn im Mund – „dann erscheine ich.“
Lilo wusste, dass Walters morgendlicher Balkonaufenthalt nicht nur der körperlichen Stählung, sondern auch der ideologischen Festigung diente. Und richtig, kaum lugte die Morgensonne hinter der siegreichen Sowjetunion hervor – bei Nowosibirsk -, begrüßte sie Walter mit dem Fortschrittslied: „Dem Morgenrot entgegen, ihr Kampfgenossen all …“
Dabei schritt er stramm mit erhobener rechter Faust einige Schritte auf dem Balkon hin und her.
„Halt endlich die Schnauze!“, ertönte es unterhalb des Balkons, „jeden Morgen der gleiche Scheiß!“
Das wütende Bellen eines Hundes unterstützte die barsche Forderung.
Walter zeigte sich erneut empört über die Missachtung proletarischen Liedguts. Wer diese provokante Äußerung von sich gegeben hatte, konnte er bislang nicht feststellen. Der Unbekannte entfernte sich mit dem dekadenten Gesang: „Walter hat die Hosen voll, hört nicht gerne Rock and Roll.“
Seinen Ärger fortzusetzen, versagte ihm der Anblick der höher klimmenden Morgensonne. Ihr Licht versah Walters Spitzbart mit einem roten Schein. Ein Historiker hätte jetzt gejubelt: „Hurra, Kaiser Rotbart ist wieder da!“
Lilo ließ sich wieder hören. Walter sah sich gezwungen, mehr Eile an den neuen Tag zu legen. Bevor er sich vom Blick auf die Morgensonne löste, rief er ihr in perfektem Sächsisch zu: „Welch‘ ein Glück für die fortschrittliche Menschheit, dass du im Osten aufgehst. So wird auch der Sozialismus im Osten Deutschlands emporsteigen.“
Er warf der Sonne eine Kusshand zu. Was die sich dabei dachte, kann man sich denken. Walter war zutiefst davon überzeugt, dass der symbolträchtige Sonnenaufgang bereits Adam und Eva sozialistisch beleuchtet hatte und sie diese fortschrittsweisende Erleuchtung an die Neandertaler weiterreichten.
Bevor er den Balkon verließ, schickte er einen Kampfesgruß an den Genossen Stalin, den unfehlbaren Führer des großen Sowjetvolkes, in die Morgenluft. Nach Beendigung des Frühstücks nahm er Einblick in die Tageszeitung Tägliche Rundschau, die auf der Titelseite die letzte Ruhmestat Walters rühmte. Er hatte am gestrigen Tage die Dienstfahrt des Regierungsautos unterbrochen und einer alten Frau, die am Straßenrand stand, beim Auflesen zweier Äpfel geholfen, die sie aus dem Korb verloren hatte.
„Gott vergelt’s dir“, dankte sie. Walter beeilte sich, die Fahrt fortzusetzen. Er war Atheist.
Schwein gehabt
In jungen Jahren agitierte Walter außerhalb Leipzigs in den umliegenden Dörfern im Sinne Ernst Thälmanns. Von dem hatte er den Auftrag erhalten, jedem dörflichen Lebewesen das Gedankengut der Arbeiterklasse einzupflanzen. So würde der Begriff Arbeiter- und Bauernklasse zum festen Wortschatz auch der Landbevölkerung werden.
Da Walter noch ledig, also ohne Lilo war, konnte er ohne eheliche Bindung durch die Dörfer ziehen. Als geborenen Stadtmenschen erstaunte ihn, dass in diesen keine Straßenbahn fuhr. Gänse, Enten, Hühner und vereinzelt Schweine prägten das Straßenbild. Statt stadtbürgerlicher Worte wie: „Guten Morgen, Herr Kommerzienrat!“ – „Guten Tag, Frau Astrein!“ – „Wie geht es dem Fräulein Tochter?“ – „Wieder gewinnbringend gehandelt?“ und dergleichen ähnliche Fügungen hörte Jungkommunist Walter Bricht Grunzen, Schnattern und Gackern.
Einmal auch Quieken, weil er über ein Ferkel gestolpert war. Das missfiel der in der Nähe befindlichen Mutter, einer fetten Sau. Sie fand es unerhört, dass ein Nichtschwein ihrem Kind wehgetan hatte. Mit bösem Grunzen bewegte sie ihren Zweizentner-Körper auf Walter zu. Der sah ihr Nahen mit bangem Gefühl. Eigentlich war er ein unerschrockener Spartakist, der in Saalschlachten den Nazis empfindlich auf die Schnauze gehauen hatte. Bei diesen Händeln wusste er, wem er die Fresse poliert, da er ihre ideologische Andersartigkeit kannte. Den Schlagabtausch würzte er mit Worten wie „Du fieses faschistisches Schwein!“ oder „Du rückschrittliche Drecksau!“. Hier aber hatte er ein richtiges Schwein vor sich, von dem er nicht wusste, wie er es ansprechen soll. Genosse Thälmann hatte sich diesbezüglich nicht geäußert.
Kurz entschlossen bediente sich Walter des geläufigen Kampfrufs „Rot Front!“ und hielt der Sau die rechte Faust entgegen. Dass das bärtige Nichtschwein eine Faust in die Luft hielt, empfand die Sau als Bedrohung. Er will mein Ferkel erschlagen, mutmaßte sie. Hätte Walter die Fähigkeit besessen, sich dem Schwein in dessen Sprache verständlich zu machen, hätte er das getan. So aber ließ er die Faust sinken und kehrte sich von Mutter und Kind ab.
Seine nächsten Schritte lenkte er zu einem Gebäude, über dessen Eingangstür in großen Buchstaben stand: Gasthaus zumKronprinz. Aha, dachte er, der wohnt hier und empfängt hier seine Gäste. Mit diesem spätfeudalen Überbleibsel würde ich gern ins Gespräch kommen, um ihm bewusst zu machen, dass er in der kommenden Geschichtsperiode nichts mehr zu suchen hat, Entschlossen betrat Walter das Gebäude. Wie staunte er, dass nicht der Kronprinz, sondern Personen bäuerlichen Aussehens an einem runden Tisch saßen. Die starrten ihn mit glasigen Augen an. Für Walter ein untrügliches Zeichen dafür, dass sie die Unterdrückung bedrückte. Er setzte sich zu ihnen und sagte, dass sie bald frei von Ausbeutung, Knechtschaft, Frondienst und Kirchenzehnt seien. Dem Kronprinzen, der hier wohne, sollten sie in den Arsch treten. Dessen Zeit sei abgelaufen.
Die Bauern vermuteten, dass der Fremde noch betrunkener sei als sie. Ihr Unverständnis wuchs, als er fragte, in welchem Zimmer dieses Gebäudes sich der Kronprinz aufhalte. Sie schickten ihn zum Plumpsklo, das sich außerhalb des Hauses befand. In ihm sah Walter einen Mann sitzen, der seine Notdurft verrichtete. Walter fragte ihn, ob er der Kronprinz sei. Der schaute ihn blöde an und lallte, dass er in Ruhe scheißen wolle. Wenn er damit fertig sei, könne der Kronprinz hier Platz nehmen. Angeekelt wandte sich Walter ab. Er sei nicht der Kronprinz, schniefte er und verließ die stinkende Bretterbude.
Pflaumenkuchen contra Speckkuchen
Schon als Kind aß Walter gern Pflaumenkuchen. Den lieber als anderen Kuchen. Genauer gesagt, er verabscheute andere Kuchensorten. Schuld daran waren seine Großeltern, die einen mittelgroßen Garten hinter ihrem Wohnhaus besaßen, in dem Mohrrüben, Radieschen, Kohlrabi, Kartoffeln und andere Früchte gediehen. Auch drei Pflaumenbäume standen in ihm. Wenn diese voll reifer Pflaumen hingen, half Klein-Walter dem Großvater, sie zu pflücken. Großmutter buk dann köstlich schmeckenden Pflaumenkuchen. Während der Schulferien war Walter ständiger Gast der Großeltern, die für ihren Enkel alles taten, was ihn zufrieden machte.
Bei diesen Besuchen kam er nicht nur mit Pflaumen in Berührung, sondern auch mit den staatsfeindlichen Äußerungen des Großvaters, der die Minister, die höheren und niederen Beamten Pflaumen nannte. Die größte Pflaume sei der Kaiser, wagte Opa zu sagen. Oma zürnte, er bringe die Familie um Kopf und Kragen. Am schlimmsten sei aber, dass er die sittliche Reinheit des Enkelkindes verseuche. Ob Opas gefährliche Äußerungen seiner politischen Einstellung entsprachen, konnte Walter nicht feststellen. Dazu war er noch zu jung. In seiner kindlichen Vorstellung sah er den Kaiser als große Pflaume mit gezwirbeltem Bart und goldener Krone auf dem Thron sitzen, umgeben von kleinen Pflaumen, die ihn bedienten.
Als Walter den Kinderschuhen entwachsen war, bekamen die Pflaumen menschliche Gestalt. Sie waren böse Wesen, die den einfachen Menschen, also auch Großvater und Großmutter, Schaden zufügen. Dass Walter das so sah, war ebenfalls Opas Schuld. Wenn der mit solchen gotteslästerlichen und kaiserfeindlichen Sprüchen auf Walter einredete, nahm Oma den Kochlöffel zur Hand und drohte ihm, seinen Kopf mit Beulen zu verzieren.
Opa blieb standhaft und fürchtete sich nicht. Das bewunderte Walter an ihm. So bildete sich bei ihm schon früh eine kämpferische Haltung, die ihn ermutigte, mit Gleichaltrigen Schlägereien anzuzetteln und auszuführen. Anfänglich noch ohne Sinn und Verstand, bestimmt nur von jugendlicher Rauflust.
Als eine solche Rauferei eines Tages derart heftig ausartete, dass die Polizei eingreifen musste, wurde Walter von ihr in Gewahrsam genommen. Er musste mehrere Tage im Polizeigefängnis zubringen. Die Zelle teilte mit ihm ein älterer Mann, der unentwegt finster dreinschaute und die Zähne fletschte, als wolle er die Gitterstäbe durchbeißen. Walter fragte ihn, ob es ihm nicht behage, hier kostenfrei Kost und Logis zu genießen. Ihm behage der ganze Scheiß-Staat nicht, knurrte er. Weil Walter mehr über dessen Unzufriedenheit erfahren wollte, teilte der ihm sein inneres Aufbegehren mit. So erfuhr der junge Bricht, welche klassenbewussten Aktivitäten außerhalb der Gefängnismauern vor sich gehen. Er vernahm Begriffe, die alle mit K begannen wie Klassenkampf, Kommunisten, Kaisermord, Krawallnacht, Kehlendurchschnitt, Kapitalismus, Kriegsdienstverweigerer, Knast, Kackärsche u.a.
Der grimmige Zellengenosse offenbarte sich als Parteigenosse und deutete Walter den Inhalt der geäußerten K-Begriffe. In Walters Verstand formte sich der Wille, ebenso wie der Zellengenosse gegen das vorzugehen, was aus dem Weg geräumt werden musste. Damit dieses Vorgehen gezielt geschehe, gebe es eine Partei, die die Kräfte balle, sie zur Faust mache und den Gegner niederstrecken helfe, sagte der Erzürnte und fügte hinzu, dass Teddy diese Partei führe.
Walter verstand nicht, dass ein Teddy die Veränderung der gesellschaftlichen Zustände dirigieren kann. Der Mitgefangene verzog zum ersten Mal seine Gesichtszüge in ein Lächeln. Teddy sei der Kosename Ernst Thälmanns, des Führers der Kommunisten, erklärte er.
Als Walter die Zelle nach zwei Wochen verlassen durfte, schied er vom anderen mit festem Händedruck und dem Versprechen, Teddy und der Partei, die er um Aufnahme bitten werde, keine Schande zu machen. Den Zurückbleibenden freute das. Die ihm aufgebrummten zwei Knastjahre werde er nun tapferer ertragen. Wenn er wieder draußen sei, solle ihn Walter mal besuchen. Er gab ihm die genaue Anschrift. Das tat Walter dann auch. In ihm fand er seinen ersten erfahrenen Mitstreiter, der wenig später in der jungen Sowjetunion Asyl fand, weil er in Deutschland zu einem Staatsfeind erklärt worden war.
Die sowjetischen Genossen empfingen ihn herzlich. Weil Genosse Stalin zu der Zeit die Säuberung des Sowjetlandes von klassenfeindlichen Elementen vornehmen ließ und er dabei gegenüber Ausländern besonderen Argwohn hegte, ließ er auch Walters Mitstreiter von der Bildfläche verschwinden. Auf ein oder mehr Opfer kam es Genossen Stalin dabei nicht an. Menschenmaterial war ausreichend vorhanden.
Als Walter von der Tötung seines liebsten Genossen erfuhr, war er dem Genossen Stalin gram. Jedoch nur so lange, bis er eine Einladung aus Moskau nach Moskau erhielt. Er sollte an einem Parteitag der KPdSU teilnehmen und die von ihm gewonnen Erfahrungen den deutschen Kommunisten mitteilen.
Walter war stolz wie Bolle, an der Seite Teddy Thälmanns die Fahrt nach Moskau anzutreten.
Dort hörte er in perfektem Russisch, wie auch in Deutschland die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert werden könnten. Verstanden hatten weder er noch Teddy etwas, denn der Dolmetscher lag mit Grippe im Bett. Dennoch beteiligten sie sich am stürmischen Beifall, der sie spüren ließ, dass etwas Wichtiges gesagt worden war.
Den Abschluss der Parteitagstage bildete ein Festbankett, an dem neben führenden sowjetischen Genossen mit Stalin an der Spitze – Lenin lag einbalsamiert in einem besonderen Gebäude der sowjetischen Hauptstadt – auch Teddy und Walter teilnahmen. Zahlreiche Toasts wurden ausgebracht, die den beiden deutschen Delegierten die Gewissheit gaben, dass auch in Deutschland irgendwann Genossen getoastet werden.
Nach dem kollektiven Saufen – der Wodka floss in Strömen – wurde das Essen gereicht. Die sowjetische Nationalspeise Speck und Zwiebel begehrte Walter nicht. Er verlangte nach echtem deutschen Pflaumenkuchen, so wie ihn Großmutter gebacken hatte.
Die in der deutschen Sprache nicht sehr bewanderten Bolschewiki verstanden Daumensuchen. Weil sie es Walter recht machen wollten, schnitten sie einigen gefangenen Menschewiki die Daumen ab und verarbeiteten die zu Wurstsalat. Walter sträubte sich, diesen Wurstsalat zu essen. Nicht, weil er nicht wusste, dass der aus Menschewiki-Daumen bestand, sondern weil er sich auf Pflaumenkuchen versteift hatte.
Der Kreml-Chefkoch zeigte sich ratlos. Solchen Kuchen hatte er noch nie gebacken. Er empfahl, Pflaumenkuchen aus Deutschland einfliegen zu lassen. Die junge sowjetische Luftflotte, die aus zwei Flugmaschinen bestand und waghalsige ZK-Genossen in ihre Urlaubsorte flog, war für einen Langstreckenflug nach Deutschland und zurück noch nicht getestet worden. Ersatzweise reichte man Walter russischen Speckkuchen, den auch der Genosse Lenin mit Vorliebe gegessen hatte. Ob er daran gestorben sei, wollte Walter wissen. Stalin lächelte verschmitzt und sagte, dass in der Sowjetunion anders gestorben werde, ohne Einnahme von Speckkuchen. Walter wusste zu der Zeit nicht, dass Stalin bereits einige Zehntausend Russen auf dem Gewissen hatte. Wenn man bei ihm von Gewissen sprechen konnte.
Den Speckkuchen verzehrte Walter, nachdem ihm Teddy den entsprechenden Parteiauftrag erteilt hatte. Die Gastfreundschaft der sowjetischen Klassenbrüder dürfe nicht missachtet werden, fügte er hinzu.
Von Hochrufen begleitet fuhren sie anderntags vom Moskauer Hauptbahnhof zurück nach Deutschland. Hier hatte Walter nichts Eiligeres zu tun, als seine Großeltern aufzusuchen. Seiner Bitte, ihm schnellstens einen Pflaumenkuchen zu backen, kam Großmutter gern nach. Als der gebacken auf dem Tisch stand, hätte Walter sich an ihm beinahe überfressen. Der widerliche Geschmack des sowjetischen Speckkuchens war jedenfalls beseitigt.
Eklat beim Hausarzt
Die anstrengende Agitationstätigkeit, die nicht selten zwölf Stunden beanspruchte, ließ Walters Kräfte schwinden. Diese Schwäche wurde ihm sichtbar, als er beim Wasserlassen das Glied nicht mehr strecken konnte und es schlaff herabhing. Eine nasse Hose war die Folge.
Als er den Hausarzt von dieser Peinlichkeit in Kenntnis setzte, erklärte der, dass dem Penis auch eine andere Bestimmung zukomme, als nur Abflussrohr der Blase zu sein. Walter tat erstaunt. Den Arzt wunderte, dass Walter nicht begriff, was er denken sollte.
Um dessen Paarungssinn wachzukitzeln, bat er die im Behandlungsraum befindliche Schwester Martha, sich bis auf Büstenhalter und Schlüpfer zu entkleiden. Sie glaubte nicht recht gehört zu haben. Das sagte sie auch. Der Arzt wiederholte seine Bitte mit dem Zusatz, dass Walter Brichts Penisschwäche auf natürliche Weise behoben werden könnte.
Die Schwester, eine sehr verlässliche und pflichtgetreue Arzthelferin, die in ihrer 25jährigen Tätigkeit nur 25 Tage krank gewesen war, meinte, dass sie sich schäme, sich zu entblößen. Sie sei nicht mehr ganz jung. Nur sie und der Arzt wussten, dass sie in wenigen Wochen das Rentenalter erreicht haben wird.
Sie sei aber von stattlicher Figur, betonte der Arzt, und das zähle. Auch Walter wurde gebeten, sich zu entkleiden, und zwar völlig. Das wollte Walter nicht. Es reiche doch, wenn sich die veraltete Schwester Martha der Kleidung entledige.
Martha empörte sich, dass sie nicht veraltet sei. Ihr Körper sei noch von straffer Haut. Sie könne sich mit mancher 20jährigen messen. Den Arzt freute Marthas stolzer Sinn, der sie bewegen werde, sich im Eva-Kostüm zu zeigen. Darin sollte er sich jedoch getäuscht haben, denn Martha hatte sich noch nie vor einem Mann in Blöße gezeigt. Erfolgreich hatte sie ihre Jungfernschaft bewahrt und erotische Annäherungsversuche begieriger Männer abgewiesen. Das sagte sie natürlich nicht, um zu vermeiden, dass man sie nach dem Grund ihrer Keuschheit fragen würde.
Weil der Arzt merkte, dass er auf gedachte Weise nichts erreichen wird, öffnete er kurzerhand die Tür zum Warteraum und fragte, wer die Nächste sei. Eine betagte Seniorin krächzte: „Ich!“
‚Bloß die nicht‘, entschied er für sich und wiederholte die Frage etwas verändert, wer die Zweitnächste sei. Ein Mann älteren Alters mit Leidensmiene hob kraftlos die rechte Hand.
‚Der ist auch nicht nützlich‘, dachte der Arzt enttäuscht. Er wies den Mann darauf hin, dass seine Frage auf eine weibliche Patientin gerichtet war. Der Mann erklärte, dass er nicht weiblich sei.
„Eben, eben“, meinte der Arzt, „mein Interesse gilt aber einer weiblichen Person. Möglichst einer“, er ließ den Blick über die Wartenden schweifen, „die erst in fünfzig Jahren das Rentenalter erreicht haben wird.“
Sein Blick verhielt auf einer jungen Frau, die dieser Zeitspanne in etwa entsprach. Sie war recht hübsch und hätte ihm wohl gefallen, wäre er nicht verheiratet. Als Nackte ist sie bestimmt eine Augenweide, schwärmte er innerlich.
Er bat sie, das Behandlungszimmer zu betreten. Ein Sturm der Entrüstung brach los. Jeder im Warteraum empfand es ungerecht, dass dieses junge Ding den Vorrang haben sollte, wo doch jeder vor ihr erschienen war.
Nun geschah etwas, was die Erbosten schlagartig zum Verstummen brachte. Das junge Ding stellte sich neben den Arzt, hob den rechten Arm und rief: „Damit es jeder weiß – ich bin Mitglied des BDM! (Bund Deutscher Mädchen – d. Verf.) Wer mich hindert, stellt sich gegen den Führer! (Adolf Hitler – d. Verf.)“
Sie ließ die Hand sinken und verschwand mit dem Arzt im Behandlungszimmer. Die Zurückgebliebenen guckten eingeschüchtert zu Boden. Jeder wollte zeigen, dass er sich nicht gegen den Führer stelle. Die Seniorin, die anfänglich als Nächste den Behandlungsraum betreten wollte, krächzte: „Heil Führer!“
Im Behandlungszimmer behielt die fesche Faschistin ihre stramme Haltung bei und erklärte dem Arzt, dass sie glaube, von einem Hitlerjungen geschwängert zu sein. Sie wolle erfahren, zu welchem Zeitpunkt sie dem Führer Nachwuchs schenke. Lieb wäre ihr auch, wenn sie erführe, ob ihre Leibesfrucht männlich oder weiblich sei. Männlich wäre ihr natürlich lieber, damit des Führers Heerschar zunehme.
Damit hatte die junge Frau ihr Verlangen vorgetragen. Nun kam der Arzt zu Wort. Er musste seine Enttäuschung verbergen, denn geglaubt hatte er, die Maid mit den blonden Zöpfen und den arisch blauen Augen werde über Halsschmerzen oder Hustenreiz klagen. Seine Fragestellung begann deshalb so: „Wie alt sind Sie, Volksgenossin?“
„Sage Du zu mir, Kamerad.“
„OK!“, der Arzt.
„Unterlasse bitte die Anwendung undeutschen Wortguts“, verlangte sie, „Okay ist ein Begriff des Weltjudentums.“
Dem Arzt schwante, dass er diese Jung-Germanin nicht bewegen könne, sich zu entkleiden. Nicht völlig. Vielleicht ein bisschen.
„Würdest du bitte deinen Oberkörper freimachen, so vom Hals bis zum Bauchnabel“, bat er sie.
„Warum?“
„Damit ich sehen kann, wie weit deine Schwangerschaft gediehen ist.“
„Na klar, mache ich.“
Sie begann, ihren Oberkörper zu entblößen. Dass ihr außer dem Arzt auch ein anderer Mann dabei zusah, schien sie nicht zu stören. Walter wollte aus Anstandsgründen den Raum verlassen. Der Arzt hielt ihn zurück und flüsterte ihm die Frage ins Ohr, ob sich bei ihm etwas rege.
„Ja, die Vernunft“, flüsterte Walter zurück.
„Mehr nicht?“
„Was noch?“
Der Mediziner verdrehte die Augen. Er gab aber nicht auf. Die Jugendliche stand nun mit nacktem Oberkörper. Ihre wunderbar geformte Brust fiel dem Arzt zuerst auf. Seine Blicke bohrten sich förmlich in das junge rosige Fleisch. Schwester Martha betastete verschämt ihren Brustbereich.
Walter Bricht konnte nicht fassen, was er sah. Noch nie hatte er eine nackte Frauenbrust erblickt, nicht einmal die seiner Mutter. Als er aus der saugte, war er noch zu jung, um männliche Regungen zu spüren. Seine spätere Pubertät nutzten die Eltern, ihn moralisch auszurichten. Hierzu gehörte, eine weibliche Person nie nackt zu betrachten. Tue er das dennoch, werde er hässliche Glubschaugen kriegen.
„Habe ich Glubschaugen?“ fragte flüsternd den Arzt.
Der erfreut, dass Walter Anzeichen von Empfindung zeigte, bejahte. Walter erschrak.
Das BDM-Mädchen bat den Arzt, die Wölbung ihres Bauchs zu begutachten. Der konnte an ihm keine Veränderung feststellen. Er sei ranker als ihre prallen Brüste.
Das enttäuschte sie. Wann der Hitlerjunge in sie gedrungen sei, wollte der Arzt wissen; von daher lasse sich ermitteln, wann sie Mutter werde. Das wisse sie nicht genau. Es wären mehrere gewesen. Ob die Stelle, an der die Hitlerjungen in das Innere ihres Unterleibs vorgedrungen seien, Anzeichen von Verletzungen aufweise, fragte der Arzt.
„Das weiß ich nicht“, antwortete sie. „Soll ich sie zeigen?“
„Bitte ja“, entkam es erfreut seinem Mund. Nun würde sie doch ihre gänzliche Blöße zeigen.
Schwester Martha bedeutete ihm, dass Walter noch im Raum sei.
„Soll er ja.“ Vorsichtshalber fragte er die junge Frau, die ihre Entkleidung fortsetzte, ob es sie störe, dass der hier anwesende junge Mann zusehe.
„Weshalb soll er mich stören? Die Hitlerjungen haben mich auch nackt gesehen. – Bist du Hitlerjunge?“, fragte sie Walter.
Der in klassenbewusster Sofortreaktion: „Ich bin Kommunist!“
Sie hielt in ihrer Entblößung inne, sah Walter mit finsterem Blick an und zischte: „Du Kommunistenschwein wagst es, einer reinrassigen Volksdeutschen bei der Freilegung ihres arischen Körpers zuzugucken? Wende dich ab, du Bolschewik!“
Als Mitstreiter Ernst Thälmanns hatte Walter schon manche Schmähung durch das braune Gesindel erfahren, doch diese hier empfand er als besonders entwürdigend. Was erfrechte sich die Hitlerhure, ihn zu beleidigen.
„Du Nazi-Schlampe“, entkam es ihm mit Wucht, „stellst schamlos deinen Körper zur Schau, an dem sich zahllose braune Jungs vergangen haben. Pfui und nochmals Pfui!“
Er spie vor ihr aus. Sie kreischte: „Dein Spucken bringt dich ins KZ! - Herr Doktor“, befahl sie dem Arzt, „rufe sofort die Kreisstelle der Gestapo an, damit sie diesem Untermenschen Manieren beibringt.“
Hastig kleidete sie sich wieder an. Der Arzt tat, wie ihm befohlen. Schwester Martha raunte Walter zu, rasch zu verschwinden. Sie wisse, wie die Gestapo Manieren beibringt. Die Wunden ihres Cousins zeugen davon. Walter befolgte ihren Rat. Auch ohne diesen hätte er spornstreichs das Weite gesucht, weil er aus Erfahrung wusste, wie grob die Nazis mit Kommunisten umgehen. Der Arzt, der die Flucht des penisschwachen Walter Bricht nicht hatte verhindern können, war nun den gröbsten Anschuldigungen des BDM-Mädchens ausgesetzt.
Er holte das gerahmte Hitler-Bild aus der untersten Schublade seines Schreibtischs, hängte es an den Nagel, an dem es vorher hing, legte den Zeigefinger auf den Mund und sagte: „Pst, Führer hört mit!“
Kampfauftrag
Walter entschied, diesen Arzt nie wieder aufzusuchen. Aus zweierlei Gründen nicht. Zum einen stand der nun bestimmt unter ständiger Beobachtung der Gestapo, zum anderen blieb es Walter ein Rätsel, weshalb er sich vor den Augen einer nackten Nazischlampe entkleiden sollte. Er hatte den Arzt aufgesucht, um durch ihn die Straffung des Geschlechtsteils zu erhalten. Medikamentös natürlich und nicht durch perverse Zurschaustellung eines nackten Körpers.
War der Arzt vielleicht ein Zuhälter der Nazis?
Diese Frage stellte er dem leitenden Genossen der geheim agierenden Gruppe des kommunistischen Widerstands. Genosse Sack war nicht nur ein kampferprobter Kommunist, dessen narbenreicher Körper von seinem entschlossenen Tun zeugte, sondern auch ein väterlicher Freund, der vor allem Jungkommunisten mit gutem Rat zur Seite stand. Jüngst versuchte er einem Parteifrischling die geschwollenen Augen zu öffnen, als der wimmerte, er könne nicht mehr den steilen Aufstieg zum Kommunismus erkennen. Er fürchte abzustürzen und der nationalsozialistischen Idee zu erliegen.
Weil der Jammernde partout nicht den wahren Pfad des gesellschaftlichen Fortschritts sehen wollte, schloss Genosse Sack mit einem wohlgemeinten Faustschlag seinen Mund, damit er nicht versehentlich verrate, wo sich der Treffpunkt der Widerstandsgruppe befindet.
Mit Walter Bricht verfuhr er anders. Er ließ sich von ihm zunächst den Ablauf des Geschehens beim Arzt schildern, dabei die Frage in den Vordergrund stellend, weshalb Walter ihn aufgesucht habe. Als Walter sie offen und fern aller schamhaften Scheu beantwortet hatte, ging Genosse Sack nachsinnend in sich. In diesen geistigen Bewegungsprozess flocht er die bildhafte Vorstellung einer nackten Jungfrau ein, die aufgrund faschistischer Zugriffe keine mehr war. Walters Schilderung ihres prallen Busens belebte Sacks Sack und er fühlte, wie sich sein Hosenstall dehnte.
„Heureka!“, rief er plötzlich und erschreckte Walter, der diesen Ausruf nicht deuten konnte. Vielleicht hatte Genosse Sack den Namen einer Genossin genannt.
„Genosse Bricht“, setzte Sack fort, „hatte die nackte Nazistin eine innere Regung bei dir hervorgerufen?“
„Sie war nicht nackt. Sie war im Begriff, sich nackt zu machen“, erklärte Walter.
„Gur, gut! Aber stelltest du dir vor, wie sie nackt aussehen würde?“
„Nein!“, kam die prompte Antwort, „eine Nazischlampe wollte ich mir nicht nackt vorstellen.“
„In ihrer Nacktheit unterscheidet sich eine Nazi-Schlampe nicht von einer Kommunistenschlampe …“ - Sack korrigierte sich schnell: „Eine Nazischlampe hat nacktkörperliche Ähnlichkeit mit einer Person wie du und ich – äh – ich meine wie …“
Er suchte nach einer passenden Vergleichsperson. Das Bild der Nazihure hatte seine Sinne verwirrt. Keine der wenigen Genossinnen der Widerstandsgruppe würde eine so erotisierende Wirkung ausstrahlen wie die Prallbusige. Deshalb nicht, weil die drei Widerständlerinnen das erotisierende Alter längst überschritten hatten. Sie würden sich auch nie nackt zeigen, weil sie ihren Klassenauftrag darin sahen, Nachts Plakate an die Hauswände zu kleben, die die Nazis dann am Tage wieder abrissen.
Walter half dem Genossen Sack bei der Findung einer Vergleichsfrau und sagte: „Heureka.“
„Du auch?“, fragte der erstaunt. „Lass hören.“
Walter wusste nicht, was er hören lassen sollte. Um aber nicht nutzlos den Mund geöffnet zu haben, sagte er: „Wir müssen nicht nur dem Vormarsch des Faschismus Einhalt gebieten, sondern auch der Unzucht den Weg verbauen. Kein Kommunist darf sich frivoler Taten und Gedanken schuldig machen.“
Genosse Sack schluckte verlegen. Sollte Walter Bricht Gedanken lesen können? Könnte er das, wäre er der KPD auch anderweitig von Nutzen.
„Genosse Bricht“, sagte er deshalb mit fester Stimme, „dein Erkennen der Gefahren, die den Klassengenossen auch von moralisch bedenklicher Seite her drohen, sind für unseren Klassenkampf ungemein wichtig. Ich werde deshalb der obersten Parteileitung, die in Paris im Exil wirkt, vorschlagen, dich als Gedankenleser einzusetzen. Bist du mit diesem Kampfauftrag einverstanden?“
„Jawoll!“, schnarrte Walter überwältigt, einen so wichtigen Auftrag erfüllen zu dürfen.
Polizeikontrolle
Paris war noch nicht in deutscher Hand. Der 2. Weltkrieg hatte noch nicht begonnen. Die Pariser lebten noch fröhlich in den Tag hinein. Sie liebten – sich und die Frauen.
Auch die Deutschen liebten – vor allem ihren Führer Adolf Hitler, der jüngst an die Macht gekommen war. Sie vergötterten ihn, weil er den Arbeitslosen Arbeit gab, den Hungernden Brot und den politisch Desorientierten die nationalsozialistische Anschauung. Ständig beteuerte er die Erhaltung des Friedens. Er war klug genug, nicht jetzt schon zu erklären, dass es ihn nach Krieg gelüste.
Es gefiel den Massen, endlich einen echten Volkskanzler zu haben. Der verkündete den Beginn des 1000jährigen Reiches. Einige Misstrauische errechneten schnell, wann die 1000 Jahre verstrichen sein werden und stellten die Frage, was dann käme. Der promovierte Propagandaminister Joseph Goebbels, der einzige Schlaukopf unter der Nazi-Prominenz, ließ wissen, dass dann die nächsten 1000 Jahre folgen werden. Das leuchtete auch den dümmsten Dummköpfen ein.
Der Kommunist Walter Bricht wurde von den Nationalsozialisten steckbrieflich gesucht. Nicht, weil er eine Bank ausgeraubt oder einer alten Frau die Handtasche gestohlen hatte, sondern weil er die körperlich Verletzung eines deutschen Polizisten zu verantworten hatte. Vor seinen illegalen Genossen verteidigte Walter diese Tat folgendermaßen: Der Gendarm habe seine Strümpfe sehen wollen, ob sie gestopft oder löchrig sind. Es sei eines Volksgenossen unwürdig, in einer Zeit beginnenden Wohlstands Kartoffeln in den Strümpfen zu haben; die gehörten auf den Tisch, hätte der Polyp begründend gesagt.
Weil Walters Strümpfe tatsächlich Kartoffeln (umgangssprl. für Löcher) aufwiesen, er sie aber aus Schamgefühl nicht zeigen wollte, habe er die Bloßlegung seiner Füße verweigert. Das hätte dem nationalsozialistisch gesinnten Polizisten missfallen und er hätte seine Forderung mit gezückter Pistole wiederholt. Walter habe ihm zu verstehen gegeben, dass er viel zu Fuß unterwegs sei. Er hielt ihm die Schuhsohlen entgegen und der Ordnungshüter sah, dass sie löchrig waren. Walter wollte nicht sagen, dass sein kommunistisches Wirken auch viel Lauferei verlange.
Der Uniformierte zeigte sich uneinsichtig. Er nahm, um einen triftigeren Grund zu finden, Anstoß an Walters spitzem Bart, der sein Gesicht seit einigen Jahren zierte. Wer sein Gesicht mit einem solchen Bart verunstalte, sei ein Umstürzler, behauptete der Schupo. Walter konnte manches ertragen, nicht aber, dass sein Bart, den er liebevoll pflegte und mit der Schere bearbeitete, einem Verbrechergesicht zugeordnet wurde. In seiner verständlichen Empörung habe er des Führers unternasigen Kurzhaarschnitt mit dem eines Mannes verglichen, der unfähig sei, sich auch einen Kinnbart wachsen zu lassen.
Das war dem Polizisten zu viel. Er entsicherte die Pistole und war gewillt, Walter zu töten.
Walter, der in jungen Jahren einem Turn- und Sportverein angehöret hatte, machte einen Salto rückwärts und traf mit seinen Schuhabsätzen das Kinn des Uniformierten, der darauf zu Boden ging. Recht unglücklich war er dabei mit dem Hinterkopf auf die Bordsteinkante geknallt, was ihn ohnmächtig werden ließ.
Ein Landschafts- und Porträtmaler, der diesen Vorgang beobachtet hatte, weil er in der Nähe malte, bat Walter, einen Augenblick still zu halten, damit er dessen Kopf mit wenigen Strichen aufs Papier bringen könne. Walter ließ den Mann gewähren. Dann erst ergriff er die Flucht.
Ein SA-Schlägertrupp, der am Tatort vorüberschritt, sah den ohnmächtigen Polizisten liegen und den Porträtmaler mit Papier und Bleistift hantieren. Sofort keimte in ihnen der Verdacht, er habe den Gendarm auf dem Gewissen. Ohne ihn nach dem Grund zu fragen, zückten sie ihre Schlagstöcke und prügelten ihn erbarmungslos zu Boden. So lag er dann blutüberströmt neben dem ohnmächtigen Polizisten. Der SA-Trupp zog zufrieden weiter.
Der Gendarm, der bald darauf aus seiner Ohnmacht erwachte, sah neben sich den im Blute Liegenden. Auch den Zeichenblock nahm er wahr. Ein schneller Blick auf diesen und er erkannte in der Zeichnung, die mit Blutspritzern bekleckst war, denjenigen, der sich ihm widersetzt hatte.
Er löste das an den Block geheftete Blatt und begab sich, noch leicht benommen, zu seiner Dienststelle. Dort verlangte er, die Porträtzeichnung als Steckbrief zu veröffentlichen.
Der Dienststellenchef fragte, welcher der beiden Porträtierten gesucht werden solle. Der Maler hatte nämlich zwei Köpfe festgehalten: auf der einen Seite Walter und auf der Rückseite den Führer.
Die Entscheidung fiel leicht.
Noch bevor Walters Konterfei alle Polizeistationen und Anschlagsäulen Deutschlands zierte, war er nach Paris entschwunden.
Ankunft in Paris
Walter war die Anschrift der Exil-Parteileitung zwar bekannt, doch wusste er nicht, wie er sie in der großen Stadt finden soll. Als er den Hauptbahnhof verlassen hatte, fragte er einen Passanten danach. Der guckte ihn groß an und sagte dann etwas Undeutsches. Aha, dachte Walter, ein Franzose. Er war zu sehr daran gewöhnt, mit jedem Deutschen Deutsch zu sprechen. Manche der Deutschen belächelten seinen Leipziger Dialekt, vor allem die Berliner und die Bayern, doch ertrug er diese Herabwürdigung mit der Geduld eines unbeugsamen Berufsrevolutionärs, der er nun mal war.
Zweimal hatte er an einem Anti-Dialektkurs teilgenommen, in der festen Absicht, seinen singenden Akzent loszuwerden und das Hannoveraner Spitzendeutsch zu erlangen. Zweimal musste er ergebnislos abbrechen, weil er der Empfehlung nicht folgen wollte, die austria-germanische Bariton-Phonetik des Führers Adolf Hitler zu seinem sprachlichen Vorbild zu machen.
Der vor dem Hauptbahnhof angesprochene Franzose wollte den Deutschen nicht ratlos stehen lassen. Pariser sind liebenswert und hilfsbereit. Er bat eine junge Frau herzu, die recht neugierig in der Nähe stand. Auf gut Glück vermutete er in ihr eine Deutsche, da sie blond war. Die Abfälligkeit blond und doof war damals noch nicht geläufig. In Deutschland wäre diese Verleumdung mit langem Zuchthaussaufenthalt bestraft worden.
Die Nähergebetene verstand die Bitte des Franzosen, obwohl sie nicht Französin, sondern Polin war. Das erfuhr Walter etwas später. Die Frage des freundlichen Parisers nahm sie mit Skepsis auf.
Distanziert schaute sie Walter von oben bis unten an und verhielt ihren Blick dann auf seinem Spitzbart.
„Bist du Walter Bricht?“, fragte sie plötzlich geradeheraus in gebrochenem Deutsch, ohne sich furchtsam umzusehen. Wen sollte sie auch fürchten, die deutsche Wehrmacht, die Gestapo, die SS und andere Faschisten hatten in Paris noch nicht Fuß gefasst.
Verdattert gestand Walter, dass er es sei.
„Komm!“, sagte sie, dankte dem freundlichen Pariser und dirigierte Walter durch das Menschengetümmel in Richtung eines Pariser Vororts. Auf dem Weg dorthin stellte sie ihm verschiedene Fragen. Unter anderem die, woher er komme.
„Aus Klein-Paris“, antwortete er. Sie sollte merken, dass er ein Faust-Kenner ist.
„Aha“, sie belustigt, „aus Leipsch. Das hört man.“
Diese kleine Sprachbrücke machte sie ihm sofort sympathisch. Daraus erwuchs im weiteren eine gewisse Zuneigung. Das Wort Liebe soll noch nicht betont sein, denn zu ihr gehört auch der Beischlaf. Ein solcher erfolgte erst, als Walter mit den Techniken eines solchen durch die junge Polin vertraut gemacht worden war. In diesem Zusammenhang erfuhr er also, was ihm sein Hausarzt einst klarzumachen versuchte.
Die Polin, die wohl wusste, weshalb Walter in Paris war, fragte, ob er mit einem bestimmten Auftrag hierhergekommen sei. Er sei von der kommunistischen Kommandozentrale in Deutschland zur hiesigen exilen Parteileitung als Gedankenleser geschickt. Die Polin glaubte, Walter wolle sie verschaukeln. Ein solcher Klassenauftrag sei neu und bisher noch nicht erteilt worden. Er sei, um es deutlich zu sagen, blöd.
Das glaube er nicht, ließ Walter wissen, denn dieser Auftrag beinhalte die Abwehr unmoralischen Denkens und Handelns der Genossen. Er, Walter, besitze nämlich die Fähigkeit, das Schwein im Manne zu erkennen.
Die Polin schwankte zwischen Lachen und bitterbösem Ernst. Dann sagte sie in einer Mischung aus beidem, dass Klassenkampf sich nicht gegen Schweine richte, jedenfalls nicht gegen natürliche.
Wie man bei ihm diese lächerliche Fähigkeit erkannt habe.
Diese Fähigkeit habe er an sich selbst erkannt, erwiderte Walter, weil der Leiter der deutschen Widerstandsgruppe, Genosse Sack, vom prallen Busen einer jungen deutschen Faschistin gedanklich begeistert war.
Hierzu musste sich Walter nun genauer erklären. So erfuhr die Polin, die sich als Emilie Purzel – ihren Decknamen - vorstellte, den genauen Hergang bei Walters Hausarzt.
„Du kanntest also wirklich nicht die eigentliche Nutzung deines Geschlechtsteils?“, fragte sie höchst erstaunt. „Paris wird dich lehren, es auch anders zu gebrauchen“, fuhr sie fort und, „ich ahne, dass mir diese Aufgabe zuteilwird.“
„Wenn sie mit dem Kommunistischen Manifest in Einklang steht, lasse ich dich gewähren“, meinte Walter und bestaunte die Größe des Eiffelturms, in dessen Nähe sie sich befanden.
„So groß wird deiner nicht werden“, sagte Emilie ironisch und zog Walter weiter.
Bei den Pariser Genossen
Nach langem Fußmarsch hatten sie den angestrebten Vorort erreicht. Hier brannte die Straßenbeleuchtung weniger hell als in der Stadt. Walter spürte, dass ihm die Kraft der Beine schwand.
„Nicht schlappmachen“, munterte ihn Emilie auf, „wir sind gleich da.“
Tatsächlich, wenig später standen sie vor einer Tür, die so alt aussah, als hätte sie die Tage der Französischen Julirevolution von 1789 erlebt. Auch das Haus, dessen Vorderseite den Eindruck erweckte, demnächst auf die Straße zu kippen, sah nicht jünger aus.
„Ziel erreicht“, sagte Emilie und, weil sie vermutete, der deutsche Kommunist Walter Bricht werde dem schiefwinkligen Haus nicht zutrauen, dass es bewohnt ist, „das Gebäude ist stabil. Du musst nicht fürchten, sein Dach aufs Dach zu kriegen.“
Sie lachte. Sie betraten das Haus. Der Flur, an dessen Decke eine trübe Funzel brannte, wurde nur so viel erhellt, dass man nicht gegen eine Wand stieß.
„Pass auf“, warnte Emilie, „an einige Stellen ragen Nägel aus der Wand. An denen hingen früher mal Bilder Adliger. Die nahmen wir ab, beließen die Nägel aber in der Wand. Sollten irgendwann einmal Personen auftauchen, die unserer Tätigkeit nicht wohlgesinnt sind, werden sie sich hoffentlich an den Nägeln blutige Schrammen holen. Deshalb auch die spärliche Beleuchtung.“
Am Ende des Flurs befand sich eine Tür, an die Emilie dreimal kurz und dreimal in längerem Zeitabstand klopfte. Sie wurde geöffnet. Sie betraten einen hell erleuchteten Raum. Walter war geblendet und sah nichts. Wäre eine Schusswaffe auf ihn gerichtet, sähe er sie und den Schützen nicht. Eine wirksame Methode, unliebsame Gäste zu blenden, erklärte man ihm später.
„Genossen“, sagte Emilie fast feierlich, „ich bringe euch den deutschen Genossen Walter Bricht.“
Grabesstille. Walter hatte das Gefühl, mit Emilie allein im Raum zu sein. Nur das Zirpen eines Heimchens war zu vernehmen.
Plötzlich erbebte die Luft. Fast ohrenbetäubend erklang Gesang aus mehreren männlichen Kehlen. Walter kannte Melodie und Text. Es war die Internationale, das international bekannte Arbeiterlied.
Weil Walter nicht sah, wer sang, hielt er den Mund geschlossen. Emilie fiel in den Gesang ein. Sehr laut und inbrünstig. Sie stieß Walter in die Seite. Der deutete den Rippenstoß richtig und öffnete den Mund, um mitzusingen. Er kannte nur die erste Strophe plus Refrain dieses monströsen Liedes. Die beiden anderen Strophen nicht. Den zugehörigen Refrain ja, denn der war gleichlautend. Als er mit diesem Lied zum ersten Mal in Berührung kam, hatte er geglaubt, dessen Länge überschreite nicht die Dauer des Liedes Hänschen klein. Als er das den Leiter des städtischen Arbeitergesangvereins wissen ließ, fuhr der ihn mit der zornigen Bemerkung an, dass Hänschen klein kein Kampflied, sondern ein kleinbürgerliches Kinderlied sei. Schon die Liedzeile „…ging allein in die weite Welt hinein …“ sei realitätsfremd und stehe im völligen Gegensatz zu den aufrüttelnden Refrainworten der Internationale „… auf zum letzten Gefecht …“. Hier schreiten kampfentschlossene Proletarier voran und nicht ein ungezogener Bengel, der wegen irgendeiner Dummheit dem Elternhaus entflieht.
Daran musste Walter in diesem Moment denken, als die Singenden die zweite Strophe in Angriff nahmen. Um nicht unhöflich zu sein, bewegte er lautlos den Mund. So wie sein sozialdemokratischer Vater, wenn der von Menschen umgeben war, die begeistert „Deutschland, Deutschland über alles …“ grölten.
Als der Refrain der dritten Strophe gesungen war, trat wieder wohltuende Stille ein. Das Heimchen setzte sein Zirpen fort.
„Gut gesungen“, lobte Emilie den neben ihr stehenden Walter und hieb ihm anerkennend auf die Schulter.
„Das Urteil kann ich nicht teilen“, sagte einer der Männer, die Walter jetzt sah, weil sich seine Augen an das Licht im Raum gewöhnt hatten. „Der deutsche Genosse blieb ab zweiter Strophe stumm.“
„Stimmt das?“, fragte Emilie streng. Walter nickte eingeschüchtert. Emilies Polen-Deutsch klang hart und unerbittlich. „Warum?“, krachte ihre nächste Frage in sein Gehör.
„Weil sich die anderen Strophen meiner Kenntnis entziehen“, sagte er leicht gehoben, damit seine Schulbildung erkannt wird. „Hänschen klein kann ich aber auswendig“, fügte er beweisführend hinzu.
Diese spärliche Intelligenz wurde nicht anerkannt.
Ein anderer Genosse – es waren insgesamt fünf – hatte ein bisschen Mitleid mit Walter, weshalb er ihn mit den Worten in Schutz nahm, dass nicht jeder Genosse die Internationale auswendig kenne. Ihm falle der Text des bekannten Liedes Schneeglöckchen Weißröckchen auch leichter.
Seine Schutzbehauptung entfachte, wie das bei Partei-Gesprächen unter Genossen üblich ist, eine lebhafte Debatte. In dieser wurde über den gegensätzlichen Wert von Kampf- und Arbeiterliedern zu Weihnachts- und Winterliedern gerechtet.
Ein Genosse, der sich Walter wenig später als Genosse Wimmerzahn und Leiter der Exil-Kommunisten vorstellte, entschied, dass sich die Diskussion auf politische Zielsetzungen und nicht auf den klerikalen Weihnachtsmann und seine flatternde Gehilfin richten solle. Weihnachten sei nur einmal im Jahr, Klassenkampf täglich.
„Der Weihnachtsmann ist aber“, lenkte ein anderer führender Genosse das Streitgespräch noch einmal auf ihn, „eine wichtige Person, die auf die Volksmassen einen bedeutenden Einfluss ausübt. Sie könnte in unserem Sinne wirken.“
Der Wortwechsel erhielt eine neue Zielrichtung.
„Wenn dieser parteilose Sackträger“, nahm Genosse Wimmerzahn wieder das Wort, „im Sinne der Ideen von Marx, Engels, Lenin und Stalin einen Klassenauftrag übernehmen würde, wäre unserer Sache natürlich sehr geholfen. Doch …“, er machte eine Sprechpause, um die Anwesenden spüren zu lassen, dass er nun etwas besonders Wichtiges sagen werde, „… wie könnte er für unsere Sache gewonnen werden?“
Eine Frage also und keine richtungsweise Überlegung, die Genosse Wimmerzahn in den Raum gestellt hatte. Angestrengtes Nachsinnen aller ließ Walter spüren, dass hier kluge Leitgenossen am Nachdenken waren. Der Leipziger Führungsgenosse Sack würde hinsichtlich des Sack tragenden Weihnachtsmannes keine nützliche Eingebung haben, dachte Walter. Er war froh, den Weg nach Paris genommen zu haben.
„Wir dürfen nicht außer Acht lassen“, gab ein anderer zu bedenken, „dass weltweit viele Weihnachtsmänner agieren. Einer allein könnte zu gleicher Zeit nicht in alle Stuben eintreten.“
„Eintreten ist das richtige Wort“, so Wimmerzahn, „er müsste in unsere Partei, die KPD, eintreten. Er müsste Genosse werden. Als solcher wäre es ein Leichtes, ihm einen Parteiauftrag zu erteilen.“
„Sollte dieser weise Vorschlag nur für deutsche Weihnachtsmänner gelten oder die international tätigen erfassen?“, fragte ein anderer Leitgenosse.
Emilie Purzel ließ sich hören und fragte, ob es auch im afrikanischen Urwald Weihnachtsmänner gebe. Bei den Pygmäen beispielsweise.
„Selbstverständlich“, erklärte Wimmerzahn, „nur ist er bei denen wuchsmäßig kleiner als ein normal gebauter.“
Niemand widersprach, obwohl Walter, auf sein Schulwissen bauend, Zweifel hegte. Doch wollte er sie als nebensächlicher Genosse in einem solchen Gremium nicht laut werden lassen. In Afrikas Mitte schneit es nicht, wusste er. Wie sollte der Weihnachtsmann dann seinen Schlitten in Fahrt setzen.
Während man daran ging zu überlegen, wie die Weihnachtsmänner von der Idee des proletarischen Internationalismus überzeugt werden könnten, lenkte die französische Polin Emilia Purzel die Gedankengänge der Genossen auf einen anderen bedeutenden Freudenspender – den Osterhasen.
Zustimmendes Gemurmel. Nur Wimmerzahn murmelte nicht. Er sprach aus, was die anderen nicht sofort bedachten, nämlich, dass der Osterhase ein Tier ist. Als solches fehle ihm die menschliche Stimme und ohne sie würde er nur seine Schnuppernäschen bewegen.
Wieder zustimmendes Gemurmel. Stets wusste Genosse Wimmerzahn das Richtige zu sagen.
Walter, beeindruckt von der Gedankenschwere, die hier im Raum lastete, rief spontan: „Weihnachtsmänner aller Länder vereinigt euch!“
Die Aufmerksamkeit der Anwesenden richtete sich wieder auf ihn. Man erkannte, dass sich der deutsche Genosse in den Schriften von Marx und Engels auskannte, wenngleich in etwas veränderter Form.
Emilie Purzel klatschte Beifall, stellte diesen aber ein, als sie sah, dass sich an der Beifallsbekundung niemand beteiligte. Die hohen Genossen zollten nur höheren Ausrufen Beifall.
Genosse Wimmerzahn richtete sein Wort nun an Walter Bricht. Was er hier zu suchen habe, wollte er wissen.