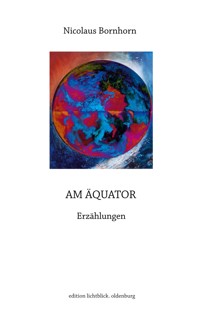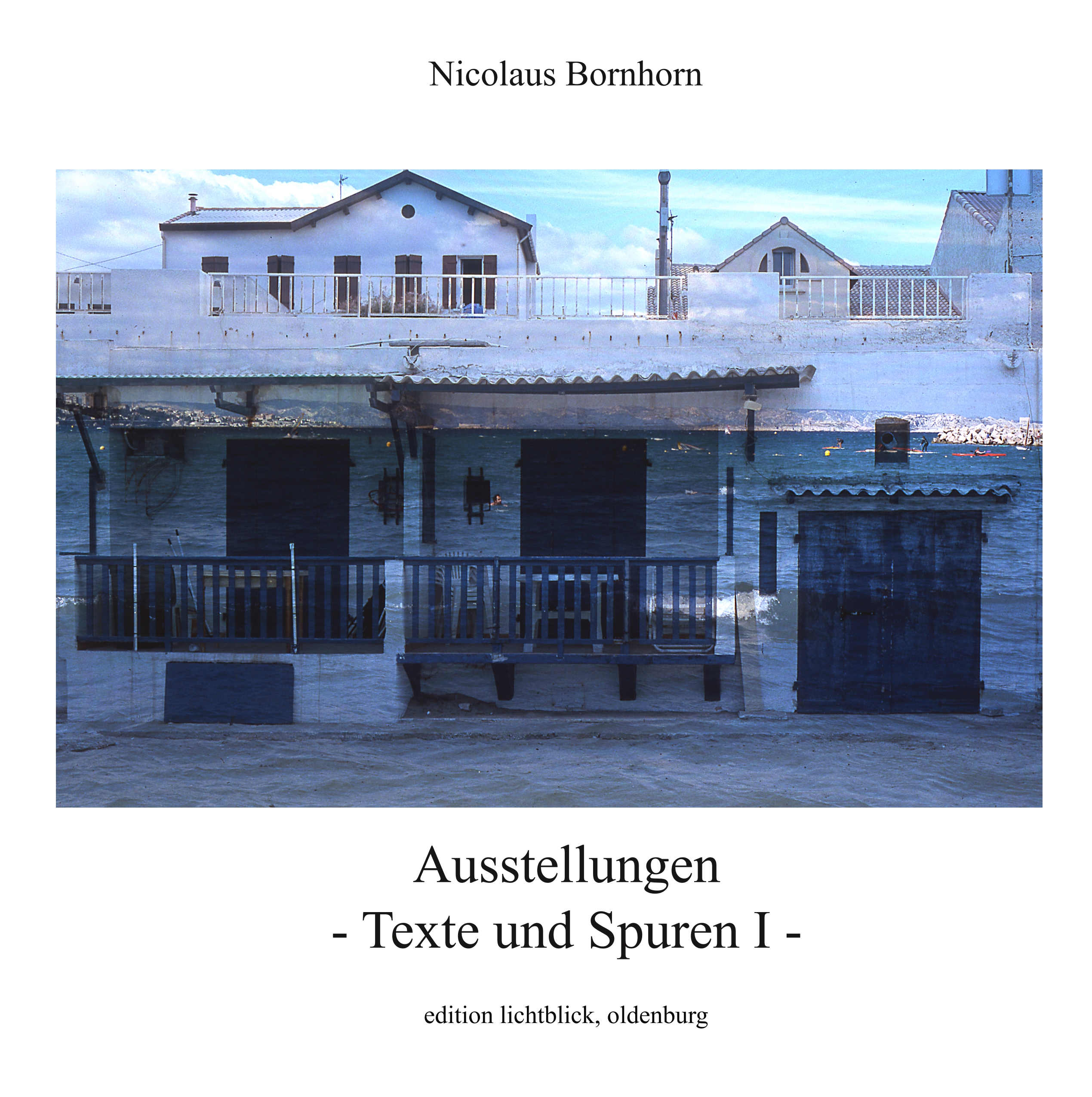Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ich liebe diesen Ort. Morgens, wenn der erste Strahl durch den Eingang fällt und das Spektakel der Welt ankündigt. Mittags, wenn die Sonne aufs Tal hinabbrüllt, alle Farben auslöscht, und das Inne- re der Höhle der einzige kühle Ort ist weit und breit. Abends, wenn der Mond aufgeht und im Spiegel des Stausees sein Abbild erscheint. Selbst das Zwielicht hat seinen Reiz: die schroffe Masse des San Victor wirkt weniger wuchtig, die Erdgeister und Elfen schlüpfen dann aus ihren Löchern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Ouvertüre
Akt I Die Flucht (Allegro)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Intermezzo I
Akt II Das Leben in Graus (Scherzo)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Intermezzo II
Akt III Die Höhle
Epilog
Anhang
Ouvertüre
Als Kunsthistoriker und Amateurarchäologe unternahm ich im letzten Jahr eine Fahrt in die nördlichen Pyrenäen. Ziel meiner Reise war eine Ausgrabungsstätte in der Nähe der spanischen Stadt Graus. Freunde, professionelle Archäologen, hatten mich eingeladen, Studien vor Ort zu treiben und auch mit Hand anzulegen. Es handelte sich um eine ehemalige römische Siedlung, ein Großteil der Grundmauern war schon freigelegt. Nicht weit von der Stätte war ein provisorisches Zeltlager aufgebaut worden, und die Tage verstrichen auf eine Weise, die mir inzwischen lieb und vertraut geworden ist: der Morgen und der Nachmittag gehörten, unterbrochen von der landesüblichen Siesta, der Arbeit im Feld. Bevor das Abendessen serviert wurde, das sich, von Fachgesprächen begleitet, meist bis spät in die Nacht hinzog, unternahm ich oft noch einen Gang in die nähere oder weitere Umgebung. Die Landschaft war zuweilen von atemberaubender Schönheit: weite, almähnliche, grün bewachsene Hänge wechselten ab mit jähen Einbrüchen, schroffen Flusseinschnitten oder von Wind und Erosion geprägten, fast vegetationslosen Hochflächen, wo nur noch Staub und Fels herrschten.
Auf einem dieser Gänge, der mich weiter als gewöhnlich geführt hatte, entdeckte ich durch Zufall eine Höhle. Der Eingang der Höhle war, des Gebüsches und der Pinien wegen, von weitem nicht auszumachen. Nur wenige Meter östlich des Eingangs fiel der rote, von Bauxit durchsetzte Felsen jäh ab und gab den Blick frei auf das fruchtbare „Valle de Graus“, in dessen Mitte das Wasser des zu Anfang des letzten Jahrhunderts angelegten Stausees türkisfarben aufschimmerte. Oberhalb des Sees, und nur über einen Maultierpfad zu erreichen, liegt ein ehemaliges Kastell, das noch aus der Maurenzeit stammt. Die Burgmauern sind verfallen, ebenso die meisten der Häuser im Innern des Kastells. Nur einige schwarz gekleidete Alte sitzen da noch abends, wie eh und je, vor den Türen ihrer einfachen, weiß getünchten Behausungen. Die Jungen sind fortgezogen, entweder in den Hauptort selbigen Namens, der sich mehr und mehr dem Tourismus öffnet, oder aber in die Industrielandschaften im Norden Kataloniens oder rund um Bilbao.
Der Eingang der Höhle wies nach Osten. Als ich sie betrat, musste ich mich erst an das Halbdunkel gewöhnen. Ohnehin waren die Lichtverhältnisse, der vorgerückten Stunde wegen, ungünstig, und ich beschloss, am nächsten Morgen, noch vor Sonnenaufgang, zurückzukommen, zumal die Aussicht, den Sonnenaufgang jenseits des Massivs von San Victor zu erleben, mich reizte.
Während die andern noch schliefen, wandelte ich zurück auf den Spuren des Vorabends und gelangte noch vor Sonnenaufgang bei besagter Stelle an. Die Wolkenformationen hellten auf, eine erste gelbliche Strahlung zeichnete die Kennlinie des Massivs sehr scharf, und ich beschloss, die Höhle ein zweites Mal zu betreten. Gleich im ersten Drittel befanden sich Rußspuren am Boden, die ich am Vorabend nicht bemerkt hatte; sie ließen auf eine nicht allzu weit zurückliegende Anwesenheit von Menschen schließen. Die ersten Sonnenstrahlen erschienen, und sie fielen mit der Höhlenachse überein. Die roten und ockerfarbenen Wände der Höhle begannen, wie von innen heraus zu glühen. Eines der Strahlenbündel, in dem Staubteilchen tanzten, hellte den hintersten Winkel der Höhle auf. Sie verengte sich dort, so dass ich nur noch auf allen vieren vorwärtskam. Was mich dazu trieb, den entferntesten Winkel der Höhle aufzusuchen, die sich als überraschend weiträumig erwies und eine auffallend gute Akustik besaß, erahnte ich erst viel später. Tatsache bleibt, dass ich mit den Fingerspitzen an ein eigenartiges Objekt stieß, das weicher als der von Steinen übersäte Höhlenboden war. Ich wollte schon danach greifen, als ich eine schlängelnde Bewegung wahrnahm. Ich zuckte zurück, doch beruhigte mich dann, als ich erkannte, dass es sich nur um eine Echse gehandelt hatte. Das Objekt aber nahm ich mit hinaus an die Sonne: nachdem ich den Jahre alten, vielleicht Jahrzehnte alten Staub mit der Hand fortgewischt hatte, hielt ich eine Sammlung von Blättern in den Händen, die mit einem dunkelblauen Band gebunden waren. Die Sammlung trug weder Namen noch Titel, und war in einer sorgfältigen Handschrift verfasst, die mit Ausnahme der korrigierten oder durchgestrichenen Stellen gut lesbar war. Ich begann sogleich mit der Lektüre des Textes, verfasst von einem alten (oder zumindest älteren) Mann, der sich mehrmals als „der Gnom“ oder auch als „das große Ohr“ bezeichnete. Letztere Bezeichnung erinnerte mich lebhaft an Namen, die im Verlauf von Initiationsriten bestimmter Indianerstämme den Initiierten gegeben werden.
Ich gebe nun im Folgenden diesen Text ungekürzt wieder, nebst einigen „Partituren“. Ich habe die einzelnen Erzählabschnitte in der Ordnung belassen, in der ich sie vorfand, habe aber an zwei Stellen, die meiner Ansicht nach einen Eingriff dulden, eigene Bemerkungen eingeschoben.
Akt I
Die Flucht
(Allegro)
1
Ich hatte damals den Notar P. zum Nachbarn. Er bewohnte ein ehemaliges Herrenhaus mit weitläufigem Garten, den man eher schon als Park hätte bezeichnen können. In einem entlegenen Winkel dieses Parks befand sich das Atelier seiner Frau, einer vielseitig begabten Künstlerin, die bis weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt war und auch regelmäßig in der Hauptstadt ausstellte. Mir war es zur lieben Gewohnheit geworden, Françoise des Nachmittags in ihrem Atelier aufzusuchen, um ein wenig mit ihr zu plaudern. Jedweder Eifersucht des Gatten hatte ich von vorneherein vorgebeugt, indem ich die beiden kurz nach meiner Ankunft in H. mehrmals zum Essen eingeladen und aus meinem Interesse an den Werken Françoises keinen Hehl gemacht hatte. Henri war der bekannteste Notar am Ort und mit Arbeit überlastet, so dass meine Plaudereien mit Françoise ihn entlasteten und das Schuldgefühl des seine Frau vernachlässigenden Gatten dämpften. Die beiden hatten lange auf der Ile de Réunion in der Nähe Madagaskars gelebt, wo sie zur Crème der dort ansässigen französischen Bourgeoisie gehört hatten. Sie hatten eine Tochter mit nach Frankreich gebracht, Anaïs, die ihrer Mutter an Schönheit in nichts nachstand, und hätte ich zwischen den beiden wählen müssen, so wäre mir die Wahl gewiss nicht leicht gefallen; doch derlei Spekulationen waren meinem „verhärteten Junggesellenherz“, wie Françoise neckend zu sagen pflegte, fremd
In diese stille, fast idyllisch zu nennende Alltäglichkeit brach an einem Wintermorgen des Jahres 19.. der Tod ein. Kein üblicher Tod, nach „langer, zehrender“ Krankheit im Krankenhaus- oder Familienbett; nein, ein mysteriöser, ein gewaltsamer Tod.
Ich kam, wie an jedem Dienstag, gegen zwölf Uhr dreißig aus der Schule, um zu Hause eine Kleinigkeit zu mir zu nehmen. (Es war damals das fünfte Jahr meiner Tätigkeit als Musiklehrer am dortigen Lycée.) Als ich mich meinem Haus näherte, bemerkte ich schon von weitem, dass sich vor dem
P.’schen Grundstück ein Menschenauflauf gebildet hatte. Menschenaufläufe sind mir ein Gräuel, deshalb wechselte ich den Bürgersteig. Im Vorübergehen sah ich, dass zwei in Weiß gekleidete Männer eine Tragbahre transportierten, auf der ein von einer Decke eingehüllter menschlicher Körper lag. Betroffen hielt ich nun an und fragte einen der Herumstehenden, was geschehen sei.
Der Notar ist tot aufgefunden worden in seiner Wohnung.
Nähere Umstände konnte der Mann nicht angeben. Ich wollte zuerst einen der beiden Polizisten ansprechen, aber dann ließ ich es. Henri war tot. Welch ein abruptes Ende für einen Mann, der noch zwanzig, dreißig Jahre hätte leben können. Ich hatte Henri nie als Freund betrachtet, und trotzdem ging mir sein Tod nahe, allein schon Françoises wegen. Wie würde sie die Nachricht aufnehmen? Ich wusste, dass es „Spannungen“ gegeben hatte zwischen den beiden, dass sie nicht glücklich war in ihrer Ehe. Sie hatte einige Jahre zuvor eine Therapie begonnen, aber die Therapie hatte sie ihrem Mann nicht näher gebracht, sondern eher noch die Kluft zwischen ihnen vergrößert.
Am Abend desselben Tages besuchte mich Kommissar L. zum ersten Mal. Ein respektabler Mann in den Fünfzigern, in seinem Metier alt geworden, gründlich, ein wenig langsam, aber mit langem Atem. Er unterrichtete mich vom Tod Henris.
Wie ist der Tod eingetreten? fragte ich ihn.
Herzversagen. Ich habe eine Obduktion veranlasst. Irgendetwas stimmt nicht an diesem Tod.
Ob Françoise schon Bescheid wisse, fragte ich weiter, woraufhin er mich erstaunt ansah.
Wussten Sie denn, dass sie verreist war?
Natürlich wisse ich dies, gab ich zur Antwort, sei ich doch über alle Ausstellungen und Vernissagen Françoises unterrichtet. Der Form halber erkundigte sich der Kommissar, ob ich in der vorangegangenen Nacht etwas Auffälliges auf dem Nachbargrundstück bemerkt hätte. Ich war früh zu Bett gegangen, hatte noch ein wenig gelesen, die Nacht dann durchgeschlafen, ohne auch nur ein einziges Mal aufzuwa-chen (was leider nicht immer der Fall ist). L. stellte keine weiteren Fragen mehr, schaute sich noch einmal kurz um im Salon und verabschiedete sich dann höflich aber formlos.
Am nächsten Tag betrat ich gleich nach der Schule das Grundstück des Notars. Die weiten gemähten Rasenflächen, die gepflegte, auf das Haus zuführende Kastanienallee machten auf mich, wie sonst auch, den Eindruck harmonischer Stille, befriedender Natur. Die Menschenansammlung vom Vortag wirkte nur noch fort als vage Erinnerung, und das Knirschen des feinen weißen Kies unter den Schuhen rundete das Bild ab, gab ihm einen beruhigenden, fast heiteren Anstrich.
Ich fand das Haus unverschlossen vor, betrat die großflächige Eingangshalle, wo Gemälde zeitgenössischer Maler hängen und einige von Françoises Skulpturen auf Glassockeln stehen, aber es war niemand dort. Ich stieg die schlichte, von einer gläsernen Balustrade gesäumte Steintreppe zum ersten Stock empor und sah am Lichteinfall im Gang, dass die Tür zu Françoises Schlafzimmer offenstand. Ich hatte die Hand schon zum Klopfen erhoben, da sah ich, dass sie mich im Spiegel erblickt hatte. Ihr sonst ebenmäßiges Gesicht war gerötet, unter den Augen leicht geschwollen: sie hatte geweint, schien aber, als sie sich dann umdrehte, gefasst. Sie stand langsam auf, ich drückte sie an mich, sie lehnte den Kopf an meine Schulter, als sei er zu schwer geworden; in dieser Haltung verharrten wir mehrere Sekunden.
Was soll ich jetzt tun? fragte sie klagend. Ich bin diesem Haus nicht gewachsen, es wir mich auffressen.
Ich ergriff ihre Hand.
Du solltest vielleicht ein wenig Abstand gewinnen, zu Freunden fahren nach Paris.
Sie ging hinüber zum Fenster, blickte auf den von gestutzten Hecken eingefassten, mit Fontänen durchsetzten hinteren Teil des Gartens hinaus. Als habe sie einen Entschluss gefasst, drehte sie sich plötzlich um und suchte meinen Blick.
Kommst du mit, wenn ich gen Süden fahre?
Das könnte als Flucht aufgefasst werden, erwiderte ich nach einigem Zögern. Hast du denn Gründe zu fliehen?
Du brauchst ja nicht mitzukommen. Dann fahre ich eben allein!
In wenigen Minuten hatte sich die Situation grundlegend gewandelt. Ich war gekommen um zu sehen, wie es ihr ginge, um möglicherweise Trost zu spenden. Stattdessen nun dieser Vorschlag, der mein geregeltes Leben aus der Bahn zu werfen drohte. Andererseits: Hatte ich nicht schon des Öfteren mit dem Gedanken gespielt, den Schuldienst aufzugeben? Die Routine, die meinem bis dahin unsteten Leben zu Anfang einen ordnenden Rhythmus gegeben hatte, empfand ich inzwischen als ein von Tag zu Tag stärker einschnürendes Korsett.
Ich komme mit, aber unter einer Bedingung.
Und die wäre?
Dass wir die Anlage mitnehmen.
Wenn es weiter nichts ist. Wir können ja den Bus nehmen, der ist groß genug für die Anlage, das Gepäck und zwei kleine Matratzen.
Françoise besaß einen froschgrünen Ford Transit, mit dem sie ihre Skulpturen zu den Ausstellungen schaffte.
Was ist, wenn man uns sucht? Warf ich ein. Der Bus ist sehr auffällig.
Wir können ihn ja spritzen, meinte sie, fast schon schalkhaft und, wie ich fand, dem Ernst der Situation nicht angemessen.
Ich war gerade dabei, die Anlage abzubauen, Stecker zu ziehen und Instrumente zu verpacken, als Kommissar L. das Studio betrat. Ich war mit meinen Gedanken bei der „Flucht“ gewesen, hatte eine Platte von Meredith Monk aufgelegt und so das Kommen des ungebetenen Gastes überhört, ein faux--pas, der mir sonst nie unterlaufen wäre. Trotzdem musste er auf sehr leisen Sohlen gekommen sein.
Sie verreisen? kam die lakonische Frage.
Freunde erwarten mich heute Abend zur Probe. Wir geben im nächsten Monat ein Konzert.
Ach ja, ich vergaß, dass Sie auch ein „öffentliches“ Leben haben, ein „zweites Gesicht“.
Ich wollte mich auf diese Art indirekter Gesprächsführung nicht weiter einlassen und fragte ihn geradeheraus nach dem Grund seines Kommens.
Die Obduktion hat nichts Neues ergeben. Herzversagen. Und trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt.
Nur weil es vielleicht Motive gibt, braucht es noch lange keine Täter zu geben. Es kommt immer wieder vor, dass auch jüngere Menschen an einem Herzschlag sterben. Ich kenne da einen Fall…
Der Kommissar ließ mich nicht ausreden.
Ich weiß. Sie haben recht. Ich sollte den Fall zu den Akten legen, wie man sagt. Entschuldigen Sie die Störung.
Ich riet Françoise, die Stadt gen Norden zu verlassen, die eigentliche Richtung erst nach Einbruch der Dunkelheit einzuschlagen. Sie stimmte zu. Sie wirkte nervös und verschlossen. Es begann zu regnen und ich schaltete den Scheibenwischer ein. Sie schaltete den Scheibenwischer wieder aus.
Das Hin und Her macht mich nervös.
Aber dann sieht man ja kaum etwas.
Das ist mir egal.
Ich machte sie darauf aufmerksam, dass ich um einer ihrer caprices willen gerade das Schultor, wahrscheinlich für immer, hinter mir geschlossen hätte.
Das wolltest du ja ohnehin früher oder später tun. - Und außerdem habe ich Henris Tod auf dem Gewissen!
Wie bitte?!
Ich trat auf die Bremse, fuhr auf den Seitenstreifen, der Wagen rollte aus. Ich sah sie von der Seite an: sie blieb ernst, sie meinte es ernst.
Wir fahren zurück. Bist du verrückt geworden. Und das sagst du mir jetzt. Welch ein Glück, dass es dir nicht in Bayonne oder Pamplona eingefallen ist.
Ich habe seinen Tod auf dem Gewissen, aber ich bin keine Mörderin. Fahr weiter, ich erkläre dir alles morgen.
Ich bestand auf sofortiger Erklärung, aber sie ließ mir nur die Wahl auszusteigen (und die Anlage? und der Regen?) oder mitzukommen. Sie mit Gewalt zwingen umzukehren, das wollte und konnte ich nicht. Die restliche Strecke bis zum Haus meines Freundes Guy, der in der Nähe von Saintes wohnte, verbrachte sie schweigend. Ich vertrieb mir die Zeit damit, das Paradox ihrer letzten Aussage aufzuhellen: Wie war es möglich, jemanden umzubringen, ohne zum Mörder zu werden? Hatte sie Mittelsmänner gedungen? Die ganze Geschichte erschien mir wie der Anfang eines schlechten Kriminalromans.
2
Als wir in den Hof des Bauerngehöfts einrollten, war Mitternacht schon längst vorüber. Ich musste mehrmals und zunehmend lauter an der niedrigen Holztür pochen, bevor nach Minuten endlich ein Schlürfen vernehmbar wurde und das verschlafene Gesicht Guys im Türspalt erschien. „Ah, das Große Ohr ist wieder im Lande“, sagte er nur und half uns, das Gepäck nach oben zu tragen. Françoise hielt es kaum noch auf den Beinen, Guy wies ihr ein Zimmer zu, und dann frischten wir bei einem Glas Cognac Erinnerungen auf und erzählten einander die „Chronik der laufenden Ereignisse“ seit unserer letzten Begegnung.
Guy und ich waren eine Zeitlang Kollegen gewesen an derselben Schule. Er hatte Literatur unterrichtet und war der einzige unter den Kollegen gewesen, dem ich länger als fünf Minuten zuhören konnte, ohne dass ein inneres Gähnen aufkam. Nach einer Scheidung hatte er den „Ort des (Ver-)Brechens“ gemieden, die eheliche Wohnung verlassen und war mit seinem Sohn Felix in die Charente gezogen, um dort eine Fischzucht aufzumachen. Er war selbst seines Zeichens „Fisch“, und diesem Zeichen verdankte er wohl auch die außerordentliche Einbildungskraft, die seinen Erzählungen Farbe und Tiefe gab und seinen Texten - wenn er sich einmal zum Schreiben aufraffte, was leider nur selten der Fall war - eine schillernde Vielschichtigkeit.
Deine Kollegen von damals gastieren übrigens hier in der Nähe, in Angoulême.
Von welchen Kollegen sprichst du?
Von Jeannot, dem Clown, und Richard, dem Sänger.
Diese Neuigkeit überraschte mich wirklich. Ich hatte jahrelang nichts von ihnen gehört, praktisch seitdem ich den Zirkus mit zwanzig verlassen hatte, um aufs Konservatorium in Paris zu gehen. Eine Vielzahl von Bildern stieg in mir auf aus jener Zeit und ich beschloss, wenn die Umstände und Françoise es erlaubten, einen Umweg über Angoulême zu machen.
Am nächsten Morgen wurde ich sehr früh wach, noch vor Sonnenaufgang. Im ganzen Haus herrschte Stille, und durch das niedrige, kleine Fenster trat ein mürbes Licht, das die Grautöne und die farblichen Zwischenstufen der Oberflächen akzentuierte. Ich schlüpfte lautlos hinaus, und mein erster Gang führte mich, wie jedes Mal bei meinen Besuchen auf Guys Hof, hinüber zu den Fischteichen. Soeben erschien die Sonnenscheibe jenseits des Waldstreifens, das zuvor weißliche Blau des wolkenfreien Himmels ging über in gesättigtere Blauzonen. Das Orchester der Vögel hatte schon eingesetzt. Eine grasbewachsene Anhöhe bot die Möglichkeit, den gesamten Bereich der Teiche zu überblicken. Und einen Überblick hatte ich jetzt bitter nötig!
Das Reisen würde mir gut tun. Ich ließ Bilder aus der jüngeren Vergangenheit an mir vorüberziehen: welch Aufatmen bei dem Gedanken, dieser Falle entronnen zu sein, dieser Arbeit, die mich jeden Tag ein wenig mehr in die Normalität hinab zog. Das sonntägliche Orgelspiel, die Achtbarkeit, einige Klavierschüler, um das Monatsende aufzurunden.
Unter mir lagen silbernen, im Gegenlicht aufblinkenden Spiegeln gleich, die Teiche. Aus den geriffelten Wassern schnellten hie und da, für Bruchteile von Sekunden, Forellen, so als seien ihre glänzenden Rückenpartien die zur Wasserschrift gehörende geheime und geheimnisvolle Zeichensetzung. Einige der Becken gerieten dann auch alsbald in Wallung: unterirdische Röhren mussten dort Sauerstoff und Frischwasser zuführen.
Weiter oben am Bach, der einst das Anlegen der Teiche ermöglicht hatte, befand sich die alte Mühle, die schon seit Jahren leer stand. Das riesige Mühlrad sowie das Gestänge im Innern des Gebäudes waren weiterhin intakt, aber nach dem Tod des letzten Müllers hatte sich der geringen Erwerbsmöglichkeiten wegen kein Nachfolger finden lassen. Als ich mich jedoch diesmal dem massigen Bau näherte, entdeckte ich zu meiner Überraschung Leben darin: ein altes, mit Möbeln überquellendes Lastauto stand davor, und ich hörte Kinderrufe. Sollte sich doch ein Nachfolger gefunden haben? Ich beschloss, Guy danach zu fragen; er würde sicher auf dem Laufenden sein.
Auf dem Rückweg schlenderte ich über den Friedhof des Ortes und bemerkte Felix, der in ein Selbstgespräch vertieft schien. Er balancierte auf der Friedhofsmauer, hatte dort drei brennende Kerzen mit einem Faden umspannt und rief voller Eifer
Wenn einer an dem Faden zieht, dann geht er in die Falle. Wenn einer an dem Faden zieht, dann geht er in die Falle…
Er sprach dabei laut zu sich selbst, hüpfte, am Ende der Mauer angekommen, von einem Bein aufs andere, und schien von mir überhaupt keine Notiz zu nehmen.
Noch zwei weitere Bilder oder Zeichen fielen mir auf beim Durchqueren des Friedhofs: Auf einem Familiengrab zog eines der Geburtsdaten zwar den üblichen Gedankenstrich nach sich, aber dort, wo das Todesdatum hätte stehen müssen, klaffte eine Leere. Und einige Gräber weiter standen, parallel ausgerichtet, zwei identische Frauenstatuen, mit Patina überzogen, in antike Gewänder gehüllt. In der Linken hielten sie einen Lorbeerkranz, mit der Rechten führten sie einen Griffel oder Pinsel.
Um das Raritätenkabinett vollzumachen, entdeckte ich im Eingangsbereich des Hauses Guys neueste Schöpfung. Er sammelte schon seit langem Aquarien, aber diesmal hatte er den Fisch abgeschossen: zwischen Algen und Teichrosen stand ein in Marmortönen gehaltener griechischer oder römischer Tempel, dessen Dach stellenweise durchlöchert war, so dass die Holzverschalung durchschien. Die Wände wiesen Risse auf, und auf der Freitreppe westen halb zerborstene Säulen. Dies alles in dem unwirklichen Licht des Aquariums, von Luftbläschen durchzogen und von gelben oder roten, fast transparenten Goldfischen umschwommen.
Na, wie gefällt dir das Kunstwerk? - „Paradies unter Fluten“ habe ich es genannt.
Guy war, von mir unbemerkt, hinzugetreten. „Das Schweigen der Zeit“ sei auch kein schlechter Titel, gab ich zu bedenken, aber dann wandten wir uns den wirklichen Dingen zu, der Bereitung des Frühstücks.
Ich fragte Guy nach dem neuen Besitzer der Mühle und erfuhr, dass ein irischer Schriftsteller dort einzöge mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern. Die Frau sei Archäologin und wegen der Ausgrabungen gekommen, die in den nächsten Wochen beginnen würden.
Ausgrabungen hier, wo Hund und Fuchs sich ‚Gute Nacht‘ sagen?
Man vermutet, dass es sich um eine römische Kultstätte handelt, aus der Zeit kurz nach Christi Geburt.
Ah, das erklärt dann auch den Ursprung deines letzten Kunstwerks.
Ich hätte das Sujet gern noch ein wenig vertieft, hätte gern mehr über den irischen Autor erfahren - haben nicht Bretonen und Iren die gleichen Vorväter? - aber aus den oberen Gemächern erscholl die imperative Stimme Françoises, die den am Vorabend versprochenen Café am Bett reklamierte.
Ich stieg mit dem Nötigen bewaffnet die Stufen hinauf, entschlossen, ihr diesmal des Rätsels Lösung zu entreißen; ich hatte genug vom Schweigen der Fische. Die Geschichte, die ich dann zu hören bekam, erschien mir unwahrscheinlich und verworren: seit langem schon habe sie Henri nicht mehr geliebt (das wusste ich). Deshalb habe sie ihre Wahrsagerin gebeten (dass sie Wahrsagerinnen aufsuchte, war mir neu), ihr zu helfen, sich von ihrem „krankhaft eifersüchtigen“ Gatten (das schien mir stark übertrieben) zu trennen, ihr zu helfen, seine „psychische Abhängigkeit“ zu beenden. Die Wahrsagerin habe sie um eine Photographie Henris gebeten und eine recht hohe Geldsumme gefordert. Das alles habe sich zwei Wochen vor ihrer Abreise nach Paris ereignet.
Aber warum bist du dann überhaupt „geflohen“? Niemand kann dir etwas beweisen. Oder anders gesagt: erst durch die Flucht machst du dich verdächtig.
Diese „Flucht“ wer die einzige Möglichkeit, dich herauszuholen aus deinem Alltagstrott.
Diese Wendung hatte ich nicht erwartet. Also empfand sie doch mehr für mich als es die burschikose Art, mit der sie mich immer behandelt hatte, annehmen ließ. Nun denn: der vermeintliche Kriminalfall, eine maskierte Liebesgeschichte. Was würde als Nächstes folgen? Tragödie, Komödie, Posse? Scherzo, Allegro, da capo alla fine? Das Motiv begann mich zu interessieren, und ich spielte im Kopf verschiedene Variationen durch, die etwas plötzlich abbrachen, da Françoise mich zu einem längeren und eher heftigen Kuss aufs Bett und an sich zog.
3
Am Nachmittag befanden wir uns schon auf dem Weg nach Angoulême. Das Requiem von Mozart gab den langen Pappelalleen einen elegischen, „majestätischen“ Charakter, und die weite, grüngesättigte Landschaft gab den Ereignissen Tiefe. Während Françoise den Rückspiegel benutzte, um Make-up aufzulegen, dachte ich über die Weisheit des Schicksals nach, das mich vom beobachtenden Mitfahrer zum teilnehmenden Reisegefährten gewandelt hatte. Bevor neue, dunkle Wolken am Himmel unserer Gemeinsamkeit aufzogen, wollte ich mich jeder Nuance des Glücks würdig erweisen. Françoise überließ dem Fahrtwind ihr langes, dunkles Haar, und Mozarts Reise nach Prag kam mir in den Sinn. Wie leicht sich doch, zumindest aus literarischer Sicht betrachtet, in jener Zeit jegliche Unbill äußerer Umstände in Wohlgefallen auflöste, sobald das Genie des Künstlers vom Fürstenhof erkannt war. Das Porträt eines schalkhaften, liebenswerten Komponisten entstand auf jenen Saiten, eines Mannes, der trotz aller Weltlichkeit und Anfälligkeit für den weiblichen Charme im Innern die Kunst über alles setzte.
Eine romantische Vision von Heirat und Kindern stieg in mir auf, aber was noch fehlte in dieser Vision war der neue Tätigkeitsbereich, der das Verschmelzen der verschiedenen Einzelschicksale zu einem neuen ermöglichen möchte.
Was hast du denn? fragte Françoise, als sie den letzten Lidstrich aufgetragen hatte und mich von der Seite ansah.
Warum?
Deine Züge liegen offen „wie ein aufgeschlagenes Buch“, doch leider ist es meist ein fremdsprachiges Werk, orakelte sie.
Ich dachte eben daran, dass ich vor zehn, fünfzehn Jahren noch nicht einmal wusste, ob ich später ein Mann oder eine Frau sein würde. Und nun schmiede ich Pläne, in denen Heirat und Kinder vorkommen.
Was ist daran so außergewöhnlich? Die schmiedet doch jeder von uns einmal.
Ich weiß doch gar nicht, ob ich überhaupt Kinder zeugen kann.
Das käme auf einen Versuch an…
Ihr Blick war klar und heiter, wie eine Landschaft nach dem Gewitter. Mit jedem neuen Tag konnte ich besser darin lesen. Es gab Zärtlichkeit darin, es gab Gefühl, und der Zugang zu ihm war einfach. Jahrelang hatte ich mich für unheilbar gehalten. Noch als Jugendlicher hatte ich Angst vor den „Großen“ (ich selbst bin nie über die fünf Fuß zwei Zoll hinausgekommen). Mehr noch als ihre Größe war es die Art, wie sie einander begegneten, die mir Angst gemacht hatte. In dem, was sie Liebe oder Erotik nannten, hatte ich jahrelang nur eine verschleierte Form der Aggression sehen können (Guy hatte einmal „im Spaß“ gesagt, ich sei in der voyeuristischen Phase des Kindes am Bett der Eltern stecken geblieben). Da mir die richtigen Hormone fehlten, hatte ich ständig das Gefühl gehabt, einer gigantischen, fremd gesteuerten Inszenierung beizuwohnen. Der Hormonschub kam spät, doch er kam; vom Arzt ausgelöst zwar, aber biologisch verankert. Ich bekam Grund unter die Füße, das Schweben im Zwischenreich des Zwitters nahm ein Ende; aber die langjährige Ambivalenz des „weder Mann noch Frau“, des „weder Fisch noch Fleisch“ hinterließ psychische Spuren.
Ich musste plötzlich verlangsamen, eine Kuhherde blockierte die Straße. Landgeruch und Glockengebimmel. Jenseits der vom Wind gewellten, im letzten Goldgelb sich erstreckenden Getreidefelder tauchten die Dächer von Angoulême auf. Schon von weitem, noch bevor wir die Außenbezirke der Stadt erreicht hatten, konnten wir die Fahnen und Masten des Hauptzeltes ausmachen. Als wir uns den im Rechteck um das Zelt aufgebauten weißblauen Buden näherten, kam uns der Publikumsstrom der beendeten Nachmittagsvorstellung entgegen. Im Direktionswagen erfuhren wir, dass die Artisten nur eine Stunde Zeit hatten sich auszuruhen und auf die Abendvorstellung vorzubereiten. So beschlossen wir, uns erst einmal die Vorstellung anzuschauen und dann Jeannot und Richard in ihrem Wagen aufzusuchen.
Ich führte Françoise durch die „Wagenburg“ und sie blieb, wie nicht anders zu erwarten war, vor dem Affenkäfig stehen. Die Bewegungen der Tiere, die Ähnlichkeit ihrer Gestik mit jener der Menschen faszinierte sie; die Bildhauerin in ihr fühlte sich angesprochen.
Ihre Gesten sind oft ehrlicher als die der Menschen, sagte sie schließlich, nicht ohne Ironie. Sie sind natürlicher, weniger gehemmt.
Der Affe Kafkas kam mir in den Sinn. Man hatte mir mehrmals vorgeschlagen, diese Rolle auf der Bühne zu spielen, aber ich hatte immer abgelehnt: diese Rolle beunruhigte mich. Sie hätte von mir Besitz ergriffen, der Text in mir Wurzeln geschlagen, mich monatelang verfolgt. So nahe kam er meiner eigenen Erfahrung mit den Menschen.
Mit Jeannot zusammen hatte ich eine Nummer auf die Beine gestellt, die wir „Der Fremde“ genannt hatten. Die Geschichte erzählte die Ankunft eines früheren Freundes des Clowns im Zirkus. Ich spielte den Clown und Jeannot den Fremden. Dieser war eine Art „mondänes“ Doppel, der seinem Freund einst Frau und Arbeit genommen hatte, und nun in den Zirkus kam, um den Clown um Vergebung zu bitten, litt er doch an Anfällen von Schuldgefühl. Der Clown aber gab ihm sein Spiegelbild zurück, spiegelte auf komödiantische, manchmal auch bitter-ironische Weise die Rolle des „Erfolgreichen“, der im Zirkus eine zweite „Karriere“ gemacht hat. Ob der Humor der Szene durchkam und ankam, hing vom nuancierten Spiel des Clowns ab, Variationen eines bekannten Themas, des Doppels. Hatte eine erste Identifikation stattgefunden, blieb den Menschen das Lachen oft „im Halse stecken“. Sie selbst wurden dort porträtiert, sie, die auf Kosten eines andern lachen wollten. Der andere, das war ich, aber dieser andere lag in ihnen selbst verborgen, und in dem Moment, da die Identifikation sich aufspaltete, geschah ein Bruch.
Eine andere Nummer, die ich zusammen mit Richard einstudiert hatte, gab dem Publikum Gelegenheit, sich von der Güte des Hörsinns zu überzeugen, der mir bei meiner Geburt als Geschenk in die Wiege gelegt worden ist. Richard bat einen der Zuschauer am anderen Ende des Zeltes, ihm eine Botschaft ins Ohr zu flüstern, und kaum hatte dieser geendet, da gab ich die Botschaft schon laut und deutlich wieder. Natürlich gab es immer Ungläubige und die einzige Art, sie zum Schweigen zu bringen, bestand darin, ihnen Gelegenheit zu geben, an der Nummer teilzuhaben.