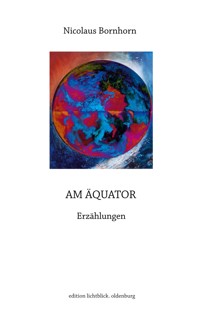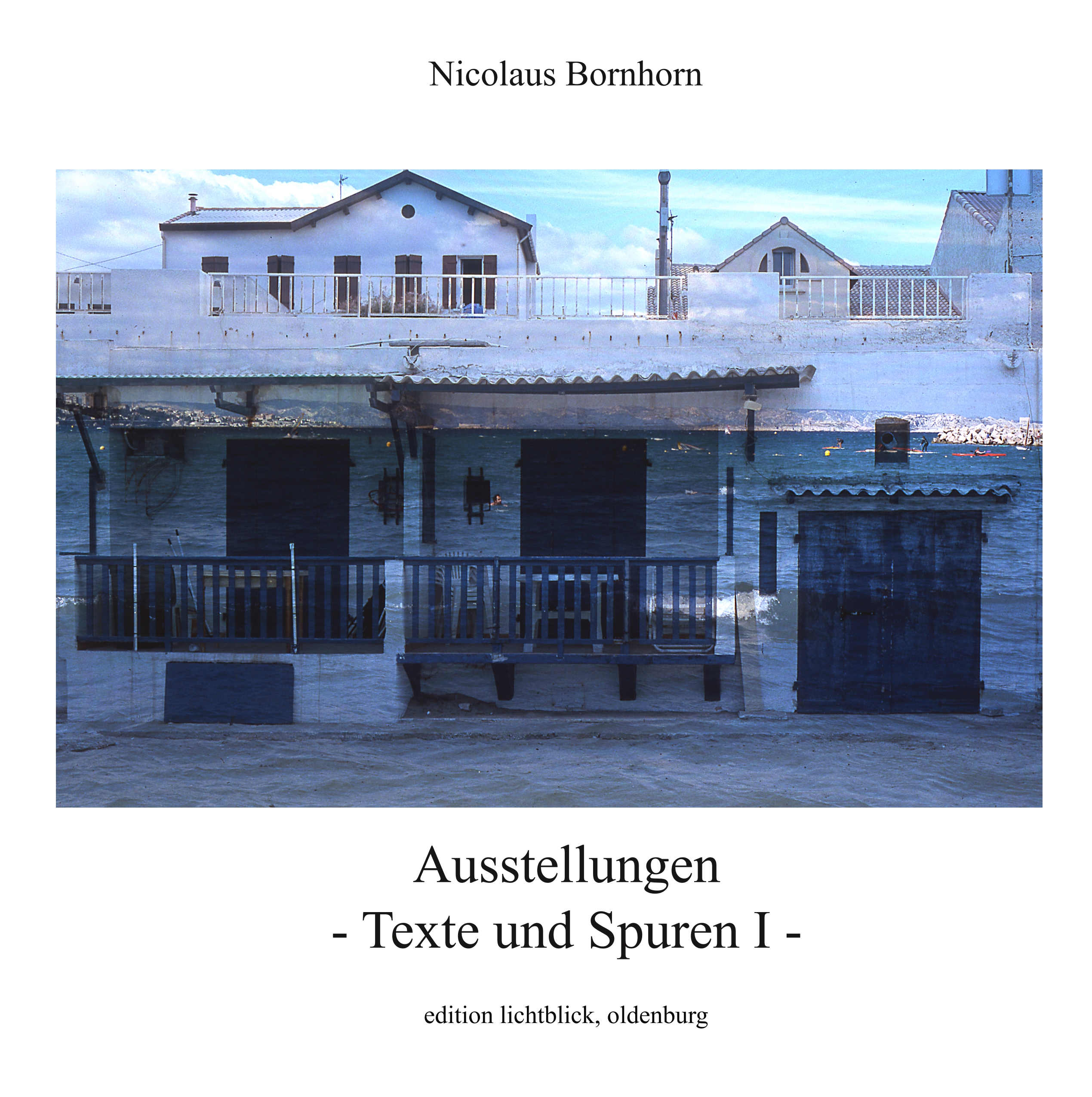Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nicolaus Bornhorn wohnt und arbeitet im Ammerland.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 63
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les oeuvres d’art que nous aimons sont des cloîtres où les humains trouvent un recueillement absolu et une fraîcheur qui calment les fièvres du monde
Die Kunstwerke, die wir lieben sind Klöster, in denen die Menschen vollständige Sammlung finden und eine Frische, die die Fieber der Welt besänftigt.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Der andere Ort
Die Wirklichkeit des Films
Die Weisung
Der Einzug
Die Verlängerung der Gesten
L’Esprit de sel
Die Vereinigung
Epilog
Werke
Prolog
Ich wachte eines Morgens auf und wusste, dass die Zeit der Vorbereitung vorüber war. Das diese Erkenntnis durchdringende und einfassende Erleben ließ sich am ehesten als „sanfte Klarheit“ umschreiben. Die neue Erlebnisform würde mich in Zukunft begleiten, auch dies wusste ich, und das bisher Erlebte umschreiben.
Ich stand auf, trat ans Fenster, öffnete es und sah hinab in den frühmorgendlichen Garten, dessen Konturen sich mit jeder Minute schärfer abzeichneten. Zugleich kehrten die Farben zurück. Der Atem der in meinem Rücken Schlafenden ging leise und regelmäßig; darein verwoben die vom Garten aufsteigenden Vogelstimmen. Gelehnt gegen die Brüstung, sie mit den Händen fest umspannend, so dass die Kühle des Metalls bis hinauf in Schulterhöhe fühlbar wurde: solcherart weitete ich mich in den beginnenden Tag hinein.
Der andere Ort
Ich hatte das „italienische Haus“, wie ich es sogleich nannte, auf einer meiner Fahrradtouren in den nördlich von Marseille gelegenen Lubéron gefunden, einem nur selten schroffen, über weite Strecken sich vielmehr dahinwellenden Mittelgebirge. Bis zu jenem Abend, an dem ich das Haus fand, hatte ich nicht einmal gewusst, dass ich eines suchte. Aber das ockerfarbene Gebäude, der verwilderte Vorgarten, darin die Steinbänke mit bröckelnder Sitzfläche, auch das Nebenhaus mit der Fontäne und die jenseits des Weinfeldes gelegene Kapelle hatten vom Ende einer Suche gekündet, die ich noch gar nicht begonnen wusste. Dieser Ort schien die Verkörperung eines Phantasiebildes zu sein, das schon seit Langem in mir nach Gestaltwerdung verlangt hatte.
Als ich mich in Roussillon, dem nächsten Dorf, nach dem Besitzer des Anwesens erkundigte, erhielt ich als Auskunft, dass es schon seit Monaten leer stehe, weil eine Erbengemeinschaft sich nicht einig werden könne. Die einzige das Haus betreuende Person sei ein Jesuitenpater, der mehrmals die Woche käme, sich um den Garten kümmere und die Mauern und Zimmer instand halte.
Ich bezog ein Zimmer im einzigen Hotel des Ortes und wartete auf den Pater. In den ebenfalls italienischen Erdfarben Roussillons, dessen Häuser vom hellen Gelb bis hin zum kräftigen Rot geronnenen Blutes alle Farbnuancen aufwiesen, fühlte ich mich augenblicklich heimisch.
Während ich auf den Pater wartete, hatte ich Muße, das unebene, von kleinen Plätzen aufgebrochene Netz der Gassen zu durchstreifen. Mehr als einmal gehörte das Dorf zu einem Western, wenn etwa hinter scharf gezeichneten Fassaden und ebenso schroffen Schatten im gleißenden Mittagslicht die Kirche auftauchte und mich an meine mexicanische Reise denken ließ, oder wenn, wie zur Bestätigung, ein Tourist mit amerikanischem Akzent und einem Strohhut auf dem Kopf das Bild durchquerte.
Auf das Holz einer bogenförmigen Toreinfahrt war irgendwann einmal eine Berglandschaft gemalt worden, die jedoch, da inzwischen verwittert, auf dem blassblauen Hintergund nur mehr zu erahnen war.
In der Dorfmitte gab es mehrere Andenkenläden, die neben Erzeugnissen von Kunsthandwerkern auch Postkarten auf drehbaren Ständern anboten. Ich kaufte einige dieser Karten, die mir später als Wegweiser zu den verschiedenen Höhlen und Steinbrüchen dienen sollten. Das Auffälligste an den Karten waren die Höhleneingänge, die, weil im Sonnenaufgangs- oder untergangslicht aufgenommen, zu Symbolen für Tunnel und Gänge im Körperinnern wurden: rote, den empfangenden oder gebenden Frauenmündern ähnelnde Schlünde.
Ein auf die Berglandschaft gezwecktes Plakat kündigte ein Tennisturnier an, ein vorgezeichneter Weg führte von der Ortsmitte bis zum Country Club. Der Weg wurde zum Hohlweg - knie- bis hüfthoch beidseits die ockerfarbene Sandwand -, an einer Stelle, wo das Geäst beladener Obstbäume ihn säumte, wurde er gar zum Tunnel. Wagen, mit weißen Bändern geschmückt, überholten mich, kamen mir so nahe, dass ich zum äußersten Rand der Fahrbahn hinüberwechselte. Im letzten Wagen saß das Brautpaar, das den nun Stehengebliebenen grüßte und ihm zulächelte. Als auch dieses Fahrzeug außer Hörweite war, wehte mir ferner Glockenklang nach.
Der Country Club lag inmitten eines Pinienwäldchens. Gegenüber dem Eingang, nur durch die staubige Straße von ihm getrennt, weideten Pferde, grasten Kühe, schnatterten Gänse auf dem Gelände eines verfallenden Hofes. Zu beiden Seiten des Eingangs aber standen Karossen aus Metall und Glas, die in der Sonne blitzten. Ich kaufte eine Karte an einer Holzbude, und eine Frau ohne Unterleib gab mir das Wechselgeld heraus. Der Center Court war die Bühne eines kreisförmigen antiken Theaters. Das Murmeln der wartenden Zuschauer vermischte sich mit dem Rascheln der Pinienkronen; oder war es ein „Rauschen“? Während ich nach dem treffenden Wort suchte, setzte sich eine Frau neben mich, die ihre Augen hinter dunklen Gläsern verbarg. Ich glaubte, sie zu kennen, erkannte sie aber nicht, und als die ersten Ballwechsel zu mir heraufklangen, hatte sich meine Suche verlagert: nicht mehr das inzwischen als „Säuseln“ umschriebene Geräusch umkreiste sie, sondern den Namen dieser Frau. Ich durchlief selbst die Buchstaben des Alphabets, um die Barrieren gegen das Erinnern zu umgehen, doch erst als die feingliedrigen Finger für einen Augen-blick die Brille aus dem Gesicht nahmen, erkannte ich die bekannte Schauspielerin Nathalie B. Die sich sogleich in mir ausbreitende Beruhigung war Gegensatz zu ihren fahrigen Gesten; diese boten dann auch den Ansatz zum Gespräch.
- Ich habe Sie in Ihrem letzten Film gesehen. Bei der Montage hat der Regisseur so kurze Szenen aneinandergeschnitten, dass kaum eine Ihrer Gesten zu Ende geführt ist.
- Das lag daran, erwiderte sie, dass das Budget sehr begrenzt war. Hätten wir die Szenen länger gedreht, so hätten wir Schauspieler mehr Zeit zum Proben gebraucht, und es wäre auch mehr Filmmaterial nötig gewesen, da, wie Sie sich vorstellen können, bei langen Szenen weit mehr misslingen kann.
Als ich, während einer Spielpause, mit zwei Getränken zurückkehrte zu meinem Platz, musste ich feststellen, dass sie fort war; auch mein suchender, die Reihen abtastender Blick konnte sie nirgends entdecken.
Ich sah mir das Spiel weiterhin an, aber die Eleganz der Spieler betraf mich nicht mehr. Ich stand, bei sinkender Sonne, auf verlorenem Posten und verließ den Country Club, bevor die Zuschauer zum Ausgang hasten, die Karossen besteigen und Staub aufwirbeln würden.
Träume voller Gewalt suchten mich heim in dieser Nacht, bis ich aus dem Schlaf hochschreckte und erkannte, dass die dem Hotelfenster gegenüber liegende Straßenlaterne das Zimmer in schwarze und weiße Flächen aufteilte. Die „Schachnovelle“ Stefan Zweigs kam mir in den Sinn und ich schloss die Läden. In dem neu entstandenen Raum, dem gedämpften Licht verlor die kalte weiße Strahlung ihre Macht.
Am Morgen fühlte ich mich dann auch frisch und erholt und ging die gepolsterten Treppenstufen aufgeräumt hinunter. Während ich auf das Frühstück wartete, blickte ich ins Tal hinab: in der Ebene löste der Morgennebel sich auf und das Licht war so klar wie an den Tagen, da der Mistral weht. Helle Gelb- und Grüntöne dominierten und aus dem Schulhof unter dem Fenster drang das fröhliche Rufen von Kindern herauf. Die Zweige eines Feigenbaumes ragten ins Bild, die Frucht stand noch eng am Holz. Vom Nebentisch hüpften italienische Wörter herüber: die Kinder umkreisten den Tisch, während die Eltern, ohne dämpfend in das Spiel einzugreifen, die Reiseroute des neuen Tages berieten.