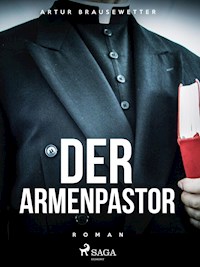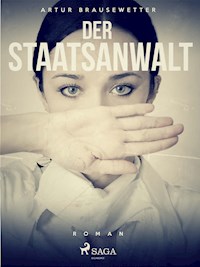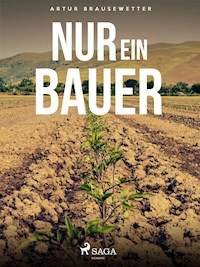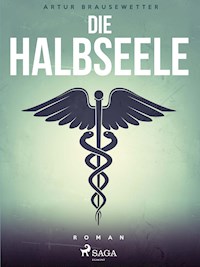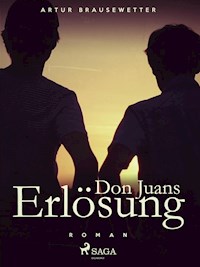Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf Malkaymen feiern sie den Geburtstag des Kommerzienrats Vollbrecht, als jemand aus dem Dorf dringend den Gutsherrn sprechen möchte. Im benachbarten Dorf kämpfen drei Kinder mit dem Tode, von einer Epidemie ist hinter vorgehaltener Hand die Rede. Der einzig verfügbare Arzt an diesem Tage ist der neue Doktor Werner Torwald aus Neukirchen, der als sonderbar gilt. Als er die Kinder sieht, weiß er, dass sie sterben müssen. Als plötzlich auch die jüngste Tochter Vollbrechts Anneliese erkrankt, wendet sich ihre ältere Schwester Dora an Torwald. Dieser offenbart ihr zögernd, dass er den Tod der Menschen aus ihren Augen lesen könne. Dora fleht ihn an, den Kampf gegen die Geister aufzunehmen und in dieser Nacht gelingt ihm dies. Anneliese und eines der Kinder aus dem Dorf überleben. Das Licht hat über die Finsternis gesiegt. Nicht nur Dank ist es, der Dora zu Torwald hingezogen fühlt. Diesen Mann, für den seine besondere Gabe Segen und Fluch bleibt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Brausewetter
Der Kampf mit den Geistern
Roman
Saga
Ebook-Kolophon
Artur Brausewetter: Der Kampf mit den Geistern. © 1930 Artur Brausewetter. Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711487662
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
Erstes Buch
In der Rotbuche sang ein Vogel. Er war keiner der geübten Sänger, sondern ein junger Anfänger, der jetzt zur Mittagszeit, wo die anderen sich ausruhten, seine Kunst und Kraft zu proben schien; etwas Schnarrendes war in seiner Stimme, manchmal auch etwas Zwitscherndes, dass es wie ein Lachen klang. Und die Sonne, die in einem Heere von unzählbaren kleinen glitzernden Körperchen von dem blasshellen Himmel strahlte, lachte wie er. Und von der Wiese, in der die Leute die Nachmittagsarbeit gerade aufgenommen hatten, drang ein durch die Entfernung gedämpftes Lachen hinüber. Es war, als ob alles da draussen, der Himmel und die Bäume und die Wiesen, über die törichten Menschen lachte, die an einem so wundervollen Junitage, wo die Welt wie ein einziger leuchtender Festtag anzusehen war, nichts Besseres zu tun wussten, als zwischen engen Wänden an langgedeckter Tafel in schwarzen Röcken oder seidenen Gewändern mit feierlich zurechtgemachten Gesichtern zu sitzen.
Aber die hier sassen und assen, schienen darüber anders zu denken. Die Speisen, die die alte Schönknechtsche, die durch Jahrzehnte bewährte Mamsell von Malkaymen, mit der gewohnten Kunstfertigkeit bereitet hatte, und die auserlesenen Gewächse, deren Jahrgang und Namen der hagere Johann mit den glattrasierten Lippen beim sorgfältigen Einschenken gewichtig verkündete, liess sie Leuchten und Lachen da draussen kaum entbehren.
Weit waren die beiden schweren Eichentüren geöffnet; sie gaben den Blick frei auf die geräumige Gartenveranda mit den weissen einladenden Korbsesseln und Stühlen und, über sie und den jung angelegten Park hinweg, durch zwei torartig gelichtete und gestutzte Baumgruppen in die üppigen Wiesen und fruchtstrotzenden Felder.
„Man sieht’s ganz gern auch mal von ferne, wenn man immer mitten drin steht“, meinte der alte, aber noch sehr rüstige Kammerherr von Oerzen auf Worditten, der täglich seine sechs Stunden zu Pferde sass und die übrigen zwischen Schachbrett und einer guten Flasche gewissenhaft zu teilen wusste, „und diese Honigberger Auslese hat mehr Sonne in sich gesogen, als ganz Malkaymen mit seinen Feldern und Wäldern an einem Tage wie diesem — habe ich nicht recht, Herr Kommerzienrat?“
„Gewiss — diese Sonne ist der beste Landmann, da kann unsereiner getrost feiern.“
„Feiern ist gut. Als ob Sie überhaupt wüssten, was feiern ist. Ob Sie in Ihrer Wohnung in der Stadt Gäste empfangen oder uns hier draussen im hellen Junisonnenschein das auserlesenste Essen geben, das ist ja alles nur — na, wie sagt doch Pastor Hartau, mein oller Philosoph da in Kokoschken? — ach ja, richtig: das ist alles bei Ihnen nur im Unterbewusstsein. Im Oberbewusstsein, oder wie Pastor Hartau das nennt, da wälzen Sie ja nur Ihre Pläne und Projekte, unterhalten sich mit Ihren Zahlen und verdienen bei einem Glase Wein, das Sie meistens noch nicht einmal trinken, zehnmal mehr als unsereiner, wenn er den ganzen Tag auf dem Gaule schwitzt.“
Es war eine Eigentümlichkeit des alten Kammerherrn, dass er von dem Augenblick an, in dem seine Weinseligkeit einsetzte, taktlos wurde.
Den Kommerzienrat berührte es nicht. Vielleicht weil er fühlte, dass der andere so unrecht nicht hatte. Inmitten einer Welt, die ihn Tag für Tag in neue Kreise und Gesellschaften zog, lebte er im Grunde nur sein eigenes Leben, befand sich in seinem Kontor und in der Fabrik, auch wenn er festlich gekleidet an blumengeschmückter Tafel sass, traf Verfügungen, machte Überschläge und führte am nächsten Morgen zielbewusst aus, was er am Abend inmitten einer lustig lärmenden Gesellschaft Gedanken für Gedanken durchdacht und durcharbeitet hatte.
Die Leute um ihn störten ihn nicht. Für seine Person brauchte er nichts. Weder Menschen noch Gesellschaften. Dass er die ersten ertrug, die zweiten beinahe Abend für Abend über sich ergehen liess, dass er zu seiner vornehmen Villa in der Stadt noch das grosse Rittergut und Schloss Malkaymen für die Sommerzeit gekauft und sich bei seiner riesigen Tätigkeit die Unbequemlichkeit eines Doppellebens in der Stadt und auf dem Lande auferlegt hatte, das waren nichts als Zugeständnisse, die er seiner Ruhe halber an Frau und Kinder machte.
Ein Klopfen ans Glas störte ihn mitten aus einer Berechnung auf, die er fast zu Ende gemacht hatte.
Ein noch junger Mann in schwarzem Überrock und ebensolcher Krawatte, von der sich das feingeschnittene, ein wenig bleiche Gesicht scharf abhob, war von seinem Platz aufgestanden und begann zu reden. Es war Hans Hartau, der Pfarrer seines Kirchspiels, der Sohn des Alten, der seit vier Jahrzehnten die einträgliche Patronatsstelle Kokoschken des Kammerherrn von Oerzen innehatte, durch dessen warme Befürwortung nun auch der Sohn kurz nach bestandener Prüfung hier angekommen war.
Der Kommerzienrat hörte nur mit halbem Ohre zu. Das alles ging ihn so ganz und gar nicht an, es lag ausserhalb des Gebietes seiner Gedanken und Interessen. Aber mit einem Male wurde er doch aufmerksam — das zielte ja auf ihn, und aller Augen waren mit einem fröhlichzustimmenden Lächeln auf ihn gerichtet — richtig — dass er das im Augenblick ganz vergessen hatte! Heute war ja sein Geburtstag, und nur für ihn hatte die Liebe seiner Frau alle diese Menschen, die er jeden dritten Tag sah und von den meisten nicht mehr als ihren Namen wusste, um ihn her gesetzt!
Schon erhoben sie sich von ihren Sitzen, schon war Anneliese, sein jüngstes Töchterchen, an den Flügel geeilt ... nun kamen sie auf ihn zu, die Gläser mit dem schäumenden Wein in der Hand schwingend und dabei mit rauhen und mit zarten Stimmen die vom Flügel angestimmte Weise mitsingend, die er nie hatte ausstehen können: „Hoch soll er leben, lang soll er leben!“
Und er stand da, liess den ganzen Zug an sich vorüberziehen, ging den Damen einen Schritt entgegen, sprach zu jedem, der es hören wollte, ein höflich nichtssagendes Wort, und dachte in seinem Innern: Wozu ist das alles nur? Hat man in diesem Leben denn nichts anderes zu tun, als einige Fünfzig alt zu werden und sich dafür noch feiern zu lassen?
Jetzt trat auch Frau Adelheid, seine Gattin, zu ihm heran, breitete die weissgepuderten, mit Spangen und Edelsteinen geschmückten Arme ein wenig, eigentlich nur andeutungsweise, ihm entgegen, umarmte ihn ebenso andeutungsweise, hauchte einen symbolischen Kuss auf seine wuchtige Stirn und sagte: „Ich habe nur einen Wunsch für dich: dass du in deinem kommenden Jahr nicht mehr so viel arbeiten und dich einmal ordentlich ausruhen und pflegen möchtest — nicht wahr, du versprichst es mir, Liebster?“
Sie hätte ihm ebensogut eine Reise auf den Mond oder ein gutgehendes Zweiggeschäft auf dem Sirius wünschen können. Aber es hörte sich, mit so ehelich besorgter Stimme gesagt, doch nett an und verpflichtete zu nichts, weder ihn noch sie.
„Gewiss, gewiss, mein Schatz“, erwiderte er, schon wieder ganz in seine Gedanken versunken, in denen ihn der junge Pfarrer durch sein überflüssiges Glasklopfen eben gestört hatte.
Aber schon war auch Anneliese, seine Jüngste, bei ihm, hing sich mit der stürmischen Zärtlichkeit einer Vierzehnjährigen in seinen Arm, sagte ihm allerlei Liebes, und zuletzt, dass er ihr zu seinem Geburtstage das kleine Ponyfuhrwerk schenken möchte, das ihm gestern ein Händler in der Stadt angeboten hatte.
Gleich nach ihr erschien Dora, die älteste Tochter. Sie hatte weder die gesellschaftliche Gespreiztheit der Mutter, die, bei aller Bewunderung für den mit fabelhafter Schnelligkeit zu hohem Ansehen gelangten Gatten, nie vergass, dass sie, die hoch-, aber arm geborene Freiin Kippenreuter, einen Bürgerlichen geheiratet, noch die stürmische Zärtlichkeit der kleinen Schwester. Etwas Gereiftes und Gemessenes, das ihren neunzehn Jahren weit voraus war, lag über ihrem Gesicht wie über ihrer Haltung, wenngleich man es ihren Augen, die unter einer schöngemeisselten, dem Vater nicht unähnlichen Stirn und unter kastanienfarbenen Haaren träumten, auf den ersten Blick ansah, dass diese Gemessenheit ihrer eigentlichen Natur nicht ganz entsprach.
Sie beglückwünschte den Vater ohne jede Künstelei, aber auch ohne grössere Herzlichkeit, die sie weder für ihn noch für ihre Mutter empfand. Mit wirklicher Zärtlichkeit umfasste sie nur einen Menschen: ihre kleine Schwester Anneliese.
Obwohl die Sonne mit unbekümmertem Glanze vom Himmel strahlte, der die blasshelle Tönung abgestreift und eine dunklere angenommen hatte, zündete man die Kerzen auf den alten silbernen Armleuchtern an, dem einzig geretteten Erbstück aus dem in Trümmer gegangenen Hausschatze derer von Kippenreuter.
Aber die Sonne kümmerte sich um solche Massregeln wenig. Mit den grossen Siegeraugen lugte sie durch die Spalten und Falten der tabakbraunen Vorhänge, die man vorsorglich vor die hohen Fenster gezogen hatte, über die Gesellschaft dahin, liess ihre Lichter in lustigem Spiel über die weissgedeckte Tafel streifen und neigte ihr Antlitz zu den Blumen hinab, die ihr wie einer liebenden Mutter entgegendufteten, so dass die Kerzen auf den hohen, silbernen Armleuchtern aus dem Hausschatze derer von Kippenreuter bald eine etwas armselige Rolle spielten. Draussen sang wieder ein Vogel. Aber es war nicht mehr der wenig geübte von vorhin. Es war jetzt ein kunsterprobtes Mitglied der Grasmückenzunft, das sein Lied in quellender Fülle aus der Rotbuche ertönen liess.
Aber niemand hörte auf die liebliche Musik. Das lebhafte Gespräch übertönte sie und die wachsende Fröhlichkeit, insbesondere bei der Jugend. Hans Hartau, der die Tochter des Hauses geführt, wusste in seiner Unterhaltung den Ernst mit dem Humor gerade so geschickt zu mischen, wie vorhin in seiner Tischrede. Dazu verlieh ihm die Würde seines jungen Amtes, die er, ohne sie jemals ausser acht zu lassen, mit lässiger Anmut behandelte, eine gewisse Eigenheit.
Dora Vollprecht hatte, seitdem ihr ein junger Kandidat, der kurze Zeit als Anneliesens Hauslehrer in Malkaymen geweilt und sich von der ersten Stunde an unheilbar in sie verliebt hatte, so manche schöne Stunde durch seine Langweiligkeit und sein unmännliches Schmachten verdorben hatte, wenig mit Geistlichen im Sinne. Aber Hans Hartau hatte sie aus eigenem Antriebe zum Tischherrn erbeten.
Dass sie damit lediglich Theo Fortenbacher, ihren Vetter zweiten oder dritten Grades, strafen wollte, weil er sich vorgestern bei einem Gartenfeste auf Worditten eine kleine Keckheit gestattet hatte, die ihrer durchaus zurückhaltenden Natur nicht gefallen, das wusste die Mutter nicht, als sie ihrem Erstaunen über diese Wahl Ausdruck gab.
Der arme Junge! Er glaubte sich schon nahe am Ziel, das ihm halb seine Liebe, an der sie nicht zweifelte, halb aber auch sein Ehrgeiz, den ihre Klugheit ganz durchschaute, bereits seit einem Jahre gesteckt hatten. Sie kannte seine Pläne fast so gut wie er selbst: Er arbeitete mit grossem Eifer dem Assessor entgegen, weil er später einmal die Landratsstelle in Neukirchen zu bekommen hoffte.
„Aber sag mal, Theo“, rief Dora ihm zu, als er sich gerade mit seiner Nachbarin in seinen Lieblingsgegenstand, die Jagd, vertieft hatte, „hat dir der alte Bock an der Grenzlauer Grenze immer noch nicht den Gefallen getan? Lebensmüde ist er. Du kannst mir’s schon glauben.“
Sie hatte ihren Zweck erreicht. Er sah, über ihren boshaften Scherz wenig erfreut, mit einem halb verlegenen, halb bösen Blick zu ihr hinüber. Hatte sie ihn noch nicht genug gedemütigt? Anstatt dass sie ihm den Platz an ihrer Seite gab, auf den er sich bereits seit Tagen gefreut, hatte sie ihn hier neben die verblühte, geschwätzige Oerzen gesetzt, die er nicht ausstehen konnte, und die er doch nicht vernachlässigen durfte, weil ihr Vater einen grossen Einfluss im Kreise besass, mit dem er zu rechnen hatte.
Sie aber hatte nie so entzückend ausgesehen als heute in dem mattrosa Kleid, das so ganz in den wundervollen Junisonnentag passte und sich an sie schmiegte, als gehöre es zu ihrem Körper, dessen blühende Frische die leise über ihn ausgegossene Herbheit nur um so anziehender machte.
Und sie wusste das, wusste genau, dass er die ganze lange Mahlzeit über keinen Gedanken, keinen Blick gehabt hatte, der nicht ihr gehörte.
Nun fing er an, ihr doch ein wenig leid zu tun. Schräg über den Tisch warf sie ihm einen ulkigen Vers zu, den sie der bunten Hülle der eben gereichten Süssigkeiten entnommen, schickte ihm, als sie das Spitzglas mit dem zum Nachtisch gereichten Tokayer an die Lippen führte, ein huldvolles Lächeln hinüber und versetzte ihn durch beides in einen solchen Rausch des Entzückens, dass er alle Demütigung und Kränkung vergass und sich mit befreitem Antlitz und leuchtenden Augen an der Fröhlichkeit beteiligte, die rings um ihn her herrschte und bereits zur Ausgelassenheit geworden war.
Mit einem Male wurde diese auf unerwartete Weise unterbrochen.
Der hagere Johann hatte sich dem Stuhl der Hausdame genähert; und wenn man erst glaubte, er wollte ihr nach alter Gewohnheit ansagen, dass der Kaffee auf der Veranda bereit wäre, und schon die Gläser leerte und sich zum Aufstehen rüstete, so erkannte man bald, dass es doch etwas anderes sein musste. Denn Frau Vollprecht, die trotz aller freifraulichen Erziehung noch immer nicht gelernt hatte, ihre Miene auch nur einigermassen zu beherrschen, machte zuerst ein verdutztes, dann ein erschrecktes Gesicht, erhob sich und ging auf ihren Gatten zu. Der winkte möglichst unbemerkbar den alten Koriller, seinen ersten Wirtschaftsbeamten, der anlässlich der Familienfeier zur Tafel zugezogen war, zu sich heran.
„Schicken Sie sofort den Jagdwagen nach Neukirchen zum Geheimrat Beerwald“, sagte er, die starke Stimme zu einem Flüstern zwingend, „er möchte gleich zu uns heraus kommen. Spannen Sie flinke Pferde vor, vielleicht die beiden jungen Grauschimmel, und lassen Sie den Kämmerer mitfahren.“
„Der Geheimrat ist schon seit langer Zeit krank und fährt nicht über Land.“
„So bitten Sie Dr. Vulpius aus Bladow, es ist zwar ein Stück weiter ...“
„Den mögen die Leute nicht.“
„Wir können uns nicht an das kehren, was die Leute mögen oder nicht mögen“, erwiderte der Kommerzienrat, der Widersprüche gegen seine Anordnungen nicht liebte, bereits verdriesslich, „es kommt doch keiner mehr in Frage.“
„Höchstens der neue .. Doktor Torwald.“
„Wenn Sie keinen anderen bekommen, meinetwegen. Wir haben keine Zeit zu verlieren.“
Das Gespräch, so leise und schnell es auch geführt wurde, war der Gesellschaft nicht verborgen geblieben. Man empfand, dass etwas geschehen war, wusste aber nicht, was es war, ja, man hatte das Gefühl, dass die Gastgeber es mit Absicht verbargen, um der Festesstimmung keinen Einhalt zu tun. Aber Frau Vollprecht hob die Tafel ein wenig unvermittelt auf, und man sah, dass ihr Gesicht unter der kunstvoll hochgetürmten Haartracht besorgt und angsterfüllt dreinblickte.
„Gib doch auf Anneliese acht“, flüsterte sie Dora zu, als man auf die Gartenveranda hinausgetreten war. „Sie darf nicht auf den Hof oder gar ins Dorf. Sie muss immer bei uns sein. Sowie die Sonne untergeht oder es kühler wird, soll sie nach oben. Ich werde sie selber zu Bett bringen.“
„Ja, was ist denn geschehen? Du bist wie entgeistert, und auch der Vater ..“
„Wir haben eine schwere Epidemie im Dorfe.“
„Der alte Koriller sagte schon bei Tische, dass einige Krankheitsfälle vorgekommen wären.“
„Es lag kein Grund zur Besorgnis vor. Ich wollte Vaters Geburtstag nicht stören. Nun aber liess mir die Gemeindeschwester aus Neukirchen, die zufällig im Dorfe war und jetzt dort geblieben ist, eben durch Johann sagen, dass bereits zwei Kinder unter sehr schweren Anzeichen liegen.“
„Um wen handelt es sich?“
„Um die beiden Konradts im ersten Insthause.“
Der Diener erschien. Die kleinen Mausaugen unter den buschigen Brauen suchten seine Herrin.
„Die Krankheit hat sich bereits auf das zweite Haus erstreckt“, sagte Frau Vollprecht. „Die kleine Dörthe, die Jüngste vom Schmied Matthiessen, liegt im heftigsten Fieber.“
„Das ist ja wie ein Feuer.“ Doras Stimme klang nicht mehr so ruhig wie bisher.
„Ja, wie ein Feuer. Und dabei der herrliche, trockene Tag. Man sollte gar nicht glauben, dass bei solchem Wetter so furchtbare Krankheiten entstehen können.“
Wirklich, es war ein seltener Sommertag. In dem leisen flimmernden Schimmer der Sonne, die westwärts gezogen war, lag der Garten wie in weiche, warme Mutterarme gebettet. Von der Wiese drüben, über die die ersten leisen Schatten strichen, klang wie fernes Gesumme das Schwatzen der Leute, die sich zum Heimwege rüsteten.
„Wie wäre es mit einer Partie Krocket? Nach dem leckeren Geburtstagsessen tut solch eine sanfte Bewegung Leib und Seele gut“, wandte sich Theo Fortenbacher an Dora, derer er nach einigen Versuchen endlich habhaft geworden war. „Herr Pfarrer Hartau und die Baroness Oerzen sind auch dabei. Vielleicht nehmen wir noch Anneliese und den jungen Borke hinzu.“
„Krocket ist ein guter Gedanke. Nur sechs sind zu viel.“
„Dann lassen wir Anneliese und den kleinen Borke.“
„Nein, Anneliese spielt mit.“
„Zu Fünfen können wir nicht in Parteien spielen.“
„Allein ist man am stärksten.“
Die Reifen standen auf dem grossen, von wenigen Zierbüschen eingefassten Platz vor der Veranda immer aufgestellt. Die Kugeln waren schnell verteilt, die Partie nahm ihren Anfang. Alle fünf waren gute und geübte Spieler.
Die übrige Gesellschaft hatte sich im Garten und Park verteilt. Es war still auf dem Platze. Nichts hörte man als das Anschlagen der Hämmer an die Kugeln, ab und zu einen unterdrückten Ausruf, den laut zu äussern gegen die Malkaymer Spielregel verstiess, oder ein helles, schadenfrohes Lachen, das gestattet war.
Die kleine Anneliese beherrschte das Spiel. Theo Fortenbacher folgte ihr auf dem Fusse, überholte sie sogar einmal, blieb dann aber um ein beträchtliches zurück. Dora, die sonst die Meisterin war, spielte heute nicht mit der gewohnten Sicherheit.
Über die Dorfstrasse, die hart am Garten vorbeiführte, holperte ein Wagen, und durch die Bäume, die den niedrigen Zaun deckten, schimmerte das Grau der beiden jungen Schimmel, die Dora mit Vorliebe fuhr. Sie wusste, dass sie den Arzt brachten.
Die anderen hatten nichts davon gemerkt, sie waren in das Spiel versunken, in dem Anneliese immer noch die Führende war.
In seinem Arbeitszimmer stand der Kommerzienrat mit dem alten Koriller.
„Wer ist nun gekommen?“
„Doktor Torwald.“
„Und was sagt er?“
„Gar nichts. Er sagt nie etwas.“
„Will er wieder zurück?“
„Nein, er meinte, er müsste nach zwei Stunden noch einmal nachsehen. Da will er bleiben.“
„So bitten Sie ihn zu uns.“
Der alte Koriller rieb mit der dunkelbraunen Handfläche über den Mund und den borstigen Schnurrbart. Das tat er immer, wenn er nicht recht wusste, was er sagen sollte.
„Er wird nicht kommen“, meinte er schliesslich.
„Er wird nicht kommen? Was soll das heissen?“
„Hm .. er geht nie zu den Herrschaften. Beim Kammerherrn auf Worditten tat er es auch nicht, als der ihn einlud.“
„Sagen Sie ihm, ich liesse ihn bitten, mir als Gutsherrn über den Fall Bericht zu erstatten. Ich wünschte es.“
„Es wäre vielleicht ganz richtig, wenn er nicht käme“, meinte Frau Vollprecht, die, als sie den Inspektor in das Zimmer ihres Gatten treten sah, sogleich hinzugeeilt war. „Schon der Ansteckungsgefahr wegen nicht.“
„Ich bitte dich, bei einem Arzt!“
„Aber Anneliese lasse ich trotzdem auf ihr Zimmer gehen, es ist auch Zeit zum Schlafen für sie.“
Nach Anneliesens Ausscheiden entschloss man sich doch, in Parteien zu spielen. Dora bestimmte das Los Hans Hartau zum Partner, während Theo Fortenbacher zu seiner geringen Freude wieder mit seiner Tischnachbarin verbunden war. So wollte er Dora, die heute wenig auf der Höhe schien, zum mindesten ein gefährlicher Feind werden.
Aber Dora schien mit einem Male ihre Kraft wieder gewonnen zu haben. Sie ging in einem Zuge durch die Glocke, ja bis dicht an den oberen Pfahl und blieb dem siegessicheren Theo, der sich in seinem heissen Eifer gleich bei dem ersten Schlage vertat, völlig unerreichbar.
Da knarrte die Pforte, die zum Vorhof führte. Ein Fremder trat in den Garten, blieb eine Weile unschlüssig stehen, hielt nach den verschiedenen Seiten Ausblick und schritt dann auf den Krocketplatz zu. Er trug hohe Stiefel, unter denen der Kies knirschte, ein Mittelding zwischen Joppe und Jackett, einen von der Sonne ausgezogenen Filzhut über dem gebräunten Antlitz und glich in Kleidung wie im Aussehen einem Gutsinspektor.
„Wer ist denn das?“ fragte Theo Fortenbacher voller Erstaunen. „Und wie kommt der hierher?“
Schon stand der Fremde an seiner Seite. „Verzeihen Sie die Störung“, sagte er mit einer halb schüchtern, halb rauh klingenden Stimme, „aber Herr Vollprecht hat mich hierher gebeten.“
„Und wen darf ich Herrn Kommerzienrat Vollprecht melden?“
„Ich heisse Torwald und bin der Arzt aus Neukirchen.“
„Und Herr Kommerzienrat hätte Sie zu sich gebeten — gerade heute?“ gab Theo Fortenbacher, der keine Ahnung von den Vorgängen im Dorfe hatte, mit einer Verwunderung zurück, die wenig erfreulich klang.
„Ja, obwohl ich ihn wissen liess, dass ich nicht gerne käme. Und ich muss schon bitten, ihn recht bald von meinem Hiersein zu unterrichten.“
Er sagte es so bestimmt, dass Dora aufmerksam wurde, die am entgegengesetzten Ende des Platzes mit ihrer Kugel beschäftigt war, die durch den letzten Reifen sollte.
„Ich höre, dass Sie der Herr Doktor aus Neukirchen sind“, sagte sie schnell hinzutretend, „ich werde sofort meinen Vater benachrichtigen.“
*
In dem Esssaal war eine Tafel mit kalten Speisen aufgestellt. Man sass zwanglos an kleinen Tischen, auch auf der geräumigen Veranda, da der Abend warm und windstill war. Der Mond, der erst vor kurzem am Himmel aufgestiegen war, hüllte den Garten in seinen weichen Glanz und nahm allen Dingen das Körperhafte. Aber gegen das helle elektrische Licht auf der Veranda war sein Schein blass und bleich, und Garten wie Park lagen in seinen Armen still und starr wie Tote.
Um so lebhafter ging es auf der Veranda und im Esssaal zu. Die fröhliche Stimmung, die schon vorher an der Tafel geherrscht, nahm bei der vorzüglichen Erdbeerbowle ihren unbesorgten Fortgang, und auch Frau Adelheid war wieder guter Dinge, da sie ihre Anneliese oben auf ihrem Zimmer wohlig gebettet hatte und es ihrem Geschick gelungen war, ihren Gästen die ernsten Dinge zu verheimlichen, die sich in ihrer unmittelbaren Nähe abspielten.
Nur die Erscheinung des fremden Arztes, den man, wie Frau Vollprecht überall verkündete, eines Krankheitsfalles im Dorfe halber hatte rufen und zum Abendessen zuziehen müssen, fiel allgemein auf.
Ein Wunder war es nicht. Seine bäuerliche Kleidung in den hohen Stiefeln und sein Wesen, das, obwohl es keine Form verletzte, doch jeder in diesen Kreisen gewohnten gesellschaftlichen Kultur entbehrte, stachen gar zu sehr gegen die anderen Herren ab, die, bis auf die Lackschuhe und die seidenen Strümpfe hinunter, tadellos angezogen, sich mit einer ihnen zur zweiten Natur gewordenen Sicherheit bewegten.
Dora konnte ein Lächeln nicht unterdrücken, wenn sie sah, welche Überwindung es dem in allem Formenwesen sehr peinlichen Theo kostete, einmal das Wort an ihn zu richten, wie sich auch die anderen Herren mit fast beklommener Scheu um ihn herumdrückten und ihn nur, wenn es unumgänglich war, mit einigen gesuchten Redewendungen in ihre Unterhaltung zogen. Der einzige, der ihm mit völliger Unbefangenheit begegnete, war Hans Hartau, der ihn bereits zu kennen schien und ihm in seiner frischen Lebhaftigkeit allerlei Dinge aus der Gemeinde erzählte, während der andere meist schweigend zuhörte, wenig ass und auch von dem vor ihm stehenden Glase nur nippte.
Nachdem die kurze Mahlzeit beendet war und der hagere Johann mit Hilfe einiger Mädchen die Tafel abgeräumt und zur Seite gestellt hatte, setzte sich die ältliche Baroness Oerzen an den Flügel und spielte einen Walzer. Die Jugend begann zu tanzen, die Mütter sahen ihr zu, während sich der Kammerherr mit dem Kommerzienrat und zwei anderen Besitzern an den Spieltisch begaben.
Dora, die die ersten Runden mitgetanzt hatte, fühlte die Verpflichtung, sich nach dem fremden Gast umzusehen, um den sich zu kümmern jetzt wohl niemand Zeit hatte.
Sie fand ihn weder im Esssaal, noch in der Veranda und glaubte schon, er hätte sich unbemerkt davongemacht, als sie ihn, nur wenige Schritte vom Hause entfernt, nicht weit von der grossen Rotbuche, im Garten erblickte.
Er stand still, als wäre er in Gedanken versunken. Das Mondlicht, dessen Schein weisser und heller geworden war, umflutete seine Erscheinung und gab ihr etwas Körperloses.
Einen Augenblick zögerte sie, dann ging sie auf ihn zu.
„Das ist nichts für Sie“, sagte sie, indem sie leicht mit dem Kopf auf den erleuchteten Saal wies, aus dem die prickelnde Tanzweise und das Schurren und Hüpfen der Füsse durch die lichtschwere Stille tönten.
„Nein“, antwortete er.
Schon waren sie mit dem Gespräch zu Ende.
„Ich glaubte, als ich Sie nirgends fand, Sie wären zu den Kranken ins Dorf zurückgegangen. Aber die zwei Stunden sind wohl noch nicht um.“
„Ich wäre dennoch gegangen — wenn es nicht so schwer wäre.“
„So schwer? Für einen Arzt, der so etwas alle Tage muss?“
„Und doch ist es auch für ihn nicht so ganz leicht, dem Tode ins Antlitz zu sehen.“
„Dem Tode ins Antlitz zu sehen?“ wiederholte sie, und ein grosses Erschrecken war in ihrer Frage.
„Ja ... die Kinder sterben alle drei.“
„Sterben ... alle drei? Und das sagen Sie so ruhig?“
„Ich kann nichts dagegen tun. Glauben Sie denn, ich stünde noch hier bei Ihnen müssig im Garten, wenn ich noch eine Möglichkeit, zu helfen und zu retten, sähe?“
Sie hatte seine Worte kaum gehört. Vor ihrer Seele standen die drei Kinder. Sie kannte sie ganz genau. Die beiden Konradts im ersten Insthause waren Anneliesens liebste Spielgefährtinnen. Zwei Mädchen von zwölf und vierzehn Jahren mit Wangen wie von Blut und Schnee und mit so hurtigen, sröhlichen Bewegungen! Sie hatte sie noch gestern mit der Schwester diesen selben Gang hinauf, auf dem sie jetzt stand, um die Wette laufen sehen. Und nun ... es war ihr, als striche eine kalte, harte Hand über die Freude dieses Tages dahin, über alles Glück ihrer bis jetzt gedankenlos und sorgenlos verbrachten Jugend. Vollends mit dem Tode hatte sie sich noch nie beschäftigt. Und nun stand er mit einem Male vor ihr, schwer und unerbittlich ... in ihrer nächsten Nähe! Etwas Unfassbares war in alledem.
„Das können Sie aber doch nicht wissen“, sagte sie schliesslich, „jeder Arzt kann irren und hat gewiss oft geirrt.“
„Wenn ich doch irrte!“
„Gibt es denn ganz bestimmte Anzeichen für die Medizin, dass ein kranker Mensch nicht mehr zu retten ist?“
„Für die Medizin nicht. Aber für mich.“
„Für Sie? Für Sie allein?“
„Mag sein ... für mich allein.“
Er schien keine Neigung zu spüren, das Gespräch weiter zu führen. Mit einer raschen Bewegung wandte er sich um, als wollte er zum Hause zurückkehren. Aber sie rührte sich nicht von der Stelle.
„Nein“, sagte sie, „Sie müssen mir hierauf erst Antwort geben. Wie können Sie mit solcher Gewissheit behaupten, dass diese blühenden Kinder, die Sie doch vor einer Stunde zum ersten Male gesehen, rettungslos dem Tode verfallen sind ... alle drei?“
Er sah sie mit einem kurzen Blick an. „Ich hatte einen Vater ...“, sagte er langsam.
„Er war auch Arzt?“
„Ja und nein. Ich kann Ihnen das wirklich jetzt nicht so genau erklären. Wenn er zu einem Schwerkranken gerufen wurde, so sah er auf den ersten Blick, ob dieser sein Leiden überstehen würde oder nicht.“
„Das ist doch unmöglich. Woran konnte er es denn sehen?“
„An seinem Gesichte sah er es. An dem Ausdruck, der in ihm war. Und wohl auch an seinem Auge. Es war etwas medizinisch nicht zu Erklärendes. Es hat auch niemand zu erklären vermocht. Man hat ihn verlacht und angefeindet. Die Tatsache aber blieb bestehen, dass er sich niemals getäuscht hat. Das war das Unbegreifliche.“
„Es war also eine Art des Hellsehens?“
„Mag sein. Jedenfalls hat sich diese wunderbare Gabe auf mich vererbt. Ich weiss nicht, ob zu meinem Segen oder zu meinem Fluch. Ich glaube aber das letztere. Denn ich habe die Menschen lieb, und die Unmöglichkeit, retten und helfen zu können, wenn andere, auch die klügsten und tiefblickendsten unter meinen Kollegen immer noch hoffen ...“
Er brach ab. Eine tiefe Traurigkeit war in seiner Stimme, und seine Augen blickten über sie hinweg in die monddämmernde Nacht.
Auch sie stand eine kurze Weile unter dem Eindrucke seiner Worte. Dann aber raffte sich ihre gesunde Natur mit all der Energie auf, die ihr von Kindheit eigen gewesen.
„Und doch ... wäre ich ein Mann und hätte ich einen Beruf wie den Ihren, dann würde ich gegen diese Macht in meinem Innern ankämpfen bis zum letzten. Ja, wenn sie mir sagte, dass alles zu spät wäre, nur um so stärker würde ich mich wider sie auflehnen.“
Er lächelte. „Und Sie glauben, das hätte ich nicht getan? Jedesmal habe ich es versucht, mit jeder mir zu Gebote stehenden Kraft. Aber dann stand der andere neben mir, der mächtiger ist als alle meine Kraft und Kunst. Der sagte: ‚Lass die Hand von diesem Leben! Es gehört mir.’ Und so war es denn auch jedesmal.“
Nun überschlich sie doch etwas wie leises Grauen. Alte Geschichten, die sie in der Kindheit vernommen, dämmerten in ihr auf und spannen ihre Fäden durch die geheimnisschwere Nacht. Auch da stand der Tod mal zu Füssen, mal zu Häupten des Kranken. Stand er aber zu Häupten, so musste der junge Arzt, dessen Gevatter er war, jeden Versuch der Rettung unterlassen. Tat er das nicht, so war er selbst dem Tode verfallen.
Aber das war das Wunderliche bei alledem: Der Mann, dessen Gestalt und Züge sie im hellen Mondlicht mit ziemlicher Genauigkeit sehen konnte, hatte so gar nichts Geheimnisvolles oder gar Phantastisches an sich. Alles an ihm, sowohl an seiner Erscheinung wie in seinem Gesichte, war so einfach und schlicht, so ganz ungekünstelt und unangekränkelt: diese klare, gar nicht besonders hohe Stirn, das eckige Kinn, das ein dünner, mattblonder und wenig gepflegter Bart deckte, die grauen, ernsten Augen, aus denen viel Klugheit sprach, aber mehr noch eine grosse Liebe.
„Ich habe die Menschen lieb“, hatte er eben erst zu ihr gesagt. Und dass es keine Redensart gewesen, das war ihr in dieser Stunde klar.
„Aber die Kinder dort im Dorfe haben Sie gleich aufgegeben.“
„Bei ihnen ist nichts mehr zu hoffen“, gab er mit einer Schroffheit zurück, die etwas Erzwungenes hatte. „Bei den beiden im ersten Insthause handelt es sich um zwei aussichtslose Scharlachfälle ... das Gift ist bereits ins Innere gedrungen.“
„Und bei der dritten? Der kleinen Tochter vom Schmied?“
„Ist die Krankheit noch nicht so weit gedrungen. Aber auch sie kommt nicht durch.“
Ein unsagbares Furchtgefühl erfasste sie. Ihre Gedanken waren bei Anneliese.
„Ich habe eine Schwester.“
„Wie alt ist sie?“
„Vierzehn Jahre.“
„So schicken Sie sie fort .. unverzüglich ... heute abend noch!“
Er sagte es schnell und sehr bestimmt.
„Sie liegt oben, von allen abgesondert, auf ihrem Zimmer im Bette. Ich glaube, sie schläft schon.“
„Wecken Sie sie, nehmen Sie einen geschlossenen Wagen und fahren Sie mit ihr in die Stadt, gleichviel wohin, nur fort von hier! Es handelt sich in Ihrem Dorfe um eine schwere Epidemie, die aller Wahrscheinlichkeit nach weiter greifen wird. Und nun gute Nacht, ich will zu meinen Kranken; wenn ich auch nicht mehr helfen kann, so doch der Beruhigung halber.“
„Und ich werde ins Haus zurückgehen, damit diese entsetzliche Musik wenigstens aufhört. Für Ihren Rat bin ich Ihnen dankbar. Ich werde ihn meiner Mutter mitteilen, und es wird sicher alles befolgt werden, was Sie gesagt haben.“
Die Gesellschaft war bereits im Aufbruch begriffen. Aber Frau Vollprecht war nirgends zu finden.
Dora wechselte wenige flüchtige Worte mit Theo Fortenbacher, ohne zu hören, was er sagte, liess die gewohnten Liebenswürdigkeiten des alten, durch die Erdbeerbowle in den höchsten Grad der Weinseligkeit versetzten Kammerherrn über sich ergehen, beantwortete zerstreut einige Fragen, die der junge Geistliche an sie stellte, und machte sich, als er das Gespräch weiter ausdehnen wollte, mit einer kurzen Entschuldigung von ihm los, um nach der Mutter zu sehen.
Schon auf der Treppe kam ihr diese entgegen.
„Ich wollte dich eben rufen“, sagte sie, „ich weiss nicht, Anneliese macht einen so merkwürdigen Eindruck. Sie will es mich wohl nicht merken lassen. Aber ich glaube, sie hat noch nicht einen Augenblick geschlafen.“
„Lass sehen!“ erwiderte Dora und fühlte ihr Herz bis an den Hals hinan schlagen.
„Ich will indessen hinuntergehen und das Thermometer holen.“
Als Dora leise und behutsam in die Stube trat, hob Anneliese ein wenig den Kopf.
„Bist du es, Dora? Gott sei Dank, dass du kommst. Setze dich zu mir, nein, hier an mein Kopfende. Aber sei still, ich bitte dich, ganz still ... die Mutter quält mich mit soviel Fragen.“
Dora erwiderte kein Wort, nahm einen der kleinen Hocker, stellte ihn an das Bett und setzte sich zu seinen Häupten.
Das Licht auf dem Nachttisch war eingeschaltet und breitete seinen unter dem grünen Vorhang gedämpften Schein über das feine, zarte Gesicht der kleinen Schwester, aus dem alle Munterkeit geflohen war. Müde ruhten die beiden Hände auf der weissen Bettdecke, etwas Regungsloses war in der ganzen Erscheinung.
Draussen fuhren die Wagen vor, die Gäste verabschiedeten sich. Einige Male vernahm Dora des Vaters Stimme, der wohl Frau und Tochter entschuldigte. Aber sie hörte das alles nur von weitem her, wie im Traume ... es war alles so gleichgültig geworden.
Da mit einem Male öffnete Anneliese die Augen und sah die Schwester mit einem grossen, glänzenden Blick an: „Weisst du es schon, Dora? Hast du es schon gehört?“ sagte sie mit einer Stimme, in der ein leiser singender Ton war, wie er ihr nie eignete.
„Was soll ich gehört haben, liebste Anneliese?“
„Die Grete und die Mieze Konradt ... sind tot ... beide tot. Eben sind sie gestorben ... da unten in der kleinen Kate, in der ich noch gestern bei ihnen war.“
Dora hatte Mühe, das Erschrecken zu verbergen, das diese unbegreiflichen Worte in ihr hervorriefen.
„Wer hat dir das gesagt? Hast du es geträumt?“
„Nein ... nein ... nicht geträumt. Denkst du, ich habe nicht gehört, was der Johann der Mutter bei Tisch erzählte; dass sie beide krank wären, sehr krank. Und dass sie tot sind, das ... weisst du ... das fühle ich jetzt.“
Sie atmete tief und schwer. Dora sah, dass sie fieberte. Und doch, ihre Worte, so sehr sie sie anfangs erschreckt hatten, gaben ihr eine gewisse Beruhigung. Sollte es vielleicht nur die wohlverständliche Aufregung über die plötzliche Erkrankung ihrer beiden geliebten Spielkameradinnen gewesen sein, die die empfindliche Kleine in diesen krankhaften Zustand versetzt hatte? War es ihr eine Befreiung gewesen, sich endlich ihr gegenüber vom Herzen sprechen zu können, was sie der Mutter nicht sagen mochte?
„Nehmen Sie einen geschlossenen Wagen und fahren Sie mit ihr in die Stadt, gleichviel wohin ... nur fort von hier!“ Diese Worte kamen ihr nicht mehr aus dem Sinn. Es war jetzt vielleicht noch Zeit. Man konnte sie in ihre Kissen packen, hinuntertragen und in den Wagen heben, der draussen für sie bereit stand. Sie musste alles mit der Mutter besprechen und anordnen, so schnell als möglich.
Da stand auch schon Frau Vollprecht an der halb geöffneten Tür, winkte sie zu sich nach draussen und schloss die Tür.
„Die beiden Kleinen von Konradts sind eben gestorben“, flüsterte sie ihr zu. „Dass es nur Anneliese nicht erfährt!“
„Sie weiss es schon.“
„Sie weiss es schon?“
Dora berichtete der Mutter, was sich hier eben zugetragen.
„Aber eine Hoffnung“, fügte sie hinzu, „habe ich doch: dass diese seelische Erregung ihren Zustand beeinflusst hat. Sie macht jetzt schon einen besseren Eindruck.“
Frau Vollprecht atmete erleichtert auf.
„Aber um so schneller müssen wir handeln“, fuhr Dora fort. „Anneliese muss von hier fort ... heute, in dieser Stunde noch.“
Und nun erzählte sie, was ihr der Arzt mit so dringenden Worten zur Pflicht gemacht.
„Aber wir müssen ihn doch erst hören.“
„Wir wissen ja gar nicht, wo er jetzt ist, ob er überhaupt noch im Dorfe weilt.“
„Er ist beim Schmied Matthiessen. Mit der Kleinen soll es aussichtslos stehen.“
„Aber sie lebt noch?“ fragte Dora schnell.
„Ja, eben lebte sie noch.“
„Und wegen der Ansteckungsgefahr, die du vorhin für Anneliese so fürchtetest, hast du jetzt keine Bedenken?“
„Einen Arzt müssen wir auf jeden Fall haben. Einen anderen können wir nicht gut holen, abgesehen davon, dass wir ja auch gar keinen bekommen würden.“
„Ich weiss nicht,“ sagte da Dora nach einer längeren Pause, „ich habe eine so furchtbare Angst.“
„Angst ... wovor?“
„Vor diesem Menschen ... er sieht alles.“
„Es ist doch gut, wenn der Arzt einen scharfen Blick hat.“
„Ja, gewiss ... er sieht aber auch ...“, nein, sie bekam es doch nicht über die Lippen. Wozu die Mutter, die schon genug besorgt war, noch mehr beunruhigen? Sie musste es für sich behalten und mit sich allein abmachen.
„Wir können nicht wissen, wie lange er noch bei der Kleinen von Matthiessen zu tun hat“, sagte sie schliesslich. „Indessen versäumen wir hier die beste Zeit, und die Nacht schreitet auch vorwärts. Ich für meine Person würde die Verantwortung übernehmen.“
Da trat der Kommerzienrat, dem das lange Fortbleiben der Frauen unverständlich war, zu den beiden.
„Ohne den Arzt zu hören, können wir nichts unternehmen“, entschied er. Und dann zu dem Mädchen, das Frau Vollprecht gerufen hatte: „Sie gehen zu Herrn Koriller hinüber und bitten ihn, zu veranlassen, dass der Herr Doktor sich sogleich eines Krankheitsfalles halber zu uns bemüht.“
Nach einer kurzen Zeit kehrte das Mädchen zurück: „Der Herr Doktor ist augenblicklich beim Schmied beschäftigt. Er wird aber kommen, sowie es möglich ist.“
„Er hätte sofort kommen müssen“, grollte der Kommerzienrat. „Aber so sind diese Menschen!“
Eine qualvolle Zeit verstrich. Obwohl noch keine halbe Stunde vergangen war, dünkte es die beiden Frauen, die hier am Krankenbette sassen, indessen sich der Kommerzienrat wieder nach unten in sein Arbeitszimmer begeben hatte, eine Ewigkeit.
Ganz still lag die Kranke. Wenn sie auch immer noch nicht schlief, sondern zuweilen die Augen weit öffnete und sie mit grossem, verwundertem Blick in der Stube umherwandern liess, so blieb sie doch teilnahmslos und unempfänglich für alles, was um sie her geschah, ja, sie schien sich in keiner Weise zu wundern, dass ihre Mutter und Schwester an ihrem Bette sassen. Vielleicht sah sie sie nicht einmal.
Der Kommerzienrat, der unten in seinem Zimmer ebensowenig Ruhe gefunden, trat wiederum ein.
„Es ist unerhört!“ sagte er. „Ich habe noch einmal zu ihm geschickt.“
„Lebt die Kleine vom Matthiessen noch?“ fragte ihn Dora ganz leise.
„Ich weiss es nicht“, gab er kurz zurück.
Wieder verging eine qualvolle Zeit, wieder wurde die Minute zur Ewigkeit.
„Wenn er doch nur käme“, dachte Dora bei sich, „dass wir sie noch fortbringen können!“
Endlich ein etwas schwerer, aber behutsam auftretender Schritt die Treppe hinauf. Der Kommerzienrat öffnete die Tür, ging dem Arzt entgegen.
In derselben Sekunde richtete sich die Kranke in ihrem Bett empor und sah den Eintretenden mit weit aufgerissenen Augen an, in denen jetzt wieder der wunderbare Glanz von vorhin war.
„Wer ist der Mann?“ fragte sie Dora.
„Das ist der Herr Doktor aus Neukirchen.“
„Und was will er hier?“
„Er will dafür sorgen, dass du gesund wirst.“
„Dass ich nicht sterbe wie die Grete und die Mieze, nicht wahr?“
Was sie noch weiter sagte, blieb unverständlich. Ihre Stimme war sehr leise geworden, sie hatte sich in die Kissen zurückgelegt, und Doktor Torwald war dicht an sie herangetreten.
Einige Sekunden stand er ihr stumm beobachtend gegenüber, liess sie sich dann noch einmal aufrichten und die Brust freimachen, strich mit der schlanken Hand tastend über ihre Haut dahin, setzte auch das Hörrohr an, sprach bei alledem aber kein Wort, weder zu ihr, noch zu den ängstlich an ihrem Bette Harrenden. Dann streifte er ihr das Hemd wieder über die Brust, knöpfte es selber am Halse zu, legte ihr leicht die Hand unter das Kinn und schaltete das Licht anders ein, damit er eine hellere Beleuchtung erzielte und es sie zugleich nicht blendete.
Nun schaute er ihr ins Auge ... eine ganze, lange Weile.
Dora, die ihm gegenüber am Fussende stand, klammerte die Hand an die Bettlehne, so fest sie nur konnte, wandte aber nicht eine Sekunde den Blick von dem Arzte.
Der gab Anneliesens Kopf frei, legte ihn mit derselben Zartheit, mit der er alle seine Verrichtungen ausführte, in die Kissen zurück, zog das Bettdeck bis an den Hals hinan, streichelte die jungen Mädchenhände und sprach nun zum ersten Male während der langen Untersuchung zu ihr ... freundliche, aufmunternde Worte. Eine wunderbare Weichheit war in seiner Sprache und eine grosse Güte in allem, was er sagte.
Die Kranke kuschelte den fiebernden Kopf tiefer in die Kissen, ein Ausdruck stiller Geborgenheit lag auf ihren Zügen, und ihre Lippen lächelten dem Arzte leise zu.
Der strich ihr noch einmal mit der flachen Hand über die Stirn. Da sah Dora, dass die Schwester schlief — ganz fest und ruhig, wie sie den langen Abend über nicht ein einziges Mal geschlafen hatte.
Eine Frage brannte ihr auf den Lippen, sie drängte sie zurück. Eine unbeschreibliche Furcht hinderte sie, sie auszusprechen.
Dann hatte sie es doch getan.
Er sah sie mit seinen ernsten Augen an. „Es ist zu spät“, sagte er.
Sie fühlte den Boden unter ihren Füssen wanken. Aber sie überwand ihre Schwäche und hielt sich standhaft.
„Als Sie ihr in die Augen sahen ... nicht wahr?“
Er kämpfte einen schweren Kampf. „Sie haben mich missverstanden“, sagte er, sich ein wenig zu ihr hinabbeugend. „ich nahm an, Ihre Frage bezöge sich auf unsere Vereinbarung, nach der wir Ihre Schwester so schnell wie möglich von hier fortschaffen wollten. Dazu allerdings wäre es jetzt zu spät. Das wollte ich Ihnen sagen, weiter nichts.“
„Es ist Scharlach“, wandte er sich jetzt zu den Eltern. „Der Zustand ist ernst.“
Ganz still war es in dem Zimmer. Nichts hörte man als die unregelmässigen Züge der Schlafenden, die dann und wann erwachte, jäh von ihren Kissen in die Höhe fuhr und sich immer erst beruhigte, wenn der Arzt zu ihr trat und leise die Hand auf ihre fiebernde Stirn legte.
„Und was wird nun weiter werden?“ fragte der Kommerzienrat, der plötzlich aus allen seinen Berechnungen und Anschlägen hart aufgeschreckt war und sich weniger gefasst zeigte als seine Frau, die den Blick nur auf das Nächstliegende richtete und sich die Verhaltungsmassregeln genau einprägte, die der Arzt ihr gab.
„Ich werde die Nacht hier bleiben“, sagte dieser, „und meine Pflege zwischen Ihrer Tochter und der Kleinen drüben beim Schmied teilen, denn dort bin ich ebenso nötig.“
Er verabschiedete sich und trat in die Nacht hinaus.
Das Mondlicht war heller geworden. Es breitete sich wie ein silberdurchwirkter Teppich über die Wege, über die sein Fuss dahinschritt. Am Himmel flimmerten die Sterne. Die ganze Welt lag da wie das stillwirkende Geheimnis der grossen Gottesliebe.
In ihm war die Liebe Gottes nicht, in ihm war alles zerrissen und in Aufruhr. Seine Seele rang mit der fremden Gewalt, die nicht von Gott war, sondern von unten her auf ihn eindrang.
„Wenn du einmal Arzt sein wirst und dir die Wissenschaft zu eigen gemacht hast, über die dein Vater nicht verfügte, dann wirst du erkennen: die Wissenschaft ist es nicht, die dir die letzten Geheimnisse erschliesst. Und je mehr du weisst und erforschest, um so ratloser wirst du vor den verschlossenen Toren stehen.“
Wie manchesmal hatte es ihm der Vater gesagt.
Und er?
Als er heute abend an das Bett der beiden kranken Kinder im Insthause trat, da sah er es auf den ersten Blick, dass sie den nächsten Morgen nicht mehr erleben würden. Er ging in das Nebenhaus zu dem kleinen Mädchen des Schmiedes und sah dasselbe.
Und dann rief man ihn hinüber in das Herrenhaus. Er kam mit innerem Grauen, zugleich mit dem festen Willen, sich gegen diesen dämonischen Glauben zu wappnen — — aber was ihm aus den müden Augen dieses lieblichen, den Kinderjahren kaum entwachsenen Mädchens entgegenstarrte, war der Tod.
Er hatte es der Schwester, hatte es sich selber auszureden versucht — aber es war da und blieb und lachte seines Willens.
Konnte er noch Arzt bleiben? Konnte er von den Menschen ein Vertrauen zu sich und seiner Kunst verlangen, das ihm selber abhanden gekommen war? Das war die Frage, die ihn unablässig bewegte.
Vor ihm lag, vom weichen Mondlicht eingebettet, die Kate des Schmieds. Einen Augenblick zauderte er, dann öffnete er die niedrige Tür.
Er fand die kleine Kranke schlechter als er sie verlassen hatte, das Fieber war gestiegen. Die Eltern, deren einziges Kind es war, jammerten, sie schienen alle Hoffnung aufgegeben zu haben.
Er blieb zwei Stunden am Lager der Kranken, verrichtete alles selber und liess niemand anders an sie heran. Dann stellte er sein Wiederkommen noch in dieser Nacht in Aussicht und begab sich in das Herrenhaus.
Bereits auf der Diele trat ihm Dora entgegen.
„Wir haben schon auf Sie gewartet, Herr Doktor“, sagte sie mit schwer unterdrücktem Vorwurf. „Es ist schlechter geworden. Eben kannte Anneliese weder mich noch die Mutter.“
Er legte Hut und Mantel ab und folgte Dora in das Zimmer.
Völlig teilnahmslos lag die Kranke, die Augen weit geöffnet, in ihnen wie in dem glühenden Antlitz die Spuren des wachsenden Fiebers.
Er winkte der Mutter. Die erhob sich, und er nahm ihren Platz am Bett ein.
„Kennst du mich, Anneliese?“ fragte er mit leiser Stimme.
Aufrecht stehen Mutter und Schwester, wenden keinen Blick, halten den Atem an.
„Ja ... ich kenn dich.“
„Wer bin ich denn, Anneliese?“
„Du bist ... der Heiland.“
Und ein Schimmer zieht über das Antlitz, als glänzte er aus einem fernen, fernen Lande, wohin die grossen, sehnsuchtsvollen Augen blicken.
„Der Heiland ...“, hauchen die bebenden Lippen noch einmal.
„Und was will ich denn bei dir?“
„Du willst mich rufen.“
„Rufen, Anneliese?“
„Zu dir ... in den Himmel.“
„Und willst du kommen, Anneliese?“
„Ja, ich komme ... weil du gut bist und lieb.“
Er nimmt die Hand von der Stirn und legt sie auf die Stuhllehne, ganz fest, mit gespreizten Fingern.
„Sie ist ruhiger geworden“, sagt er nach einer langen Weile, „ich hoffe, sie wird schlafen. Aber es wäre gut, wenn sie jetzt allein bliebe. Sie legen sich vielleicht hier in der Nähe ein wenig hin. Ich wache bei ihr. Sollte es nötig werden, so lasse ich Sie holen.“
Dora widersetzte sich. Auch Frau Vollprecht zeigt keine Neigung, zu gehen. Er aber bleibt bestimmt. Da fügen sie sich.