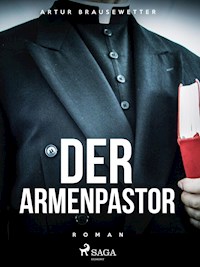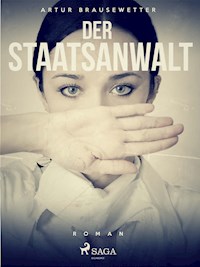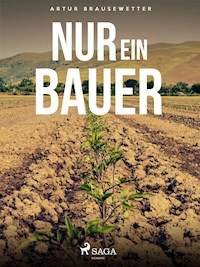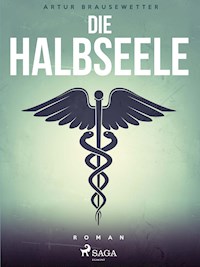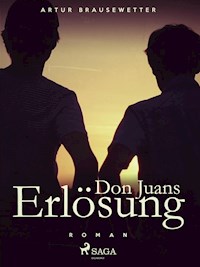Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Brausewetter, vielgelesener Schriftsteller Danzigs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nimmt in diesem Roman ganz Ostpreußen in den Blick und schildert den Kriegsbeginn 1914, als die russischen Truppen vordringen und das zähe Ringen um die ostpreußische Heimat beginnt. Im Mittelpunkt steht das ungleiche Brüderpaar Hans und Fritz Warsow. Fritz, der bodenständige Landwirt, zieht, ergriffen von der allgemeinen Begeisterung, alsbald in den Krieg. Hans, ein Gelehrtentyp, wird nicht Soldat, sondern entscheidet sich für ein Pfarramt. Aber gerade diese Aufgabe wirft Hans mitten hinein in die Kriegswirren, in denen er sich und seinen Glauben bewähren muss. Tapfere Frauen wie Else, seine Schwester, und Edith von Barnhoff, die Tochter des Herrn von Reckenstein, stehen ihm in den gefahrvollen Zeiten zur Seite.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Brausewetter
Wer die Heimat liebt wie du
Roman
86.—95. Tausend
Saga
Ebook-Kolophon
Artur Brausewetter: Wer die Heimat liebt wie du. © 1916 Artur Brausewetter. Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711448243
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
Sr. Exz. dem ReichspräsidentenGeneral-Feldmarschallvon Hindenburgin Dankbarkeit und Bewunderungzugeeignet
Was lange nicht in Reckenstein geschehen war, das geschah heute: man feierte ein Fest.
Edith, die einzige Tochter des alten Reckensteiner, die ihm seit fünf Jahren in Haus und Hof die früh heimgegangene Gattin mit Umsicht und Treue ersetzte, beging ihren einundzwanzigjährigen Geburtstag. Der Reckensteiner war für die Feste nie zu haben gewesen; in seiner Eintönigkeit lag für ihn des Lebens Sinn und Glück. Diesmal machte er eine Ausnahme; von ihm war die Anregung zu dieser Feier gekommen.
Klein war der Kreis der Geladenen: aus der Nachbarschaft Harro von Ubitzsch, hager, ernst, verschlossen, mit einer kleinen, gern ins Leere schwätzenden Gattin; von weiter her Dr. Werner Stoltzmann, der erste Bürgermeister von Rodenburg, der kurze Zeit in Königsberg Stadtkämmerer gewesen, und den für ihre aufblühende Stadt und nicht leichte Verwaltung gewonnen zu haben die Rodenburger Stadtverordneten mit Stolz zur Tat sich rechneten. Er war noch jung und von ausgesprochener Begabung, deren Bewusstsein sich in einem für seine vierunddreissig Jahre sehr sicheren Wesen und Auftreten prägte, das ihm von mancher Seite als Hochmut und Selbsteingenommenheit ausgelegt wurde. Wer ihn jedoch genauer kannte, wie der Reckensteiner und seine Tochter, der wusste, dass er im Herzen demütig und bescheiden war. Aber das Leben und die grosse Öffentlichkeit, in die es ihn so früh gestellt, mochten ihn gelehrt haben, dass in dieser Welt mit solchen Tugenden nicht viel anzufangen war.
Den ausgleichenden Gegensatz bildete seine Frau, eine hochgewachsene Brünette mit roten, runden, weichen Wangen, lachenden Augen und einer kühngebauten Nase mit ganz dünnen, feingezeichneten Flügeln, die, wenn sie sprach, leise zitterten. Aus einer alten rheinischen Offiziersfamilie stammend, hatte sich Frau Lisa vermöge einer tadellosen Erziehung in die steiferen norddeutschen Verhältnisse schnell eingelebt und durch ihr natürliches, warmherziges Wesen die Herzen aller Rodenburger im Fluge gewonnen, auch derer, die ihrem Gatten vorläufig noch wägend gegenüberstanden.
Edith, ernster, aber lebensbejahend wie sie, war ihr von einem Genfer Pensionsjahr eng befreundet, nun wurde der Verkehr, nachdem sie sich eines Tags hier wiedergefunden, möglichst aufrechterhalten, wenngleich man bis Reckenstein drei Stunden Eisenbahnfahrt hatte und die beiden Männer durch die Unterschiede von Alter und Gesinnung weit getrennt erschienen.
Der Tag war für die frühe Jahreszeit ausnehmend heiss gewesen. Als man sich in dem grossen Esszimmer zur Abendtafel niederliess, blieben die Fenster und die beiden Flügel der auf die Gartenveranda hinausführenden alten Eichentür weit geöffnet. Obwohl die Dunkelheit noch nicht eingetreten war, hatte man die Kerzen auf den mächtigen silbernen Armleuchtern angezündet, die, von den Urvätern geerbt, zu den schönsten Stücken des Reckensteiner Hausschatzes gehörten. Ihr im leichten Luftzug flackerndes Licht griff mit langen Fingern über die Frühlingsblumen dahin, die betäubend duftend die Tafel zierten. Durch die Fenster und die Tür aber drang das allmählich matter und dämmerungsstiller werdende Abendlicht. Und wenn die Unterhaltung einmal verstummte, dann vernahm man von draussen her das Lied einer Nachtigall in wundervollen, bald jauchzenden, bald schluchzenden Klängen.
Nun aber brach es ab, von einem lauten Ton, der seine weichen Melodien schrill abschnitt, zum Schweigen gebracht. Dr. Stoltzmann hatte an sein Glas geklopft und sich erhoben.
„Meine Damen und Herren,“ begann er in seiner etwas harten, aber des Wohlklangs nicht entbehrenden Sprache, „Sie wissen, dass ich mehr der Mann der sachlichen Rede als der wohlgestutzten Tafelsprüche bin. Die freundschaftliche Stellung jedoch, die wir zu unsern Gastgebern, die insbesondere meine Frau zu der Tochter dieses Hauses einnimmt, treibt mich heute, zugleich in ihrem Namen, in diesem Kreise auserwählter Freunde Fräulein Edith unsre Glückwünsche darzubringen. Es ist der Tag, an dem sie“ — er nahm einen Anflug, humoristisch zu werden, was ihm aber nie sonderlich gelang — „aus den Kinderschuhen tritt und unter die Erwachsenen aufgenommen wird. In ihren äusseren Lebensbeziehungen wird dies Ereignis wenig ändern. Und das ist gut; die in der Heimat wurzelnde und in ihr wirkende, die haus- und bodenständige Frau ist für mich die stärkste und tüchtigste. Wir freuen uns, dass unsre jugendliche Wirtin hier in ihrer schönen ostpreussischen Heimat, die seit einer Reihe von Jahren auch die meine zu nennen ich stolz und glücklich bin, auf der Scholle ihrer Väter ein Feld reicher Wirksamkeit und segenbringender Arbeit gefunden. Dass sie ihrer Tätigkeit, diese ihr in jener glückbringenden Enge und Weite zugleich erhalten bleibe, wie sie sie zum Wohle ihres Vaters, seines schönen Gutes und aller Leute, die in Reckenstein arbeiten, bisher mit ihrem lebensfrohen Sinn erfüllt hat, das ist mein Wunsch zu ihrem Geburtstage. Darauf bitte ich Sie, mit mir die Gläser zu erheben und zusammenstossen zu lassen in einem frohen und kräftigen Hurra für Fräulein Edith von Barrnhoff!“
„Hurra, hurra, hurra!“ tönte es von der Tafelrunde wider. Aber es war ein matter, ein beinah zerstreuter Widerhall. Schon die letzten Worte des Redners hatten keine Aufmerksamkeit mehr gefunden, ein andrer Klang hatte sich in sie hineingemischt, erst von der Ferne, dann näher und näher kommend: der Hall von Hufeisen, die mit eilendem Trabe auf das Pflaster der Auffahrt schlugen und nun — „Da hört sich ja alles auf!“ rief der Reckensteiner und sprang mit zornglühendem Antlitz von seinem Stuhl empor. „In meinen Garten reiten sie!“
„In unsern Garten?“ fragte jetzt auch Edith. „Das ist unerhört!“
Aber bevor sie oder ihr Vater nach draussen treten konnten, waren bereits zwei Reiter in der schmucken Offiziersuniform der Kürassiere über die kleine, den Garten vom Hof abschliessende Dornhecke gesetzt, in kurzem Galopp über den zu Ehren des heutigen Tages mit besonderer Sorgfalt geharkten Steig gesprengt und hielten plötzlich die schweisstriefenden Pferde unmittelbar vor den Holzstufen an, die zur Gartenveranda emporführten. Und immer noch nicht genug, jetzt zwangen sie die auf solche Kunststücke wohlgeübten Pferde die kleine Treppe empor, und ehe sich die Gesellschaft, die sich ausnahmslos von der behaglichen Abendtafel erhoben, von ihrem Erstaunen erholt hatte, standen sie mit ihren Pferden oben auf der Veranda. „Hurra, hurra, hurra!“ riefen sie, den rechten Arm erhebend, zehnmal so kräftig, als es eben erst die ganze Tafelrunde fertiggebracht hatte, und noch einmal: „Hurra dem Geburtstagskinde!“
Das alles war das Werk eines Augenblicks; so schnell und überraschend war es gekommen, dass niemand wusste, wie ihm eigentlich geschehen, und was dieser unbegreifliche Einfall bedeuten sollte.
„Fritz Warsow!“ hörte man da Ediths helle Stimme, und in ein heiteres, glückliches Lachen ausbrechend, streckte sie dem einen der beiden Reiter ihre Hand entgegen. Der war bereits abgesessen, grüsste und erwiderte ihren herzlichen Händedruck. Dann trat er zu dem alten Reckensteiner: „Verzeihen Sie diesen Überfall, Herr Major, aber ich musste meine Wette gewinnen. Und gestatten Sie mir, Ihnen und den Damen und Herren meinen Kameraden, Herrn von Uechteritz, vorzustellen, der mich als einwandfreier Zeuge begleitet hat, und dem ich Ihre Gastfreundschaft oft gerühmt habe.“
Auch der war längst aus dem Sattel gestiegen; ein herbeigeeilter Knecht nahm die dampfenden Pferde in Empfang und führte sie in den Stall. „Aber tüchtig abreiben und gut füttern, sie haben etwas geleistet!“ rief ihm Fritz Warsow nach und begab sich mit seinem Kameraden auf ein Fremdenzimmer, um sich nach dem schweren Ritt für die Tafel zurechtzumachen.
Sehr bald kehrten sie zurück und nahmen die ihnen eingeräumten Plätze, Herr von Uechteritz zwischen den beiden elternlosen Besitzerstöchtern, Fritz Warsow zwischen Edith und Frau Stoltzmann.
„Aber Ihre Wette, Herr Rittmeister!“ rief der Reckensteiner von der gegenüberliegenden Seite der Tafel. „Edith hat mir nie ein Wort davon erzählt.“
„Ich hatte sie völlig vergessen,“ gab diese zurück
„Ja, Ihre Wette!“ tönte es von mehreren Seiten zu ihm herüber.
„Ich hatte mit Fräulein von Barrnhoff vor einem Jahre, als ich ihren Geburtstag in unverantwortlicher Weise vergessen hatte, gewettet, dass ich bei der nächsten Wiederkehr dieses Tages zur Stelle sein würde, und wenn ich von meiner Garnison aus in einer Strecke bis in Ihren Esssaal hineinreiten müsste.“
„Und haben glänzend gewonnen!“ rief die temperamentvolle Bürgermeistersfrau, und ihre Wangen blühten wie die roten Nelken auf ihrer Brust. Solch ein Abenteuer und Reiterkunststück, das war nach ihrem Geschmack! Was sie noch hinzugewünscht hätte, und was ihr eigentlich fehlte, war, dass Fritz Warsow seine Wette nicht wörtlich ausgefochten und mit seinem Kameraden mitten ins Esszimmer gesprengt war. Und hätten sie dabei die ganze Tafel in Grund und Boden geritten! Der stürzende Tisch und die klirrenden Scherben — es wäre ein richtiger rheinischer Karneval gewesen, und der war das einzige, was sie bei aller Anpassung und Eingewöhnung im nüchternen Norden entbehrt und diesem bis zum heutigen Tage nicht verziehen hatte!
Aber auch der alte Reckensteiner schmunzelte behaglich vor sich hin. Das Stück gefiel ihm. Er hatte den Fritz immer gern gehabt. Er war ja selber Soldat mit Leib und Seele gewesen, alle Übungen hatte er mitgemacht, noch bis vor zehn Jahren. Dann hatte er aufhören müssen. Aber den Titel „Major“ hatte er erhalten und war stolz darauf. „Und wenn es einmal darauf ankommt, ich bin der erste, der mitmacht — am liebsten gegen die Russen!“ pflegte er zu sagen.
„Wie lange sind Sie unterwegs gewesen, Herr Rittmeister?“ wandte sich Frau Lisa aufs neue zu Fritz, und ihr frohes Auge lachte ihm voller Wohlgefallen entgegen.
„Acht Stunden, gnädige Frau, die kurze Mittagsrast nicht eingerechnet. Aber zuletzt sind wir auch wie die Teufel geritten, ich weiss nicht, trieb uns der Hunger oder die Sehnsucht.“
Edith kannte ihn sonst nur ernst, um so mehr gefiel ihr sein heiteres Wesen und der frische Humor, der ihm gut stand. Er war keine in die Augen fallende Erscheinung, vielmehr von untersetzter, beinah kleiner Gestalt, aber in seinem Gesicht war ein Zug von Kraft und Energie, und sein Blick war klug und gut zugleich.
Nun zog ihn Frau von Ubitzsch in ein sehr eingehendes Verhör. Eine Weile hielt er ihr geduldig stand, dann brach er ein wenig unvermittelt ab und beteiligte sich an der lustigen Plänkelei, die sein Freund Uechteritz mit zwei jungen Landdamen aus der Nachbarschaft eröffnet hatte. Aber mit wenig Eifer; er hatte hübsche Mädchen gern, doch das eigentlich Gesellschaftliche und der leichte Ton, den es erforderte, lag ihm nicht. Das Kräftige und Männliche seines Wesens paarte sich mit einer gewissen Schüchternheit, über die er schwer Herr wurde.
Es war stiller an der Tafel geworden. Aus dem Garten klang, nicht so laut und quellend mehr wie vorhin, aber mit noch süsserem Wohllaut, die Musik des Vogels, der das Hohelied der Liebe und Minne sang. War es Jubel oder Traurigkeit?
Man hatte nicht lange bei Tisch gesessen, der Garten da draussen lockte. Fritz Warsow ging an Frau Lisas Seite. Die warme Luft zitterte im Frühlingsblütenduft, ein wenig Mond war schon da: eine ganz schmale Sichel, die blass und milchweiss über den zackigen Wipfeln der Bäume hing. Etwas Geborgenes und Beruhigendes ging von dem scheidenden Tag aus, der Himmel war ein Spiel von aufglühenden und verlöschenden Farben. Vom Hofe her klang das Brüllen der Kühe, ab und zu auch das Wiehern eines Pferdes aus den Ställen. Alles war Stille und Frieden.
„So etwas kann man nur auf dem Lande haben,“ sagte Fritz Warsow, und mit einem Seufzer der Befreiung und Erleichterung, der aus einem aufrichtigen Herzen kam: „Hier ist man doch wirklich einmal Mensch!“
Frau Lisa war nicht ganz seiner Meinung; sie liebte auch das Land, aber sie liebte es wie ein Mensch, der nicht mit ihm verwachsen ist: mehr von der Ferne, wie ein angenehmes Schauspiel, dem man ein paar Stunden zusieht. Aber in der Seele gepackt und ergriffen ist man nicht von ihm; von seinen lösenden Geheimnissen, seiner tiefen Schöpferkraft hat man nie etwas erfahren, sein Atem ist einem nicht ins Herz gedrungen. Sie widersprach nicht, doch sie nahm die nächste Gelegenheit wahr, in ihrer munteren Beredsamkeit ein Loblied auf die Stadt zu singen, die die wirkenden Kräfte des Menschen im Zusammensein mit den andern, im frohen Wettstreit von Arbeit und Lust mehr wachrufe als das beschauliche Land.
Er liess sie reden und hatte sein stilles Gefallen an ihrer sprudelnden Begeisterung. Aber bei der Sache war er nicht. Als ginge er ganz allein durch diesen wunderbaren Abend, so gab er sich der Fülle seiner Eindrücke und dem linden Zauber hin, der aus jedem Beet, jedem Strauch zu ihm sprach.
Als sie in den Park einbogen, kam ihnen ein andres Paar entgegen: Edith an der Seite von Uechteritz, der in seiner frohen Soldatenart auf die Stillere einredete. Bald hatten sie die Plätze gewechselt, und keiner schien mit dem Tausch unzufrieden. Fritz ging jetzt mit Edith, und Frau Lisas helles Lachen klang wie helles Vogelgezwitscher zu ihnen herüber, während sie sich in die Tiefe des Parkes verloren. An dem Stamme einer alten Rotbuche, deren Zweige bis tief auf die Erde reichten, blieb Edith stehen: „Ist es wahr, Fritz, wirklich wahr?“
Er verstand sie sofort. „Ja,“ sagte er, „es ist wahr. Ich habe noch mit keinem darüber gesprochen. Aber du magst ein Recht haben, es zu erfahren.“
„Du gehst?“
„Ich habe gestern mein Gesuch eingereicht. Zuerst den üblichen Urlaub auf ein halbes Jahr oder länger. Doch das ist nur die Einleitung.“
„Und dann?“
„Nehme ich meinen Abschied — es scheint dich nicht angenehm zu berühren.“
„Ich erlaube mir kein Urteil. Aber ganz begreiflich ist es mir nicht.“
Ein Schatten flog über sein Antlitz. „Und ich glaubte, niemand würde es verstehen wie du.“
„Vielleicht, wenn du mir Zeit lässt, mich dareinzufinden — heute ist es mir etwas Fremdes. Du hast mich ja schon einmal schwerfällig genannt.“
Eine alte Erinnerung schien in ihm wach zu werden, er lächelte. „Glaubst du, dass es mir so leicht geworden? Unsre Naturen sind so unähnlich nicht. Ich habe lange genug mit dem Entschluss gerungen, jetzt ist er unabänderlich.“
„Eben jetzt, wo du befördert und nach Berlin in den Generalstab berufen bist.“
„Gerade deshalb gehe ich.“ Und als sie schwieg: „Man überschätzt meine Fähigkeiten. Ich kann nur gedeihen und wirken in der frischen Luft, in der Natur, auf dem Pferde, das durch Felder und Wälder fliegt. Die sitzende Lebensweise, das Arbeiten in der engen Stube ist nichts für mich.“
„Du hast deine Verdienste. Man würde deinen Wünschen Rechnung tragen, der Vater meinte es gestern erst.“
„Er irrt. Im Soldatenberuf gibt es kein Wünschen, sondern nur Gehorchen. Man bestimmt uns den Platz, wir wählen ihn nicht. Und es ist recht so. Will ich mein eigner Herr sein und mir ein Dasein zimmern, wie es meiner Eigenart entspricht, so bleibt mir nichts als das Gehen.“
Ein heimliches Dunkel schlich über die Wege. Unter den Bäumen war es kühl geworden. Ein Stern leuchtete auf.
„Und wenn man dich nun in deiner Garnison gelassen hätte?“
„Vielleicht wäre ich geblieben,“ erwiderte er nach kurzem Nachdenken, „vielleicht auch nicht. Sieh, Edith, es ist ein eigen Ding um den Beruf des Soldaten im Frieden. Er ist für den Krieg geschaffen.“
„Wer weiss, wie bald wir ihn haben werden!“
„Dann wäre es Lust und Glück, Soldat zu sein!“
„Und nun?“
„Es mag im Blute liegen,“ antwortete er, und seine Stimme war ernst, beinah schwer, „das klebt an der Scholle und kann nicht von ihr los. Es ist etwas in mir, das mich zum Lande drängt, auf dem ich grossgeworden, mit dem ich mich eins fühle. Die Grossstadt würde mich ersticken, die letzte Kraft in mir lahmlegen. Ein andrer kann es mir nicht nachfühlen, ich aber weiss es.“
„So ist es dein Ernst, Landmann zu werden?“
„Es stand mir seit Jahr und Tag fest, ich konnte nur nicht zum Entschluss kommen. Nun ist der letzte Zeitpunkt da, später wäre ich zu alt, um noch einmal in die Schule zu gehen.“
„Du willst nach Bärwalde zu deinem Onkel?“
„Ich gedenke morgen von hier herüberzureiten und das Nähere mit ihm zu besprechen. Wenn er auch jetzt kränklich ist und sich um die Wirtschaft nicht viel kümmert, so hat man doch viel von ihm, denn er ist klüger als all die andern und hat eine reiche Erfahrung. Und sein Inspektor, du kennst ihn ja, der alte Borowski, ist der beste Lehrer, den ich haben kann. Auch in dem steckt mehr, als sein schlichtes Wesen auf den flüchtigen Blick zeigt.“
Edith kannte Fritz, sie wusste, dass er nie von dem abzubringen war, was er sich vorgenommen. Sie schlug deshalb einen scherzenden Ton an, den er seit den Kinderjahren an ihr geliebt, und der von jeher so manches ernste Gespräch zwischen ihnen beschlossen hatte. „Höre mal, wenn du jetzt mit einem Male aus einer verheissenden Laufbahn herausgehst und ausgerechnet Landwirt wirst, und noch dazu bei dem alten kinderlosen Onkel in Bärwalde, was werden deine Kameraden sagen? Werden sie auch so harmlos an die Reinheit deiner Neigung glauben wie ich?“
Er lachte. „Du meinst, sie werden mich für einen geriebenen Jungen halten, der sich beizeiten das warme Nest sichern will. Du kannst ruhig sein, gegen einen solchen Verdacht bin ich gefeit. Bärwalde ist noch nicht Majorat, aber es ist stets als solches behandelt worden, man ist genau nach den Gesetzen des Alters verfahren. Und da Hans der ältere von uns beiden ist —“
„Hans? — Der?!“ fragte sie, und ihre Stimme hatte mit einem Male einen gleichgültigen, einen beinah geringschätzigen Klang. „Der kommt doch gar nicht in Betracht. Der lebt ja nur in höheren Gefilden und fühlt sich in seiner Dozententätigkeit von Herzen wohl. Er schreibt einen Aufsatz nach dem andern, man kann kaum eine Zeitung oder Zeitschrift aufschlagen, ohne seinen Namen zu lesen.“
„Du hast von seiner geistigen Tätigkeit nie sehr hoch gedacht.“
Sie schürzte die Lippen. „Sie liegt uns, sie liegt euch Bärwaldern allen eigentlich sehr fern. Es ist etwas — ich möchte dich oder ihn nicht verletzen, aber ich kann mich nicht anders ausdrücken — etwas nicht ganz Männliches in ihr. Ihr, eure Vorfahren, alle, wie du mir so oft erzählt, bebauten ihr Land oder führten das Schwert. Er studierte Theologie und Philosophie und wer weiss was noch und wurde ein Held der Feder.“
„Es war sein Steckenpferd schon auf der Prima. Und du kannst nicht leugnen, dass er es zu etwas gebracht hat. Sein Name ist weithin bekannt geworden.“
„Das mag sein. Ihr, und besonders du in deiner übergrossen Bescheidenheit, habt ja immer wer weiss was aus ihm gemacht. Aber mir scheint deine Tätigkeit wertvoller, selbst wenn du Landmann wirst, kann ich es auch unter diesen Umständen noch viel weniger verstehen.“
„Dann muss ich es eben ohne deine gütige Zustimmung wagen.“ Ein abweisender Ton, wie sie ihn nie von ihm vernommen hatte, war in seiner Antwort. „Aber was Hans betrifft, so tust du ihm unrecht, hast es immer getan. Und das verdriesst mich.“
Sie zuckte die Achseln. „Was weiss ich von ihm? Er ist über fünfzehn Jahre älter als ich und hat sich nie um mich gekümmert. Du nahmst dich als Junge der kleinen Nachbarstochter ritterlich an und warst später mein Tänzer in Rodenburg und auf den Gütern hier. Er war immer der Erhabene, stand immer abseits. Er spielte als Junge nicht und tanzte nicht als Mann. Seine Bücher waren ihm die Welt und sein Ehrgeiz. Was galt ihm Reckenstein, ja selbst Bärwalde?“
„Alle Ferien, jede nur erdenklich freie Zeit verbrachte er in Bärwalde.“
„Jawohl. Er sass oben auf seiner Stube, allenfalls mal im Garten und schrieb seine Bücher!“
„Ganz recht. Er schrieb sein Werk über Ostpreussen,“ gab er mit scharfer Betonung zurück und fuhr fort: „Es lag ihm als Theologen fern und ist nach dem Urteil aller Fachleute das Beste, was je über unsre Provinz geschrieben ist. Nein, du kennst ihn nicht, Edith. Er schloss sich ab — es war einmal seine Anlage. Aber in ihm ist dasselbe Blut und dieselbe Sehnsucht wie in uns. Niemand liebt seine Heimat wie er.“
Seine ernsten Worte machten vielleicht einen gewissen Eindruck auf sie, überzeugten sie aber nicht. „Du erzähltest einmal, dass er ordentlicher Professor in Königsberg werden sollte. Wie ist es eigentlich damit geworden?“
„Er scheiterte im letzten Augenblick an irgendeiner Richtungsfrage, die in der Theologie ja immer eine Rolle spielt. Er hat es nie überwunden. Ich glaube —“ Er wollte noch etwas hinzufügen, brach jedoch ab und sagte: „Nun haben wir immer nur von mir und von uns gesprochen. Aber von deinem Vater hast du mir noch nichts gesagt. Wie steht es um ihn?“
Ein Schatten flog über ihr Antlitz. „Er will nichts aufkommen lassen, beileibe nicht! Darum nimmt er sich zusammen, oft wohl über seine Kraft, besonders wenn Besuch da ist. Aber ich weiss am besten, dass er seit dem Tode der Mutter nicht mehr der Alte ist. Den Sommer bekomme ich ihn hier nicht los. Er kann sich von der Wirtschaft nicht trennen und sitzt jeden Tag noch zu Pferde. Er will in der Übung bleiben, wie er sagt. Aber zum Winter müssen wir nach Rodenburg, Geheimrat Faber will eine regelmässige Behandlung mit ihm vornehmen. Hoffentlich hilft sie.“
Durch den stillen Park hallten helle Rufe. Jetzt erst merkten sie, dass ihr langes Fortbleiben aufgefallen, dass die Nacht vorgeschritten war. Sie schickten sich an, in das Haus zurückzukehren. Aber bevor sie auf die Veranda traten, sagte Edith: „Erzähle mir doch das noch schnell von Hans! Du führtest deinen Satz vorhin nicht zu Ende. Was glaubst du?“ Er besann sich: „Ich glaube,“ sagte er dann, „dass seine fehlgeschlagene Königsberger Hoffnung massgebend für einen Entschluss geworden ist, den ihm niemand zugetraut hätte.“
„Was für einen Entschluss?“
„Ich darf darüber nicht sprechen. Selbst dir gegenüber nicht, Edith, so gern ich es täte. Vielleicht teilt er ihn dir selber mit.“
„Er wird mich dieser Ehre kaum würdigen.“
„Vielleicht doch. Er kündigte mir sein Kommen nach Bärwalde in einigen Wochen an und schrieb auch von einem Besuch in Reckenstein.“
Sie waren in das Haus getreten. Uechteritz stand am Flügel und sang Schumannsche Lieder. Er hatte eine weiche Baritonstimme, die sich in die Seelen der Frauen stahl und in ihnen haftete, oft mehr als seiner kleinen eifersüchtigen Frau lieb war. Frau Lisa begleitete ihn, die andern waren ganz Ohr, nur der Reckensteiner sass mit Rodenburgs erstem Bürgermeister in dem abgelegeneren Herrenzimmer bei einer Flasche Rotwein und verhandelte in jener gespannten Art, die ihren Gesprächen meist zueigen war, politische Fragen. Sie wussten beide, dass sie dabei nie zu irgendeinem Schluss kommen würden, fingen aber doch jedesmal davon an, vielleicht weil sie sich über andre Dinge noch weniger geeinigt hätten.
Edith war mit ihrem Vater über die Felder geritten. Der alte Herr hatte noch auf dem Vorwerke zu tun, und sie war, da sie die endlose Ausdehnung seiner Gespräche mit dem Hofmeister aus langjähriger Erfahrung kannte und fürchtete, auf geradem Wege nach Hause geritten.
„Ein Herr wartet bereits seit einer halben Stunde auf die Herrschaft,“ meldete der Diener und reichte ihr die Karte. „Lic. Dr. Hans Warsow, Privatdozent. Bonn“ las sie.
Im Herrenzimmer standen sie sich gegenüber. Er im schwarzen Überrock und mit schwarzer Binde, ebenso ernst wie tadellos angezogen. Sie noch im Reitkleide, die Mütze mit einer Nadel mit blitzendem Knauf durch die dichten Haare gesteckt, die eine braune, leise ins Rötliche schillernde Farbe hatten. Etwas von dem matten Glanze herbstlichen Laubes war in ihnen. Auf den roten Wangen lag noch die Spur der frischen Bewegung.
Sie sah Herren im langen Überrock fast nie, auf den Gesellschaften trugen sie den Leibrock, allenfalls den Halbfrack, sonst das helle Jackett, wie es auf das Land gehörte. Er kam ihr wunderlich vor in dieser würdevollen Gewandung, so feierlich und gemessen. Aber nichts war ihr verhasster als das Feierliche.
„Ich bringe Ihnen Grüsse von Fritz,“ sagte er, indem er auf ihre Einladung Platz nahm. „Ich muss doch irgendeine gute Einführung bei Ihnen haben, denn obwohl wir oft genug Nachbarn waren, haben sich unsre Kreise wenig berührt.“
„Sie hatten bessere Dinge zu tun,“ gab sie leichthin zurück, indem sie die Reitmütze aus den Haaren löste.
„Bessere nicht,“ erwiderte er ruhig und offen, „aber wichtigere, ich gebe es gern zu. Ich war und bin bis zu einem gewissen Grade vielleicht heute noch mit der Krankheit behaftet, die jeden harmlosen Genuss zerstört: das Leben und seine Pflichten ernst zu nehmen. Ich glaube, es ist Egmont, der einmal sagt: ‚Wenn ihr das Leben gar zu ernst nehmt, was ist denn daran?‘ Sehr richtig — aber man kann eben nicht anders, das ist das Unglück.“
„Sie haben dafür auch Ihren Lohn empfangen: Sie sind ein bekannter Mann geworden, wie Ihr Bruder Fritz es mir erst vor einigen Tagen auseinandersetzte. Ich für meine Person lese wenig, auch Ihre Bücher und Schriften kenne ich nicht, damit ich es gleich sage.“
„Bekannt bin ich nur in einem sehr kleinen Kreise; dass mein Leben von besonderem Glück begleitet gewesen, kann ich kaum sagen.“
Sie sah ihn an, zum erstenmal. Er hatte gar keine Ähnlichkeit mit dem jüngeren Bruder. Sein bleiches Gesicht war klug und anziehend, aber die kräftige und energische Spannung, die ihr Fritzens Züge so lieb machte, fehlte ihm; es lag zuviel des Verträumten und Versonnenen in diesem Antlitz, sie liebte die harten, eckigen Stirnen bei den Männern mehr. Die Tat war ihr das, was dem Manne Wert verlieh, nicht der Gedanke. Er hatte von jeher für sie etwas Untergeordnetes besessen.
„Sie wissen, dass Fritz im Begriff ist, umzusatteln,“ sagte Hans Warsow, wohl in dem Wunsche, dem Gespräch eine sachlichere Wendung zu geben. Ihr aber war, als hätte er aus ihrem Blick gelesen, was sie eben im stillen empfunden hatte. „Und dass er sich in Bärwalde bereits in seinem neuen Beruf einlebt, wissen Sie wohl auch?“
„Er teilte es mir mit, als er unerwartet an einem Abend hier erschien.“
Der Gedanke an diesen Abend, an Fritzens Ankunft hoch zu Pferde, hier oben auf der Veranda, wachte mit solcher Lebendigkeit in ihr auf, dass ein heiteres Lächeln über ihren hübschen Mund flog. Sie erzählte den Vorfall. Aber er ging nicht auf ihre Heiterkeit ein, im Gegenteil, er wurde noch ernster, und sein Gesicht erschien ihr in der leise einfallenden Dämmerung einen Schatten blasser und finsterer als bisher.
„Das sieht ihm ähnlich! Obwohl er alt genug wäre, sich solche Streiche abzugewöhnen.“
Sie ärgerte sich über seine Worte. Das war Hans Warsow, genau wie er in ihrer Erinnerung stand, wie sie ihn oft vom Vater, der ihm wenig wohlwollte, hatte schildern hören: von sich eingenommen und von hoher Warte herab das Tun der andern abfällig beurteilend. Wie nett, ja mit welcher Bewunderung und Liebe hatte Fritz von ihm gesprochen! Und er? Er nahm die erste Gelegenheit wahr, den jüngeren Bruder in ihren Augen herabzusetzen.
„Ich glaube, Ihr Urteil über Ihren Bruder ist nicht ganz gerecht. Fritz ist im Grunde seines Wesens ernst, zu ernst beinahe. Dass er dann einmal einen lustigen Reiterstreich wagt und im frohen Kreise auch froh sein kann, macht ihn für mich nicht schlechter. Ich liebe die Menschen nicht, die nicht einmal aus Herzensgrund lachen können.“
„Und zu ihnen zählen Sie mich?“
„Ich habe nicht die Freude, Sie so gut zu kennen, um mir ein Urteil über Sie zu gestatten.“
Sie sagte es in jener kalt abweisenden Art, die ihr immer zu Gebote war, wenn sie sich verletzt fühlte.
„Aber Ihr Wort traf mich, denn Sie haben recht gesagt: so aus dem Herzensgrunde lachen, wie Sie sich ausdrückten, habe ich nie gekonnt — von meiner Kindheit an nicht. Und niemand hat das wohl so schwer empfunden wie ich selber.“
Ein leiser Zug von Mitgefühl flog über ihr Antlitz. Er wollte es nicht, man merkte es ihm an, dass es ihm nicht angenehm war. Ein befangenerer Ton kam in ihre Unterhaltung.
„Dass Ihr Bruder, jetzt auf einem gewissen Höhepunkt seiner Laufbahn angelangt, den Mut hat, mit ihr zu brechen,“ sagte Edith nach einer kurzen Pause, „und sich ein ganz neues Leben durch eigne Kraft aufzubauen, spricht doch auch für den Ernst seiner Anschauungen.“
„Nein, nein!“ fiel er mit plötzlich erwachter Lebhaftigkeit ein, „das ist es nicht. Das wenigstens nicht allein. Es ist ein andres — dasselbe wie bei mir. So verschieden wir auch sonst in unsrer Lebensanschauung sind, hierin sind wir von einem Schlag.“
„Und was wäre dieses andre?“
Eine leise Glut war in sein Antlitz getreten. Sie färbte es nicht rot, aber sie gab ihm einen Hauch der Wärme, den es bisher nicht besessen. „Sehen Sie, ich bin weit in der Welt umhergekommen und habe viele Leute und Länder kennengelernt. Als ich meine Prüfungen bestanden, erhielt ich ein grösseres Stipendium, das mich in den Stand setzte, in Griechenland und in Italien Studien zu machen.“
„Ich hörte davon durch Ihren Bruder. Wieviel des Schönen müssen Sie gesehen haben!“
„Gewiss. Ich verkenne das auch nicht. Unvergessliches empfing ich in Athen, Florenz und Rom. Gerade in dem Alter, in dem man dafür am empfänglichsten ist, öffneten sich mir die Schätze der Welt. Mein Wissen erweiterte sich, mein künstlerischer Sinn erhielt reiche Anregung. Und dennoch kam ich auf allen diesen Reisen nie zu einem wirklichen Genuss. Ich suchte ihn zu erzwingen, war ärgerlich und empört über mich selber — es war alles vergeblich. Wie ein Kranker wanderte ich durch die herrlichen Uffizien und die alten Bauwerke der Städte.“
„Es war das unaufhörliche Empfangen neuer Eindrücke; das greift an die Seele. Ich habe Ähnliches, wenn auch in geringerem Massstabe erlebt. Als der Vater bald nach dem Tode der Mutter mit mir eine Reise nach Italien machte, hatte ich auch nicht annähernd den Genuss, den ich mir versprochen hatte.“
„Ich sah, dass es nicht so weiterging, und suchte einen festen Wohnsitz. Zuerst blieb ich ein Jahr in Rom dann ein zweites in Florenz, eine Zeitlang lebte ich, mit einer grösseren Arbeit über die Anfänge des Christentums in Rom beschäftigt, in der Schweiz, in Zürich und Bern — schliesslich ging ich nach Deutschland zurück.“
„Sie liessen sich in Bonn nieder?“
„Ja, meine Arbeit war erschienen, man ermunterte mich, dort Vorlesungen zu halten!“
„Und nun kamen Sie zur Ruhe?“
„Nein — ich kam auch hier nicht zur Ruhe, ich fühlte mich ebenso friedlos wie dort im Süden. Ich habe viel gearbeitet in dieser Zeit, ich darf es wohl behaupten. Es war wie eine Notwehr gegen das, was in meinem Inneren gärte. Und nun will ich Ihnen auch sagen, was es war.“
Er fuhr ruhiger, aber mit einer Bewegung fort, die durch jedes seiner Worte bebte: „Wir Leute hier oben aus dem Nordosten können im Süden nicht gedeihen, und auch nicht im Westen. Dort ist alles weich, geglättet, eben; bei uns ist es uneben, scharf und kantig. Aber gerade weil es so ist, lieben wir dies Land mit einer Zähigkeit und Kraft, von der die Leute im Süden und im Westen keine Ahnung haben. Und wenn wir uns von ihm trennen und suchen die Gegenden Süddeutschlands oder gar des blühenden Italiens — gewiss, wir sind nicht blind für die Schönheit dort, die uns auf Schritt und Tritt entgegentritt. Aber wir können das alles nur geniessen und uns seiner freuen für eine kurzgemessene Zeit, für eine Ferienfrist. Dann erwacht nur um so stärker die Liebe zur Heimat. Dann erscheint uns inmitten all der Weichheit der Luft und Linien, all der landschaftlichen und künstlerischen Pracht unser kantiges, knorriges Land nur um so liebenswerter und herrlicher. Dann müssen wir zurück, nordwärts, in den hohen Osten, in die härtliche, stählerne Luft, ohne die wir nicht gedeihen können. Und wenn wir diesen Trieb unterdrücken und ihm Gewalt antun, dann werden wir krank, wie es mir ergangen ist.“
Sie hatte ihm mit wachsender Anteilnahme zugehört, es sprach eine solche Tiefe und Aufrichtigkeit aus jedem Wort, er war ihr plötzlich ein ganz andrer erschienen. „Wunderbar“ — aber dann stockte sie; nein, das konnte sie ihm doch nicht sagen —
„Sie hätten mir das alles nie zugetraut,“ ergänzte er sie ohne jede Spur von Empfindlichkeit. „Aber es ist nun einmal so, und ich kann es nicht ändern. Seit drei Jahrhunderten sind die Warsows hier eingesessen. Bärwalde ist nie aus ihren Händen gekommen. Sie haben es gehalten auch in den bittersten Zeiten, den schwersten Kriegsnöten, haben entbehrt und gelitten, nur um nicht einen Zollbreit von der heimatlichen Scholle zu weichen. In meiner Geschichte Ostpreussens ist die ausführliche Chronik Bärwaldes und der Warsows enthalten. Sie ist bewundernswert in ihrer Kraft und in ihren Leiden.“
„Fritz hat mir oft davon erzählt. Aber ich ahnte nicht, dass Sie das alles noch viel genauer wussten. Ich hielt Sie für einen Mann des Geistes, einen Helden der Feder, der sein Vaterland da fand, wo er schreiben und schaffen konnte.“
„Gewiss, ich bin ein Mann des Geistes. Die Probleme unsrer Zeit, die Fragen des Glaubens und Wissens brennen in meiner Seele, und ich will sie verkünden von dem Lehrstuhl oder von der Kanzel, so lange ich kann. Aber ich bin vor allem Ostpreusse mit Leib und Seele. Und es gibt nur ein Land, in dem sich meine geistigen Fähigkeiten fruchtbar entwickeln können. Das verstehen die andern nicht; sie haben mich oft deshalb gehänselt. Nur wir wissen es, die wir das ostpreussische Blut in den Adern tragen von vielen Geschlechtern her, die wir diese Luft geatmet von Geburt an, uns vom Mark dieser Erde genährt haben.“
„Deshalb war es Ihr Wunsch, einen Lehrstuhl in Königsberg zu erhalten?“
Es war nicht sehr zart von ihr, ihm das zu sagen, gerade jetzt nicht. Sie wusste es und tat es doch. Eine kleine Demütigung konnte ihm nicht schaden.
Er antwortete fast gleichmütig: „Fritz hat Sie gut unterrichtet. Ja, ich hoffte es einmal und war sehr enttäuscht, als sich die Sache zerschlug. Aber ich fand mich bald. Mir waren inzwischen Bedenken aufgetaucht, ob es richtig wäre, mein ganzes Leben der akademischen Laufbahn zu widmen.“
„Ich glaubte, eine andre würde für Sie gar nicht in Betracht kommen.“
„O doch. Eigentlich wiesen mich meine Neigung, vielleicht auch meine Fähigkeiten mehr auf die des Pfarramts. Gerade während meiner Dozentenjahre in Bonn waren mir neben den Vorzügen auch die Mängel dieser Tätigkeit klar geworden. Ich entbehrte die Berührung mit den grossen Volkskreisen, in die ich meine Gedanken und Ziele wirksamer tragen konnte als in einen kleinen Kreis von Studenten. — Ich war heute vormittag in Rodenburg. Deshalb sehen Sie mich auch in dieser feierlichen Gewandung. Da ich guten Anschluss hatte, fuhr ich mit dem Schnellzug hierher. Fritz wollte mich heute abend von hier nach Bärwalde abholen lassen. Vielleicht kommt er auch selber.“
Ein Schimmer der Freude flog über Ediths schöne Züge. Er entging ihm nicht. Diese letzten Worte schienen ein stärkeres Interesse in ihr auszulösen, als alles, was er ihr bisher erzählt hatte. Nun aber wandte sie sich wieder seiner Angelegenheit zu:
„Sie waren in Rodenburg? Ich verstehe nicht, in welchem Zusammenhange das mit dem stehen kann, was Sie mir eben sagten.“
„In einem sehr einfachen. In Rodenburg wird die erste Stelle an der Nikolaikirche frei. Ich habe mich um sie beworben.“
„Sie? In Rodenburg — und an der Nikolaikirche?“
Ein helles Erstaunen lag in ihren Worten, die sie einzeln und in grösseren Zwischenräumen hervorbrachte.
„Das scheint Sie wunderzunehmen —?“
„Ja, grosses — Sie, der Mann von Geist, zu dem Fritz mit einer Ehrfurcht emporblickt, die mir — verzeihen Sie! — manchmal rührend, manchmal ein klein wenig komisch erscheint. Sie, das Licht der Familie Warsow, dessen Bücher und Schriften ich nicht zu lesen wagte, weil sie mir zu hoch für meinen dürftigen Geist erschienen. Sie — einfacher Pfarrer in einer Stadt, die, wenn auch nicht gerade klein, doch nur von mittelmässiger Bedeutung ist, jedenfalls verschwindend gegen Königsberg, wo Sie eine Professur erstrebten, die gewiss für Sie passend und Ihrer würdig gewesen wäre. Und nun Pastor in Rodenburg, der Nachfolger des alten braven, aber sehr simplen Maleischke, meines Einsegnungspfarrers — nein, das kommt mir zu überraschend. Was sagt denn Fritz dazu?“
„Er versteht es, weil er mich kennt,“ gab er zurück, jetzt hörbar gereizt durch die Art, mit der sie seine Mitteilung aufnahm. „Weil er weiss, dass mich die immerhin untergeordnete Dozententätigkeit in Bonn nicht befriedigen kann, dass ich wirken muss mit allen meinen Kräften und dies nirgend so gut und gern kann wie als Pfarrer einer grossen Gemeinde. Ich finde, es liegt doch genug des Ähnlichen in seinem und in meinem Entschluss. Er verlässt eine angesehene Stellung, die ihm vielleicht ein bedeutendes Fortkommen verhiess, um als einfacher Lehrling von der Pike an zu lernen.“
Sein Vergleich war zutreffend. Aber sie gab es ihm gegenüber nicht zu. „Doch mit dem Unterschiede,“ sagte sie, „dass aus ihm nie etwas gemacht wurde, dass er trotz seiner anerkannten Tüchtigkeit stets gegen Sie zurücktrat.“
Jetzt lebte es in seinen dunklen Augen auf, die so leicht einen müden, beinah toten Ausdruck hatten; „Ich weiss nicht, wer Ihnen das Recht gibt, mich immer als den weniger Bescheidenen, den sich Überhebenden hinzustellen. Sie kennen mich doch nur aus den Urteilen andrer, die sich — mit Ausnahme von Fritz — mit wenig Liebe und Verständnis mit mir beschäftigt haben. Wollen Sie es mir zur Last legen oder zur Sünde anrechnen, wenn ich durch die Anlage meiner Natur immer abseitsstand?“
Sie hatte nicht gedacht, dass eine solche Leidenschaft aus dem stillen Denker reden konnte. Er mochte recht haben: sie kannte ihn nicht. Sie wollte ein rechtfertigendes Wort sagen, da rollten Räder über die Auffahrt vor dem Hause. In einem einfachen, aber gutbespannten Selbstfahrer, die Zügel führend, sass Fritz; neben ihm der noch immer mit einer bewundernswerten Straffheit sich aufrecht haltende Schikor, der für Fritz in seinen Kindertagen als Lenker und Leiter des herrschaftlichen Kutschstalles eine Respektsperson gewesen und jetzt uralt war wie alles in Bärwalde.
„Nun, hast du deine Angelegenheit in Rodenburg erledigt?“ fragte Fritz, nachdem er Edith und seinen Bruder begrüsst hatte. „Und bist du zufrieden?“
„Darüber lässt sich vorläufig nichts sagen.“
„Hast du Edith von deinem Besuch bei Stoltzmann erzählt? Der ist doch wohl der Obermacher von der ganzen Sache?“
„Wir sind so weit noch nicht gekommen.“
„So weit noch nicht gekommen? Du musst doch schon eine ganze Weile hier sein.“
„Wir sprachen über allgemeinere Dinge,“ fiel Edith ein, „dein Bruder teilte mir eben erst seinen Entschluss mit, sich um die Rodenburger Pfarrstelle zu bewerben. Ich wunderte mich über ihn.“
„Warum wundern? Ich finde, es ist ein sehr vernünftiger Gedanke. Der Mann muss sich praktisch betätigen, das ist die Hauptsache; und für Hans ist es gut, wenn er sich von der unausgesetzt geistigen Beschäftigung auch einmal der rauheren Wirklichkeit zuwendet. Er wird seine Sache schon machen, da kannst du sicher sein.“
Die alte Liebe und Hochschätzung für den älteren Bruder sprach aus seinen Worten. Er sah in dem einfachen dunkelbraunen Jackettanzug nicht mehr so schmuck und schneidig aus wie in der kleidsamen Kürassieruniform. Aber die scharfgeschnittenen Züge seines Gesichts traten um so mehr hervor, und seine braunen Augen blitzten wohlgemut und guter Dinge in die Welt hinein. „Jeder muss am besten wissen, was für ihn gut ist, und kein andrer soll ihm dareinreden. Ich habe es an mir selbst erfahren.“
„Und fühlst du dich wohl in deiner neuen Tätigkeit?“
Er lächelte, sein kluges, stilles Lächeln. „Na, weisst du, anfangs musste ich mich doch verdammt fügen. So von der Pike auf! Und der alte Borowski, den ich bis dahin nur als jovialen guten Mann kannte, ist ein verdammt strenger Herr. Und wehe dem, der seinen Zorn heraufbeschwört! Ich sah ihn einmal, wie er sich auf einen aufsässigen Arbeiter stürzte, und wundre mich heute noch, dass der Mann mit seinem Leben davonkam. Aber wir beide arbeiten gut miteinander.“
„Und der alte Bärwalder?“
„Mit dem kann ich mich vorzüglich verständigen, gerade weil er so knapp und karg in seinen Worten ist. Das hebt mich über vieles hinweg, besonders über die Einsamkeit, die manchmal doch ein bisschen lastend ist.“
„Aber die Hutemach ist noch immer deine beste Freundin?“
„Na ob! Der alte Herr ist manchmal schon ein bisschen eifersüchtig, wenn sie zu gut bei Tisch auf mich aufpasst und mir regelmässig meine Lieblingsspeisen macht. Bereut, wie du siehst, habe ich noch nicht und werde es nie tun. Doch was ich fragen wollte,“ wandte er sich nun wieder zu Hans, „was meinte denn der Stoltzmann?“
„Er war sehr zurückhaltend, bemerkte nur, dass sich eine sehr grosse Anzahl von Bewerbern für die Stelle gemeldet hätte, und liess sich auf nichts andres ein.“
„Beriefst du dich nicht auf Edith, auf Fräulein von Barrnhoff? Machtest du nicht seiner Frau einen Besuch? Sie ist Ediths beste Freundin, und mit ihr lässt sich doch reden!“
„Nichts von alledem.“
„Aber weshalb nicht, Mann?“
„Weil ich meine Wahl solchen Mitteln und Empfehlungen nicht verdanken will. Spricht alles, was ich bisher geleistet, nicht für mich, dann muss ich eben verzichten.“
„Hörst du es, Edith? So ist er immer gewesen! So sind wir Warsows alle — immer mit der eignen Kraft, immer mit dem harten Kopfe! Um Gottes willen keine Verbindungen und keine Fürsprache! Deshalb haben wir es auch nie zu etwas gebracht. Aber du wirst die Sache schon machen, nicht wahr, Edith? So lass doch, Hans, sie tut es ja nicht für dich oder für mich. Sie tut ein gutes Werk für die Stadt Rodenburg. Solch einen Pfarrer sollen sie sich mal suchen! Du kannst ihn mit reinem Gewissen empfehlen, das darfst du mir glauben!“
„Ich will gern versuchen, was in meinen Kräften steht, vorausgesetzt natürlich, dass dein Bruder damit einverstanden ist.“
„Dann tust du es ohne seinen Willen, ja wider seinen Willen! Mir zuliebe, Edith, tust du es!“
Der alte Reckensteiner trat in das Zimmer. Der lange Ritt hatte ihn frisch und elastisch gemacht, sein Gang und seine Bewegungen hatten etwas jugendlich Militärisches. Aber sein Gesicht zeigte in der blassen Beleuchtung der Spirituslampe, die man immer noch in Reckenstein brannte und die eben angezündet war, einen müden Zug.
Er hatte nicht viele Menschen, denen er seine Zuneigung schenkte, er war kritisch und zum Aussetzen geneigt. So begrüsste er auch heute Fritz mit herzlicher Freude, während er seinem Bruder gegenüber eine kühlere Haltung annahm, ohne jedoch durch Wort oder Miene die Pflichten des Hauswirts zu vernachlässigen. Denn die Gastfreundschaft war in Reckenstein ein geheiligt Ding. Unter gleichgültigen Gesprächen verlief das reich aufgetragene Abendessen, dann fuhren die beiden Brüder durch die sternenklare Sommernacht nach Bärwalde.
Hans Warsow erhielt eine Aufforderung zur Probepredigt an der Nikolaikirche in Rodenburg.
Der Kirchenbesuch stand in Rodenburg nicht auf der Höhe. Auch diesmal war das grosse Gotteshaus nicht in allen seinen Teilen gefüllt, sah aber immerhin eine grössere und ansehnlichere Versammlung als an den andern Sonntagen. In dem Patronatsstuhl sass der erste Bürgermeister mit seiner Gattin, der Dezernent für Schule und Kirche und einige andre Ratsherren. Auch Edith, die in diesen Tagen nach Rodenburg gekommen war, um mit dem Arzt über ihren Vater zu sprechen, hatte sich dort eingefunden und Fritz mit eingeschmuggelt.
Man erwartete den neuen Prediger bereits zur Liturgie. Aber er kam nicht. Diakonus Brettschneider, der vielgeliebte zweite Geistliche an St. Nikolai, hielt sie nach altem Herkommen. Das erhöhte die Spannung. Endlich war die Liturgie beendet. Der gutgeschulte Kirchenchor sang seine Motette: „Alles, was Odem hat“, das Hauptlied setzte ein, der letzte Vers war gesungen, Hans Warsow bestieg die Kanzel.
Das bleiche, feingeschnittene Gesicht mit den ernsten, beinah strengen Zügen und den dunklen, träumenden Augen, die niemand in der grossen Gemeinde sahen, sondern ganz einwärts blickten, machte sofort Eindruck auf die Leute. Nun las er den Text, nun begann er seine Predigt.
Er sprach mit etwas rauher, aber sehr deutlicher Stimme in kurzen, knappen Sätzen, jeder auf das sorgsamste gefeilt und von ehernem Gefüge. Wie wohlgehauene Steine waren sie, die er zu einem festgeordneten Bau türmte. Sichtbar stieg er vor den Zuhörern in die Höhe, überall merkte man den scharfen Denker. Beredt wie sein Mund sprach seine Hand: eine lange, beinah überschlanke Hand mit feinen, durchgeistigten Linien; sie allein führte seine Gesten aus. Aber auch sie nur mit leise deutenden Bewegungen.
„Wie hat dir seine Predigt gefallen?“ fragte Frau Lisa, die Hans Warsow und seinen Bruder mit einigen andern Gästen zu Mittag geladen. Sie hatte es in Rücksicht auf seine Beziehungen zum Reckensteiner Hause getan und war jetzt mit dem Ordnen der Tafel beschäftigt, wobei ihr Edith behilflich war.
Stoltzmanns bewohnten eine neugebaute Villa draussen vor der Stadt, die architektonisch mit Geschmack ausgeführt und im Inneren sehr geräumig war. Die Stadt hatte sie ihrem Bürgermeister zum Ehrengeschenk gemacht, als dieser die Aufforderung einer grossen Stadt im Westen, sich dort für die freigewordene Oberbürgermeisterstelle zur engeren Wahl zu stellen, kurzerhand abgelehnt hatte.
Edith schwieg einen Augenblick. „Ich habe, wie du weisst, nie viel Sinn für Predigten gehabt,“ sagte sie dann, „aber ich gebe zu, es war etwas Eignes in dieser. Manchmal kam sie mir mehr wie ein Vortrag vor, dann wieder schien es mir, als ob auch die einfacheren Leute von ihr berührt würden. Ich habe eine solche Andacht in der Nikolaikirche noch nicht gesehen.“
„Du hast ja auch wenig Gelegenheit dazu gehabt, mein Herz,“ warf Frau Lisa ein wenig spöttisch hin, und indem sie die Gläser zurechtstellte: „Er muss mich führen. Anders wird es nicht gehen. Obwohl ich auf die Prediger auch nicht besser zugeschnitten bin als du, und seinen jüngeren Bruder viel lieber hätte. Schade ist es aber doch, dass er seine Uniform ausgezogen hat. Sie stand ihm so gut!“ Und während sie mit flinker Feder an einem kleinen Nebentische einige Führungskarten schrieb: „Aber Hände hat der Mensch! Solche Hände habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ich hörte kaum auf seine Worte, ich blickte immer auf seine Hände, und ich verstand alles.“
„Er lebt ja auch nur im Geistigen, sein Gesicht, sein ganzer Körper sagt es.“ Und nachdem sie einige dunkle Rosen, die ihr Frau Lisa gereicht, über die Tafel verteilt: „Ob solche Männer der Idee wohl einer grossen Tat gewachsen wären? Ob Hans Warsow sie leisten würde, wenn sie eines Tags von ihm gefordert würde? Herantreten kann sie in einer so zahlreichen Gemeinde doch jeden Tag an ihn.“
„Sieh, wie philosophisch dich der Mann gemacht hat! Auf solche Gedanken komme ich nie. Ich finde sie ziemlich müssig, und dir lagen sie sonst auch nicht. Komm, hilf mir lieber die Fruchtschale zurechtmachen. So etwas kann ich dem Mädchen nicht überlassen.“
Frau Lisa war eine sehr tüchtige Hausfrau, es ging ihr alles schnell und sicher von Händen, ihre Wirtschaft war von mustergültiger Ordnung, und ihre Gäste fühlten sich wohl bei ihr.
Als sie eben die letzte Frucht aufgelegt hatte, trat ihr Mann ins Zimmer, um die Weine aufzustellen, die er selber aus dem Keller geholt hatte.
„Warst du zufrieden?“ fragte sie ihn.
„Im ganzen ja, soweit mich eine Predigt überhaupt zu fesseln vermag. Ich muss immer an Schiller denken, der einmal gesagt haben soll, sie wäre nicht für Gebildete.“
„Ich fand, er sprach gerade für die Gebildeten.“
„Doch es ist so vieles drum und dran, das mich stört. Gewiss, er hatte kein Kanzelpathos, auch nicht die üblichen Floskeln. Aber schon die Art der Anrede, die unumgängliche Einzwängung in dogmatische Formen und kirchliche Grenzen — wie gesagt, es ist nichts für mich. Ich könnte es gut entbehren.“
„Er hat eine ausgesprochen moderne Art, sowohl in dem, was er sagt, wie in seinem ganzen Gebaren,“ äusserte jetzt Edith, die die von ihrer Freundin geschriebenen Tischkarten auf die Gläser legte — „ich neben Fritz, du hast wirklich Selbstverleugnung geübt, Lisa! — Ich hatte eher das Bedenken, ob er für eine Stadt wie Rodenburg und für die Nikolaigemeinde der rechte Mann ist.“
„Doch, doch!“ erwiderte Stoltzmann mit Entschiedenheit. „Wir haben hier sehr tüchtige Geistliche, aber einer, der fähig ist, höhere geistige Interessen auch ausserhalb der Kirche zu befriedigen, der gerade fehlt uns. Ich möchte ihn deshalb gern zu einigen Vorträgen heranziehen, so etwas brauchen wir in Rodenburg, es war immer mein Gedanke. Dazu kommt er mir gerade recht.“
Frau Lisa hörte nur mit halbem Ohre zu. Sie überschaute mit prüfendem Blick die Tafel und zählte die Gläser.
„Seid ihr mit allem fertig?“ fragte Stoltzmann. „Es ist die höchste Zeit!“
Die Glocke, die das Kommen der ersten Gäste meldete, gab ihm recht. Hans Warsow und sein Bruder erschienen auf die Sekunde pünktlich, die andern folgten bald.
Es waren noch zwei andre Geistliche zur Probepredigt nach Rodenburg geladen, die gleichfalls gefielen. Aber der erste Bürgermeister trat mit Entschiedenheit für die Wahl von Hans Warsow ein, und da er einen Einfluss in der Stadt hatte wie nie ein andrer vor ihm, so wurde diese mit ziemlicher Einstimmigkeit vollzogen.
Nun hatte Hans Warsow sein Ziel erreicht, er hatte ein grosses Pfarramt inmitten einer blühenden Stadt, die im Herzen seiner geliebten Heimat lag, er konnte wirken und schaffen.
Und er tat es. Leicht war seine Tätigkeit nicht. Sein Vorgänger, ein älterer, kränklicher Herr, hatte den grössten Teil der Arbeit dem jüngeren Amtsbruder überlassen, und Diakonus Brettschneider hatte sich ein reiches Feld in der Gemeinde geschaffen. Aber Hans Warsow hatte eins vor allen seinen Amtsbrüdern voraus: seine Predigten übten eine starke Anziehungskraft, der Kirchenbesuch stieg. Leute, die sonst nie in der Kirche zu sehen gewesen, stellten sich jetzt ein, man sprach von seinen Predigten, was in Rodenburg bisher nie geschehen war.
Aber das alles, so schön es sich anliess, dauerte nur eine kurze Zeit. Die Teilnahme an seinen Predigten hörte zwar nicht auf, verlor jedoch ihre Lebendigkeit, als der Reiz der Neuheit dahin und seine Tätigkeit etwas Gewohntes war. Da seinem Wesen zudem jenes Gleichgewicht abging, das sich weder durch Zudringlichkeit noch durch Überspanntheit von manchen seiner weiblichen Schutzbefohlenen aus der Fassung bringen liess, da er als Denker zu oft mit allerlei Fragen und Erwägungen beschäftigt war, um jedem Besucher, jedem seiner Gemeindeglieder auf der Strasse gleich mit jener fertigen Liebenswürdigkeit und Anteilnahme entgegenzukommen, die man nun einmal von „seinem“ Geistlichen verlangte, so hielt sich das allgemeine Interesse, das er im Anfang erregt hatte, nicht auf seinem Höhepunkt.
„Gewiss, klug ist er, und was er sagt, ist schön,“ meinte eine Dame der besseren Kreise, die ihm zuerst mit begeisterter Hand Pforten gebaut, „aber ich kann mir nicht helfen, Herr Brettschneider ist so sehr viel netter, es kommt alles so herzlicher und so liebevoller bei ihm heraus.“
„Er ist ein bisschen von sich eingenommen. Das sind die geistvollen Leute immer,“ äusserte eine andre, mit der er sich gelegentlich einer Tauffeier sehr anregend unterhalten, die er aber bei einer späteren Gelegenheit nicht wiedererkannt und infolgedessen wenig beachtet hatte.
„Predigen kann hei, aber trösten kann hei nich!“ sagte eine einfachere alte Frau, die es dem neuen Pfarrer übelgenommen hatte, dass er nach einem halbstündigen Vorklagen ihrer sämtlichen Leiden der Reihe nach nicht mehr ganz bei der Sache war. Bei der Menge wirkt ein liebenswürdiges Wesen bei weitem mehr als geistige Vorzüge; diese schliessen aus, jenes zieht an. Hans Warsow war noch harmlos genug, zu glauben, dass es im Leben zuerst auf das ernste Wollen und die Kraft des Könnens ankomme. Die Leute wollen gestreichelt sein, warm muss der Blick sein und weich die Hand, die sie berührt. Und Hans Warsows Blick war nicht immer warm, und nicht immer weich die Hand, die er reichte.
Bei alledem durfte er sich nicht beklagen: ein sehr grosser Teil, nicht nur der Nikolaigemeinde, sondern der ganzen Stadt, hielt unentwegt zu ihm. Er zog seine Predigten jeder andern vor, er suchte ihn für ihre Amtshandlungen. Er bemühte sich, in einen persönlichen und gesellschaftlichen Verkehr mit ihm zu kommen. Dies war freilich nicht leicht, denn am Tage arbeitete er in der Gemeinde, und seine Abende waren geistigen Studien gewidmet, die er keineswegs vernachlässigte, oder er war mit der Vorbereitung für die zweite Auflage seines Werkes über Ostpreussen beschäftigt, das einen wachsenden Anklang in der Provinz, ja über sie hinaus gefunden hatte.
Eine Erholung gönnte sich Hans Warsow inmitten all seines angestrengten Arbeitens: er fuhr dann und wann nach Bärwalde.
Es war ja immer eine grössere Reise, aber sie trug ihren Lohn in sich. Sowie er die Luft Bärwaldes atmete, all die Stätten auf dem Hofe, in Feld und Wald betrat, an die ihn die schönsten Erinnerungen seiner Kindheit knüpften, dann fühlte er sich wohl und war von Herzen froh und jung.
Da stand das alte stolze Herrenhaus, in seinem früheren Teil an eine ferne Vergangenheit mahnend, der linke weitausreichende Flügel und das obere Stockwerk später angebaut. Aber nur der kennende Blick konnte die alte und die neue Zeit hier unterscheiden, denn ein verständnisvoller Königsberger Architekt hatte die Neuerung bewerkstelligt und dem Vorhandenen einheitlich zugefügt. Und alles war mit der grössten Sorgfalt gepflegt und erhalten.
Vor der nach dem Hof hinausschauenden Front standen zu beiden Seiten der offenen hölzernen Veranda zwei gewaltige uralte Pappeln, die so mancher Sturm zerzaust, mancher Blitz getroffen, und die dennoch stark und trutzig mit dem kahlen Haupt in den Himmel ragten, als wären sie hingestellt wie zwei schützende Riesen, das Bärwalder Herrenhaus vor den feindlichen Elementen des Himmels und der Erde zu bewahren. Ihnen gegenüber ein grosser ovaler Platz, mit allerlei Sträuchern und jungen Bäumen angepflanzt, unter denen der gepflegte Rasen schimmerte; rechts von ihm, durch eine breite mit Kies bestreute Einfahrt getrennt, der herrschaftliche Kutschstall mit dem Turm darauf, dem Hahn über ihm als Wetterfahne und der Glocke im Dachgestühl, die zur Arbeit rief und die Feierstunde kündete.
Wie vertraut war ihm dieser Laut, wie redete er seine eigne Sprache, die nur er verstand! Er und allenfalls Fritz, aber der war viel jünger als er und hatte erst später erfahren, was er lange durchlebt. Und auch wieder auf seine Weise, denn sie beide hatten ihre bestimmte Eigenart, die sie einte und trennte. Nur in einem waren sie gleich: in der Liebe zu diesem Gute ihrer Väter, zu jedem Gebäude, jedem Baume, jedem Grashalm auf ihm. Bärwalde bedeutete für sie den Kern der Heimat, in der sie wurzelten.
Und in der Tat: dies alte Gut mit seinen tiefen Flächen und Weiten, seinen grünen Triften und fetten Weiden, dem gewaltigen Kranze uralter Wälder, der den ganzen Horizont umschloss, dem breiten Deichgraben, der es an seiner Grenze durchschnitt, und den Brücken mit den schwarz und weissen Geländern, die über ihn dahinführten — es war wie ein Ausschnitt des fruchtbaren, gesegneten Ostpreussenlandes. Und wenn Hans am dämmernden Abend mit dem alten Onkel auf der Hofveranda auf der hölzernen Bank sass und die rauschenden Pappeln über ihnen das Lied der Zeit, seine ewige Melodie von Werden und Vergehen, spielten, wenn auf der Hofstrasse, jenseit des ovalen Platzes, die grosse Herde heimwärtsgezogen kam, der Ton ihrer Glocken mit dem behaglichen Gebrüll sich einte, und hinter ihnen die Schnitter mit Sensen und Gerät ihren Häusern auf dem Gehöft zuwanderten, wenn über alledem die Sonne wie eine glühende Scheibe am lohenden Himmel stand und mit ihrem letzten Schein die alte Pronitter Kirche dort drüben am fernen Horizont jenseit des grossen Deichgrabens grüsste, dann überkam ihn ein wunderstilles, heimlich glückliches Gefühl der Geborgenheit, und er empfand nichts als das beseligende Bewusstsein, nun endlich nach langer Wanderung wieder daheim zu sein im heissgeliebten, oft entbehrten Ostpreussenland! Er sprach kein Wort, jede Silbe wäre ihm Entweihung gewesen.
Auch auf den welken Zügen des alten Onkels lag etwas wie feiernde Ruhe und schimmerte wider in seinen trüben Augen, die nicht viel mehr sehen konnten, aber, als sie jung waren, geradeso hinausgeblickt hatten auf diese gesegnete Landschaft, diesen friedumhegten Gutshof mit seinen alten, aber gut erhaltenen Gebäuden und Bäumen, deren scharfem Blick damals nichts entging, was sich auf dem grossen Hof ereignete.
Der Alte hatte eine eigne Art. Meist sass er stumm, wie teilnahmlos da, wenn die andern um ihn herum redeten. Dann griff er mit einemmal in das Gespräch ein, und sofort wusste man, dass er alles gehört und wohl verstanden hatte. Nun sprach er seine Ansicht aus, und was er dann meist in kurzen, knappen Worten sagte, hatte alles Hand und Fuss und traf den Nagel auf den Kopf. Besonders Hans unterhielt sich über geistige Dinge mit niemand so gern wie mit dem Alten, und es war schwer zu entscheiden, wer von beiden mehr gab oder empfing.
Lange konnte der alte Herr den Aufenthalt im Freien nicht vertragen. Obwohl er im Wintermantel sass, fröstelte ihn bald; dann ging man ins Haus. Da hatte Fräulein Hutemach inzwischen das Abendbrot bereitet. Sie war aus Litauen gebürtig; von ihrer frühesten Jugend an in die Welt und in die verschiedensten Stellungen verschlagen, hatte sie sich eine umfassende Bildung, viel Geschick und Takt im Umgang mit den Menschen und eine gute Dosis persönlichen Mutes angeeignet, der sie nie verliess. Als der Bruder des Bärwalder, der alte Geheimrat in Berlin, für jenen eine Gesellschafterin suchte, konnte ihm das Glück keine geeignetere zuführen als diese. Nun teilte sie seit einer Reihe von Jahren mit dem kränklichen Gutsherrn die Einsamkeit Bärwaldens, versah ihm Haus und Hof, schrieb seine Briefe, las ihm des Vormittags und des Abends seine Zeitungen vor, führte ihn zur regelmässig festgesetzten Stunde, die auf die Sekunde eingehalten werden musste, je nach dem Stand der Witterung im grossen, wohlgepflegten Garten oder auf der Landstrasse spazieren und hegte und pflegte ihn, wie es eine Frau nicht hätte besser tun können.
Auch jetzt beim Abendessen sass sie neben dem „Herrn Hauptmann“ — wie der Reckensteiner und andre Nachbarn wurde auch er noch immer mit dem Titel einer längst verflossenen Soldatenzeit genannt —, reichte ihm die Speisen, gab ihm, was für ihn bekömmlich war, und machte es ihm sorgsam zurecht.
Nun kam auch Fritz mit Borowski, dem Inspektor, von der Arbeit. Er hatte sich vollständig umgekleidet, war frisch und guter Dinge und sehr erfreut, wenn der Bruder einmal bei ihnen zu Tische sass. Und mit welcher Lust er zugriff! Im Sommer eine grosse Satte mit dicker Milch und dem groben Landbrot. Im Winter ein hochgefüllter Teller mit warmer Grütze und nachher, wenn es irgend ging, Stippe mit Speck und grauen Erbsen, oder, wenn es hochkam, Schmandkartoffeln mit Bratklops und Quark oder Glumse, das waren seine Leibgerichte. Freudig liess er sie für alle Herrlichkeiten, die die Hutemach für den Onkel und Hans aufgetischt hatte. Denn der war doch ein wenig mehr Kulturmensch geworden und hatte einen zarteren Magen, der für die schwere ostpreussische Küche nicht ganz eingerichtet war. Nur die Sauerampfersuppe mit dem zerlassenen Ei darin oder den Teller mit unverfälschtem Königsberger Fleck liess auch er sich nicht nehmen; eins von beiden musste immer das Mittagessen eröffnen, wenn er einmal da war.
Zum Spätherbst war er sogar für eine ganze Woche auf Urlaub nach Bärwalde gekommen. Das waren Festtage, einer wie der andre.
„Höre, Fritz,“ sagte Hans gleich den ersten Abend, „morgen muss ich zum alten Teichgräber, nach Pronitten, und du musst mit. Es ist unerhört, dass du dem alten Herrn noch nicht einen Besuch gemacht hast.“
„Zum Besuche machen haben wir auf dem Lande keine Zeit, Hans. So hohe kulturelle Ansprüche darfst du an uns nicht stellen. Wir sind Bauern und pflügen unsre Scholle. Um die Menschen, ihre Formen und Gebräuche kümmen wir uns nicht.“
„Aber mit seinem Pfarrer muss man eine Ausnahme machen,“ warf der alte Bärwalder ein, „der Pronitter Pastor hat uns immer nahegestanden. Selbst ich, obwohl ich auf Kirchlichkeit keinen Anspruch machen möchte, bin ab und zu in seine Predigten gefahren. Schon ihm zuliebe.“
„Siehst du, Fritz,“ bemerkte Hans, „dann hättest du den Onkel jetzt, wo er es nicht mehr kann, vertreten müssen, und bist gewiss noch nicht ein einziges Mal da drüben zum Gottesdienst gewesen.“
„Nee, mein Lieber! Nicht ein einziges Mal! Des Sonntags bleibe ich in der Klappe, es ist ja der einzige Tag, wo ich es kann, manchmal bis in den Mittag hinein. Und mein Gottesdienst — na, Hans, diese Wiesen und Felder, das grasende Vieh, die Fohlen in den Koppeln und die rauschenden Wälder rings um uns her, meinst du denn, dass das alles kein Gottesdienst ist, wenn man nur Augen hat, es zu sehen, und Ohren, es zu hören? Für mich wenigstens ist es einer, ich bedarf der Kirche nicht.“
Hans runzelte die Stirn. „Du weisst, wie ich das alles liebe. Aber eine gute Predigt — und der Alte da drüben versteht seine Sache — erhöht mir die Freude daran. Ich glaubte übrigens, du hättest deine Ansicht hierin ein wenig geändert.“
„Herr Warsow hat völlig recht,“ mischte sich jetzt die Hutemach ins Gespräch, deren Wort in Bärwalde viel galt, und die auch den beiden jüngeren Männern gegenüber ein nie angefochtenes Ansehen besass. „Sehen Sie, Herr Rittmeister, wie oft ich Ihnen das gesagt habe! Aber Sie wollten es nicht glauben und meinten, es wäre genug, wenn ich für Sie betete.“