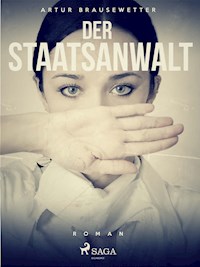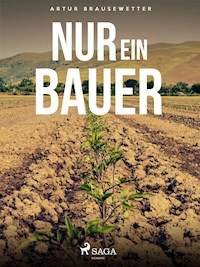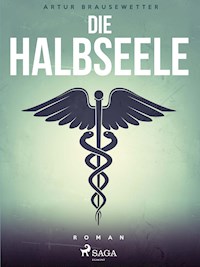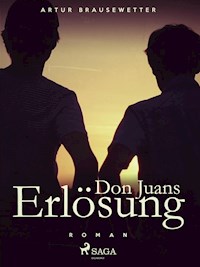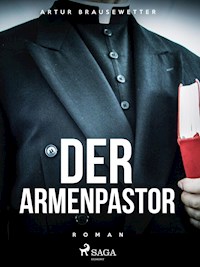
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kommerzienrat Wolters kann eigentlich froh sein. Endlich bewirbt sich ein weiterer Kandidat für das Amt des Pastors in der Arbeiterstadt: Richard Werder, der zuvor sieben Jahre in einem Gefängnis seinen Dienst verrichtet hat. Dieser stattliche Mann macht einen anpackenden Eindruck und könnte gut geeignet sein, die Gemeinde in Schach zu halten. Doch schnell merkt Wolters, dass es Werder um ganz etwas anderes geht: den Arbeitern zur Seite zu stehen. Bevor Wolters die Wahl verhindern kann, ist Werder schon in Amt und Würden. Schnell erwirbt sich Werder den Ruf eines Armenpastors, der von vielen in der Gemeinde geliebt wird. Aber es gibt auch einige Arbeiter, die die Auseinandersetzung mit diesem gerechten Gottesmann suchen. Bis er plötzlich ganz unerwartet Unterstützung von Margarethe, der ältesten Tochter Wolters, erhält.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Brausewetter
Der Armenpastor
Roman
Saga
Ebook-Kolophon
Artur Brausewetter: Der Armenpastor. © 1924 Artur Brausewetter. Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711487655
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
Kommerzienrat Wolters stand vom Schreibtische auf.
Er warf die Besuchskarte, die ihm sein Diener überreichte, mit deutlicher Spur des Unwillens auf seine Schreibmappe —
„Ich habe zwar wenig Zeit, aber ich lasse bitten.“
Eine Männergestalt trat in das Zimmer.
Schwarz war der Anzug, in den sie gekleidet, schwarz die Binde, die um den hageren Hals geknüpft war, schwarz die Haare, die über dem bartlosen Gesicht zwanglos lagen.
„Ich bitte,“ sagte der Kommerzienrat und wies auf einen Sessel. „Womit kann ich dienen?“
„Ich bewerbe mich um die Diakonatsstelle an St. Elisabeth — ich hatte nicht vor, Besuche zu machen, man sagte mir aber, dass eine persönliche Vorstellung bei Ihnen unerlässlich sei.“
„Ihr Name?“ fragte Wolters kühl.
„Richard Werder.“
„Und was sind Sie?“
„Ich erlaubte mir, Ihnen meine Karte hineinzusenden.“
„Ganz recht. Aber bei den vielen Besuchen, die ich bekomme, lese ich all die Karten nicht so genau — doch Sie gestatten ...
Hilfsprediger des Gefängnisses in B ...
Und Sie hoffen, hier ein geeigneteres Wirkungsfeld zu finden? Dass ich es Ihnen gleich sage, Ihre Stelle ist sehr schwer. So klein unsere Stadt ist, sie ist ein bedeutender Fabrikort. Ich selber beschäftige mehrere hundert Arbeiter. Das Gift der Zeit hat auch diese Kreise ergriffen. Wir brauchen in dieser Stadt nichts so notwendig wie die Religion. Eine strenge Religion. Und einen strengen Mann, der sie verkündet mit ihren Segnungen, aber auch — mit ihrer Furcht.“
Er hatte kühl und geschäftsmässig gesprochen ohne jeden Anflug von Erregung. Jetzt schien er zu erwarten, dass der Fremde sich zum Aufbruch anschicken würde. Mit einem Male aber blieb sein Auge wie gebannt an der Erscheinung des jungen Pastors haften, der sich in dem Sessel in die Höhe gerichtet hatte.
Das war das marmorkalte Antlitz nicht mehr, das er bei der Begrüssung flüchtig gestreift — in diesen Zügen, die ihm durch die Kunst eines Augenblicks wie umgewandelt erschienen, lebte und bewegte sich alles.
Und fort von diesem Antlitz glitt sein Auge über die muskulöse Gestalt, zu den beiden Händen, die sich auf die niedrigen gepolsterten Armlehnen des Sessels stemmten, — aus dieser Erscheinung, diesen Händen sprach dieselbe männliche Kraft, dasselbe heisse Wollen.
Ein Augenblick hatte seine ganze Meinung und Menschenkenntnis über den Haufen geworfen.
Dieser Pastor war sein Mann! Den konnte er brauchen!
„Nein, bleiben Sie, Herr Pastor,“ sagte er verbindlich, und in dem Tone, den er jetzt anschlug, behielt das leutselige Wohlwollen die Oberhand, „sehen Sie, gerade die Besetzung dieser Stelle ist mir und einigen Freunden im Kirchenrate von Bedeutung. Wir glauben eben noch an die Macht der Religion, an die Erziehung durch die Kirche. Wir sehen in der christlichen Religion die einzige Waffe gegen die Mächte der Unzufriedenheit und Auflehnung.
Ob ich für meine Person die Religion notwendig brauche?! Du mein lieber Gott! Nicht als ob ich unkirchlich wäre! Ich gehe an den grossen Festtagen in die Kirche, Totenfest gehe ich zum heiligen Abendmahl — ich tue es zur Erinnerung an meine Frau, die darauf hielt und vor langen Jahren starb, im übrigen des guten Beispiels wegen. Doch mit den Leuten ist es etwas anderes. Die brauchen die Religion wie das tägliche Brot. Und den Mann, der es ihnen reichen soll, den habe ich gefunden. Der sind Sie, Herr Pastor! Sie sind sieben Jahre Gefängnisprediger gewesen. Sie kennen die Menschen. Sie werden mit ihnen umzugehen wissen. Lassen Sie gut sein — meine Stimme haben Sie, und ich glaube nicht zu viel zu versprechen, wenn ich sage: Ihre Wahl ist damit so gut wie gesichert!“
„Nein, Sie versprechen zu viel, Herr Kommerzienrat.“
„Oho! Warum sollte ich mehr versprochen haben, als ich zu halten vermöchte?“
„Ich danke Ihnen, Herr Kommerzienrat, aber ich bin der Mann nicht, den Sie brauchen können. Sie würden sich selbst, Ihre ganzen Grundsätze betrügen, wenn Sie mir Ihre Stimme schenkten.“
„Weshalb?“ fragte Wolters etwas kleinlaut.
„Weil ich der Religion nicht diene, deren Ideal Sie mir eben so beredt entworfen, weil mir mein Amt zu heilig ist, um es in den Dienst des Kapitals zu stellen. Ich verkünde nicht ein Christentum, welches, von den Gebildeten als überflüssiger Ballast einer veralteten Zeit beiseite geworfen, gerade gut genug ist, die Armen zu schrecken oder ihnen einen Wechsel auf den Himmel auszustellen. Ich bin der Diener einer Botschaft, die Frieden bringt und Seligkeit allen — den Reichen, wie den Armen in gleicher Weise.“
„So — so,“ sagte der Kommerzienrat sehr gedehnt, und fast mitleidig setzte er hinzu:
„Sie sind noch jung, mein lieber Herr Pastor — wir brauchen hier einen Mann, der Lebenserfahrungen gemacht hat. Ueber kurz oder lang werden Sie sich auch zu meinen Ansichten bekehren. Heute freilich würde eine Stelle, wie die unsere, nichts für Sie sein. Darum gebe ich Ihnen recht, wenn Sie unter diesen Umständen auf eine Bewerbung verzichten —“
„Ich erinnere mich nicht, dergleichen gesagt zu haben.“
Es war ein langer, erstaunter Blick, mit dem der Kommerzienrat sein Gegenüber mass.
„Wie — Sie wollten ohne meine Zustimmung, ja mit dem Bewusstsein, dass ich ein ausgesprochener Gegner Ihrer Kandidatur bin, dieselbe aufrecht erhalten?“
„Allerdings — das will ich!“
„In Gottes Namen — aber verlassen Sie sich darauf — Sie machen sich vergebliche Mühe.“
„Den Erfolg überlasse ich einem anderen.“
„Gut,“ sagte der Komerzienrat, „so tun Sie, was Sie nicht lassen können.“
Richard Werder wollte gehen, da öffnete sich die Tür, ihm gegenüber stand ein junges Mädchen, das höchstens sechzehn Jahre zählen konnte. Eine zarte, elastische Gestalt, ein Antlitz mit lieben, weichen Kinderzügen, die einen seltsamen Reiz erhielten durch den Hauch von Ernst und Reife, der sie vergeistigte, ohne ihnen den Zauber der Kindlichkeit zu nehmen, zwei Augen, die schüchtern und fragend zugleich aus dem bleichen Antlitz in die Welt schauten, als wollten sie ihre Rätsel ergründen, und dann wieder so ruhig und zuversichtlich blickten, als hätten sie all diese Fragen und Rätsel längst gelöst in reiner, unberührter Seele.
„Wer war der Herr, der eben von dir ging?“
„Nichts, mein Kind, ein geschäftlicher Besuch — ein Prediger, der sich um die hiesige Stelle bewirbt —“
„Er sah so ernst aus, so —“
Sie stockte; einen Augenblick weilte ihr Antlitz sinnend in kindlichem Ernst auf dem Boden, dann leuchtete es hell auf. „Vater, den werdet ihr wählen, dann werden wir endlich einmal einen Prediger haben!“
„Den werden wir nicht wählen. Das ist kein Prediger für uns. Doch nun mach’ dich fertig, mein Herz, das Konzert muss gleich beginnen, und der Wagen ist schon vorgefahren.“
„Ach — diese vielen Konzerte!“
Ein Besuch wurde gemeldet. Ein älterer Herr, vielleicht in der Mitte der Fünfzig. Eine hagere Erscheinung, ein schmaler, spitzer Kopf, über der scharfgezeichneten Nase ein Paar grauer, kluger Augen.
„Guten Tag, mein lieber Herr Superintendent,“ begrüsste ihn der Kommerzienrat. „Begleiten Sie uns in das Konzert?“
„Ich bedaure. Für Derartiges sind meine Abende zu kurz. Ich muss heute abend noch in eine Versammlung und zwei Sitzungen. Guten Tag, Else! Ei, ei, schon wieder auf der Eisbahn gewesen?“
„Du solltest doch nicht soviel Schlittschuh laufen, mein Herz. Der Sanitätsrat hat es dir verboten,“ warf Wolters mit Besorgnis ein.
„Ich tue es ja auch so selten, Vater, nur um ein bisschen in der Uebung zu bleiben, wenn Grete wiederkommt.“
„Wie geht es denn Fräulein Grete?“ fragte Superintendent Kornträger.
„Wie sollte es ihr besser gehen können?“ erwiderte der Kommerzienrat. „Berlin, das grosse Haus, das mein Schwager macht, jeden Tag Konzert oder Gesellschaft, da ist sie in ihrem Element und vergisst das Wiederkommen. Uebrigens, ich habe Besuch gehabt. Ein Bewerber.“
„Ein Bewerber? Nun?!“
„Ein toller Heiliger. Hielt mir hier lange Vorträge. Die alte Sache, dass ein Kamel leichter durchs Nadelöhr gehen könne, als ein Reicher ins Himmelreich kommen! Die Armen sucht er — Armenpastor will er sein. Meine Arbeiter —“
„Aha,“ lächelte Kornträger etwas bitter, „er gehört zur neuesten Richtung. Er liebäugelt mit den Armen.“
„Liebäugelt?! — nein, so sah der Mann nicht aus. Sie unterschätzen ihn. Fanatiker ist er, wie ich selten einen gesehen, vom Kopf bis zur Sohle —“
„Gott bewahre uns,“ rief der Superintendent, „ein Vertreter jener neuesten Strömung unter unseren Pastoren, der sozialen, die sich heute so breit machen und Unheil schaffen, wohin sie kommen! Diese Armenpastoren! — Nein, — Herr Kommerzienrat. Den können wir hier nicht brauchen!“
„Ich sagte ihm auch, er möge nur noch weitere sieben Jahre um seine Gefangenen freien.“
„Was?! Den Gefängnisprediger meinen Sie, den Dingsda — wie heisst er gerade — den —“
„Werder.“
„Richtig. Werder aus Bernau. Um Gottes willen, lieber Herr Kommerzienrat. Nur den nicht. Ich kenne ihn. Bevor er ins Gefängnis ging, verwaltete er ein Jahr lang eine Pfarrstelle beim Grafen Türck. Er wollte ihn zwingen, neue Wohnhäuser für seine Arbeiter zu bauen. Es gab Krieg zwischen ihm und allen adeligen Besitzern bis aufs Messer. Aber die Arbeiter, die kleinen Leute vergötterten ihn.“
„Seien Sie ganz ruhig, lieber Herr Superintendent, den kriegen sie auch nicht.“
„Nein,“ sagte Kornträger sehr entschieden, „ich bin nicht ganz ruhig. Der Mann übt überall seine Anziehung, man interessiert sich auch hier für ihn.“
„Hilft alles nichts — den Mann kriegen sie nie. Doch komm, Else, wir müssen gehen.“ —
Am nächsten Tage fand die Sitzung der vereinten Gemeindeorgane statt.
Aus den Bewerbern um die Diakonatsstelle an St. Elisabeth wurden nach längerer Beratung die drei durch ihre Zeugnisse und Empfehlungen am meisten Ausgezeichneten auserwählt und der Superintendent beauftragt, sie zur Abhaltung einer Probepredigt aufzufordern.
Die Warnung des Kommerzienrates war vergeblich gewesen: Werder befand sich unter diesen drei.
Die Kirche war zu seiner Gastpredigt gedrängt voll wie nie zuvor. Der Gefängnisprediger musste einen eigentümlichen Reiz auf die Gemeinde ausüben.
Er predigte über das Wort des Herrn: „Ihr seid das Salz der Erde.“ Er wies darauf hin, wie die Zeit zu Ende wäre, wo der Prediger in seiner Studierstube sich hinter dogmatischen Studien vergraben dürfte, wie ihm jetzt in der heiss pulsierenden Gegenwart des Kampfes und der Zerklüftung so recht seine Aufgabe gezeigt wäre, mitten hinein in die Strömungen des Tages zu treten, der Zeit an den hämmernden Pulsschlag zu fassen und überall hin als die heilende Salbe das Evangelium des Friedens und der Versöhnung zu tragen.
Noch einmal bot der Kommerzienrat seinen Einfluss auf. Der Tag der Entscheidung kam, und mit einer Mehrheit, die man kaum für möglich gehalten, wurde der Gefängnisgeistliche zum Diakonus an St. Elisabeth gewählt.
Else sass, mit einer Handarbeit beschäftigt, an ihrem Nähtisch, ihr Vater, der eben aus der Fabrik nach Hause gekommen war, ging im Zimmer auf und ab.
„Du weisst, liebes Kind,“ sagte er, „wie schwer es mir geworden ich, dich zu Pastor Werder in den Konfirmandenunterricht zu schicken. Superintendent Kornträger ist ein alter Freund unseres Hauses, doch ich habe meine persönliche Abneigung gegen diesen jungen Eiferer unterdrückt — aus Liebe gegen dich!
Aber jetzt — diese Teilnahme an allen erdenklichen Bestrebungen, die nichts bezwecken, als den kleinen Leuten den Kopf zu verdrehen, diese ewigen Arbeiten für alle möglichen Weihnachtsbescherungen, die Gift sind für deinen schwächlichen Körper, diese Liebedienerei gegen die kleinen Leute — ich kann sie nicht billigen, ich wünsche nicht, dass meine Tochter sich an ihnen beteiligt. Sage es deinem Herrn Pastor: ich wünsche es nicht!“
„Er meint, die Armut wäre bei uns gross,“ warf Else ein.
„So?!“ rief Wolters und auf der gewölbten weissen Stirn schwoll eine dunkle Ader an, „das sagt er! Nun, er wird der letzte sein, der es ändert, er —“
Er sah es feucht glänzen in den Augen seiner Tochter — er wollte sie nicht kränken. Sie war der Liebling, das Sorgenkind seiner ihm zu früh entrissenen Gattin gewesen.
Lebendiger als je zog in diesem Augenblick das Gedächtnis an die Verstorbene durch seine Seele.
Er hatte sie geliebt, emporgesehen hatte er zu ihr wie nie zu einem anderen Menschen, aber innerlich nahe war er ihr nie getreten — eine zu tiefe Kluft hatte sie beide getrennt. Sie waren so ganz verschieden geartet, er praktisch tätig, dabei heiter und dem Genusse geneigt, wo er sich ihm bot — sie ernst und von einer tief innerlichen Frömmigkeit, die ihm wie ein Heiligtum erschien, in das er nie treten konnte, das seiner Richtung und Natur für immer verschlossen blieb und ihm um so verehrungswürdiger war.
Er hatte sich bemüht, ihr wenigstens äusserlich gleich zu werden, er begleitete sie in die Kirche, ja zum Abendmahl, er wurde die Säule des Gemeinde-Kirchenrats, er versäumte nie eine Sitzung oder Versammlung — aber ihrer tiefen und stillen Frömmigkeit gegenüber war die seine wesenlos. Er fühlte es, er litt darunter — jedoch er konnte es nicht ändern.
Als aber seine Gattin starb, still und ergeben, wie sie gelebt, als sie von ihm Abschied nahm, ohne jeden Hauch von Todesangst, da wurde sie ihm zur Heiligen.
Als eine Heilige lebte sie fort in seinem Herzen — er hatte nie daran gedacht, eine andere an ihre Stelle zu setzen. — Und wunderbar — nun sah er sie gleichsam wieder auferstehen und aufleben in seiner jüngeren Tochter.
Das waren nicht nur dieselben bleichen, mädchenhaften Züge, in denen verräterisch der leise Keim derselben Krankheit sich regte, dieselben zarten Formen des Gesichts und der schlanken Gestalt — es war dieselbe streng verschlossene Innerlichkeit und dieselbe stille und tiefe Frömmigkeit.
Und unverständlich, wie seiner innersten Natur seine Frau geblieben, war ihm seine Tochter.
Er war an das Fenster getreten. Vom Himmel wirbelten die dichten weissen Schneeflocken, die Menschen eilten schnell aneinander vorüber; eine grimmige Kälte herrschte draussen.
Da klang von draussen das helle Geläut eines Schlittens, nicht von der fernen Strasse her, wie die anderen, nein, näher, immer näher die kleine Rampe empor, die zur Villa hinaufführte, und nun hart an dieser verstummend.
Ein eilender Schritt flog die Treppe empor, ein bekannter, stürmender Schritt —
„Margarete!“ rief Else aufjubelnd und flog in die Arme der Schwester, die sie herzlich küsste, und dann, aus ihrer Umarmung sich befreiend, dem Kommerzienrat entgegeneilte.
„Mein Vater, mein lieber, guter Vater!“
Um ihre Schultern hing noch immer der grosse blaugefütterte Pelzmantel, tief in das rotgefärbte Antlitz hinein senkte sich das schwarze Pelzbarett; aber unter ihm leuchteten die grossen blauen Augen in Freude und Glück.
„So schnell habt ihr mich nicht erwartet, nicht wahr? Noch gestern hatte ich mich hingesetzt, an euch zu schreiben. Aber gerade gestern — auf einem Ball draussen im Kasino — sehe ich so einen kleinen Backfisch, der zum ersten Male tanzt, und an seiner Seite einen zärtlichen, ritterlichen Vater. Und die beiden sehen aus wie ihr, wie du, meine kleine Else, und der Papa!
Und ich muss sie immer wieder ansehen und immer wieder an euch denken. Und als ich heute morgen aufwache, da konnten sie reden und bitten wie sie wollten — nur ein Wunsch, nur ein Gedanke war noch da: nach Hause — zu euch!“
Mit einer schnellen Bewegung hatte sie den schweren Mantel von der Schulter geworfen und vom Kopfe das Barett genommen. Else war ihr behilflich, ihr Auge hing bewundernd an der schönen Erscheinung der Schwester.
„Weisst du übrigens, kleine Else,“ wandte sich diese zu ihr und strich ihr zärtlich über die gescheitelten Haare, „weisst du, dass du mir gar nicht gefällst?! Du siehst bleich aus, wie damals, bei meiner Abreise. Ich glaube, du denkst noch immer zu viel nach. — Höre, Papa, jetzt habe ich es! Wir wollen die kleine Else nach Berlin zum Onkel schicken. Das wird etwas für sie sein! Nein, das Leben dort! Davon könnt ihr euch gar keinen Begriff machen! Herrlich, sage ich euch! Da weiss man doch, dass man jung ist und wozu man auf der Welt ist!“
„Aber, Grete, du vergisst — ich gehe doch zum Konfirmandenunterricht —“
„Ah, du gehst zum Konfirmandenunterricht! Sehr wahr! Wie konnte ich auch das vergessen!“
Ihre Sprache klang gedehnt, wie leiser Hohn blitzte es durch ihre Worte.
„Und das ist freilich etwas überaus Wichtiges! Besonders beim Pastor — o verzeih’, nun weiss ich sogar den Namen des grossen Mannes nicht einmal. Und ihr habt mir doch so oft von ihm geschrieben — ah, richtig, ja, Herr Pastor Werder — ich bin begierig, ihn kennen zu lernen.“
Ein Brief wurde an den Kommerzienrat abgegeben. Else entfernte sich, um nach dem Essen zu sehen.
Indessen hatte Wolters den Brief durchlesen. —
„Das setzt allem die Krone auf!“ rief er mit einer Stimme, deren Erregung er nur mit Mühe meisterte.
„Was hast du denn, Vater?“
„Die unbegründetsten Anklagen gegen meinen Fabrikarzt!“
„Gegen wen?“
„Gegen Doktor Martens.“
„Martens?!“ wiederholte Margarete. In ihren Augen flammte es leicht auf. „Martens?! Was hätte der verbrochen?“
„Er vernachlässigt seine Pflicht auf unerhörte Weise, fährt auf Jagden und Essen, indessen seine Kranken nach ihm schreien.“
„Wer in aller Welt wagt es, ihm das vorzuwerfen?“
„Herr Pastor Werder!“
„Der — was geht den die ganze Sache an?“
„Er ist der Heiland der Armen und Beladenen — er führt ein strenges Regiment.“
„Auch über dich — über uns alle? Ihr habt den Mann zu sehr verwöhnt — da ist er übermütig geworden!“
„Herr Pastor Werder wünschen den Herrn Kommerzienrat auf einen Augenblick zu sprechen,“ meldete der Diener.