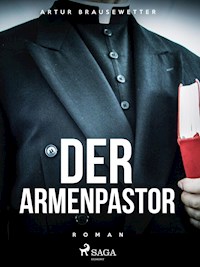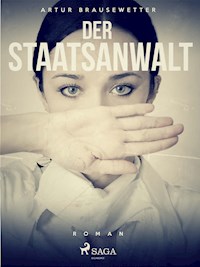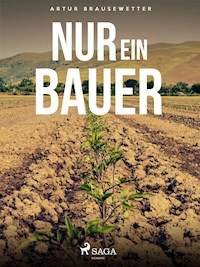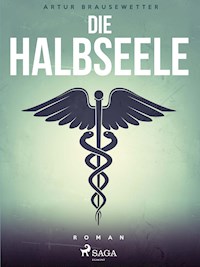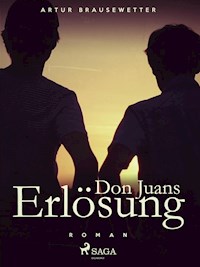Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Inge Ravenhorst wird an einem diesigen Februarmorgen von einem Unbekannten mit vorgehaltener Pistole gezwungen, ihm bei seiner Flucht vor der Polizei behilflich zu sein. Wie sich herausstellt, sind viele Schicksale mit dem geheimnisvollen Fremden verknüpft. Das der jungen Lore Meerwald, die folgenreiche Verletzungen von einem Hundebiss davonträgt, das des Wunderheilers Manfred Kosack mit legendärem Ruf, das des Gutsbesitzers von der Marwitz, dessen Tochter Gina sich nur aus Gründen der "Zuchtwahl" verloben will, und auch das Leben Karl Bernhardis, des Rechtsassessors ohne Anstellung. Kosacks Sanatorium "Fichtenhöhe" wird zum Zufluchtsort zahlreicher Kranker. Wird es weiterbestehen und wird Lore dort geheilt werden? Und wird Inge Ravenhorst das Trauma jenes Februarmorgens überwinden?-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Brausewetter
Tore öffnen sich
Roman
Saga
Ebook-Kolophon
Artur Brausewetter: Tore öffnen sich. © 1936 Artur Brausewetter. Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711487808
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
Inge Ravenhorst sass in ihrem Wagen und überdachte die Besuche und Besorgungen, die sie im Laufe eines reichbesetzten Vormittags abzufahren hatte. Einige Familien, bei denen die Eltern verkehrten, hatten sie miteingeladen, vermutlich weil man den Tanz, der in den harten Zeiten als stillos in ihren Kreisen angesehen wurde, jetzt, wo alles neu aufzuleben schien, in sein altes Recht einsetzen wollte. Ihr war wenig daran gelegen. Sie befand sich in den Jahren eines Mädchens, das zu alt war, um jede Woche viermal zu tanzen, zu jung, um in gesellschaftlicher Beziehung ohne Wunsch zu sein.
Obwohl der Februar bereits zu Ende ging, war der Vormittag kalt und nebelschwer. Die Sonne, die sich eben nach zähem Kampf aus einer Mauer dichtgeschuppter Wolken durchgerungen, blinzelte mit schläfrig verdriesslichen Augen in eine Welt, die ihr wenig zu gefallen schien.
„Zum Senatspräsidenten!“ rief sie dem leichtergrauten Wagenführer zu.
Der Schutzmann an dem altertümlichen Hohen Tor, das als die Zierde einer vergangenen Zeit das Stadtbild ebenso schmückte, wie es den hier besonders starken Verkehr hinderte, hatte den Stab erhoben. Mehrere elektrische Bahnen und eine Reihe verschiedener Gefährte hatte sich angereiht. So dauerte es eine Weile, bis sich ihr Wagen langsam in Bewegung setzte.
Da, als sie eben das Tor durchfahren hatten, wurde die Tür mit energischem Ruck geöffnet. Ein junger Mann hatte sich mit schnellem Satz auf das Trittbrett geschwungen, stieg zu ihr in den Wagen, nahm an ihrer Seite Platz.
Mit grenzenlosem Erstaunen blickte Inge auf den unerbetenen Gast. Sie kannte ihn nicht, erinnerte sich nicht, ihm jemals begegnet zu sein.
„Verzeihen Sie, wenn ich Sie erschreckt haben sollte. Aber ich muss Sie schon bitten, mich eine Strecke mitzunehmen.“
„Was wollen Sie von mir?“
Das war das einzige, was sie hervorzubringen vermochte.
„Ich werde Ihrem Wagenführer die nötige Weisung geben.“
Und nun durch das oben ein wenig gelüftete Fenster zu diesem: „Sie fahren mich auf geradem Wege und so schnell wie möglich nach“ — er nannte einen Vorort der Stadt —, „dort halten Sie am Bahnhof und lassen mich aussteigen.“
Der Wagenführer, unschlüssig, ob er der in kargem Befehlston gegebenen Weisung folgen sollte, blickte sich nach seiner Herrin um. Die erwiderte nichts. Da machte er einen Versuch, zu stoppen.
In demselben Augenblick war das Fenster heruntergelassen. Ein Arm legte sich auf seine Schulter.
„Wenn Sie auch nur den leisesten Versuch machen sollten, den Wagen anzuhalten, langsamer zu fahren oder gar Vorübergehende anzurufen, so werden Sie Ihr Leben aufs Spiel setzen. Deshalb rate ich Ihnen, unentwegt und mit grösster Geschwindigkeit zu fahren, wohin ich Ihnen befahl. In dreissig Minuten geht mein Zug, bis dahin muss der Bahnhof erreicht sein.“
Durch den langsam einsetzenden Regen glitt der Wagen die trübdunkle, von allerlei Gefährten, eilenden Fussgängern durchquerte Strasse entlang. In den Läden und Schaufenstern leuchteten vereinzelte Lichter auf, warfen müden Widerschein auf den blassblanken Asphalt.
Als wollte sie nichts sehen und hören, lehnte Inge den Kopf an das Polster, sass starr, unfähig jeden Wortes, jeder Bewegung. Furchtsam war sie nicht. Der Vater hatte sich manches Mal über den Mut und die Tapferkeit gefreut, die sie unerwarteten Ereignissen gegenüber an den Tag legte. Diesmal aber versagte ihre Tapferkeit. Es war alles zu plötzlich über sie gekommen, erschien zu unfassbar und geheimnisvoll.
Das Stadtbild war verlassen. In ungehemmter Fahrt flog der Wagen über die Landstrasse. Kleine Gehöfte, vereinzelte Häuser, Baumskelette wirbelten vorbei. Blasse Schneeflocken, die keine Lebenskraft besassen, tanzten unschlüssig und ziellos durch die feuchtkalte Luft. Über die Strasse kroch der Nebel, stieg an den Häusern empor.
Der fremde Mann erhob sich, schloss das Vorderfenster bis nach oben.
Nun war auch jede Verbindung mit dem dort am Steuer abgebrochen.
Als er sich wieder neben ihr niederliess, sah sie in seiner Hand etwas aufleuchten: eine Pistole. Aus dieser Pistole war geschossen worden ... eben erst. Sie fühlte, sie wusste es.
Ein Schauder fasste sie. Sie war ihm ausgeliefert — rettungslos.
Jetzt bemerkte sie, wie er die Pistole sicherte, in seine Tasche steckte.
„Sie hat ihren Dienst getan“, sagte er, als wollte er sie beruhigen.
Kein Laut kam von ihren Lippen. Aber die Angst stieg ihr bis an die Kehle.
„Es tut mir leid, gnädige Frau, Ihnen solche Ungelegenheit bereiten zu müssen. Aber mir blieb kein anderer Weg.“
Weiter flog der Wagen ... die lautlose, endlose Strasse entlang. Minuten wurden Ewigkeiten.
Nun überwand sie sich und streifte ihn mit einem flüchtigen Blick. Er trug einen dunklen Wintermantel und steifen Hut. Dann sah sie auch sein Gesicht. Es war etwas in ihm, das sich einprägte: ein männlicher Zug, ein energischer Mund, leidenschaftliche, zugleich traurige Augen. Und mit solchen Augen ein Mörder!
„Um Gottes willen — was haben Sie getan?“
Ohne dass sie es wusste, war es über ihre Lippen gekommen. Er antwortete nicht.
Ein Block eng zusammengebauter Häuser tauchte auf. Die Strasse wurde lebhaft. Ein hoher, spitzer Kirchturm ragte in den verschleierten Himmel. Sie waren in Bäumelburg, jenem Ort, den er dem Fahrer gewiesen.
Er schloss seinen Mantel fest zu, streifte einen waschledernen Handschuh über die linke Hand, ruckte den Hut tiefer ins Gesicht.
„Bevor wir auseinandergehen“, wandte er sich zu ihr, „habe ich noch eine Bitte, ja Forderung an Sie: dass Sie nirgends und niemandem von diesem Vorfall erzählen. Weder Ihrem Gatten, wenn Sie verheiratet sein sollten, noch Ihren Eltern, noch irgendeinem anderen. Und dass Sie, sollten wir uns im Leben noch einmal begegnen, mich nicht kennen.“
Er sagte es in bestimmtem, fast hartem Ton. — „Ebenso haben Sie Ihrem Wagenführer unbedingte Schweigepflicht aufzuerlegen. Sollte er sie brechen, so würde es sein Tod sein. Sagen Sie ihm das!“
Er machte ihr eine kurze Verbeugung, öffnete den Schlag, sprang mit elastischem Satz heraus, war in der dunklen Bahnhofshalle verschwunden, ehe noch Friedrich Glienke seinen Wagen zum Halten gebracht.
„Jetzt ihm nach!“ rief dieser, indem er seinen Sitz verliess und an die noch offenstehende Tür trat.
„Gnädiges Fräulein werden ruhig hier sitzenbleiben. Der Zug ist noch nicht eingelaufen. Wenn ich sofort Lärm schlage oder in diesem Nest ein paar handfeste Kerle auftreibe —“
„Sie werden weder das eine noch das andere tun“, entgegnete Inge und wunderte sich über die Ruhe, die sie plötzlich wieder hatte.
„Na ... warum denn nicht?“
„Weil er Sie niederschiessen wird, wenn Sie die geringste Anstalt machen werden, ihn zu verfolgen ..., ja, ganz sicher würde er es tun.“
Friedrich Glienkes Wagemut war so schnell gesunken wie er gekommen war.
„Na ... denn lieber nich.“
Sehr beherzt war er in seinem Leben nie gewesen. Und schliesslich — was ging die Sache ihn auch an?
Ein Zug polterte in den Bahnhof. Eine kurze Pause. Ein Pfiff. Dann ratterte er weiter.
Nun war er fort.
„’s wär’ auch schon zu spät!“ rechtfertigte sich Friedrich Glienke und wollte seinen Führersitz wieder einnehmen. Sie aber hielt ihn zurück. „Eins noch. Er trug mir auf, Ihnen zu sagen, dass Sie mit niemandem, weder mit der Herrschaft noch mit einem anderen, je ein Wort über diesen Vorfall sprechen dürften und drohte —“
Da kam Friedrich Glienke ein erleuchtender Gedanke:
„Ach so! Jetzt hab’ ich’s! Der vermaledeite Kerl, den wir hier zum Bahnhof gefahren haben, ist der Raubmörder von gestern abend, den sie überall suchen!“
Entsetzen packte Inge. In der Tat — ein Raubmord war es gewesen, von dem der Vater gestern abend —
„Tausend Mark haben sie auf die Ergreifung des Schuftes ausgesetzt! Und wir haben ihn hier im Wagen und lassen ihn entwischen!“
Nun schien es ihm doch leid zu tun, dass er sich eine so hohe Belohnung hatte entgehen lassen. Aber vielleicht gab es noch eine Möglichkeit —
„Von Schweigen kann jetzt keine Rede mehr sein“, meinte er. „Und wenn er das gnädige Fräulein und mich auch mit dem Tode bedroht, die Polizei wird’s schon aus uns ’rausholen. Wir sind jetzt doch die wichtigsten Zeugen geworden. Wenn er der gesuchte Raubmörder ist —“
„Nach einem Raubmörder sah er nicht aus.“
Aber freilich — dann war es ihre Pflicht, unumwundenes Zeugnis abzulegen. Ihr graute vor dem Gedanken —
„Zurück!“ befahl sie.
Friedrich Glienke drehte die Kurbel an, setzte seinen Wagen in Bewegung, fuhr mit einer Schnelligkeit, die er sich nur hier auf der freien Landstrasse, auf der er vor Aufsicht sicher war, erlauben durfte. Aber die da drinnen merkte nichts davon.
Die Stadt war erreicht. Durch die grosse Allee flog der Wagen, dass die dichtgepflanzten entlaubten Lindenstämme wie gefällte Riesen über- und durcheinanderpurzelten. Selbst am Ende der Allee, als die Strassen begannen, gab er wenig nach. Sie sollten ihm nur kommen, sollten nur Miene machen, ihn aufzuschreiben! Er wollte ihnen schon sagen, was es galt und weshalb er sich den Teufel um die vorgeschriebene Kilometerzahl kümmerte.
Aber da, als er in die Nähe des Hauptbahnhofs gelangt war, stand ein Schutzmann ... noch einer ... wieder einer. Was war denn los? Warteten sie schon auf ihn? Eine ganze Kette bildeten sie, hoben energisch Arm und Stab, liessen niemand durch, sperrten jeden Zugang, auch den Fussgängern, die von allen Seiten andrängten.
Jetzt auch berittene Polizei. Hart prallte der Hufschlag der trabenden Pferde auf das Pflaster. Einer von ihnen ritt in die Menge, die nicht mehr zu halten war.
Inge liess das Fenster hinunter. Was war geschehen?
Schon stand Friedrich Glienke am Schlag.
„Sie haben den Raubmörder. Aus dem Zug haben sie ihn geholt! Eben jetzt! Es hat ihm alles nichts genützt.“
Triumphierend sagte er es. Und doch war eine Enttäuschung in ihm. Um seine Belohnung war er nun gekommen. Aber vielleicht — wenn er die Sache geschickt anfasste —?
„Werden wohl hier ’ne Weile stehen müssen. Erst müssen sie ihn doch transportieren. Den Teufel auch! Da bringen sie ihn schon.“
Lautes Rufen und Kreischen und Johlen, Drängen von allen Seiten her. Das Aufgebot von Polizei erweist sich als nicht stark genug. Dichter schiebt sich der Haufen vor, sucht die lose geschlossene Kette zu sprengen, hebt die Fäuste, stösst Schmähungen und Verwünschungen aus, als wollte er sich auf den verruchten Mörder stürzen, ihn auf der Stelle lynchen.
Da sprengt in gestrecktem Galopp ein höherer Offizier herbei. Eine Eskorte von Reitern, die man zur Verstärkung gerufen, folgt ihm.
„Seid vernünftig, Leute! Sonst mache ich ernst!“ ruft er in die auseinanderstiebenden Haufen hinein.
Das wirkt. Man kommt zur Besinnung und hält sich zurück. Einige Verwegene sind gefasst und abgeschoben.
Hart an Inges Wagen nimmt der Offizier Stellung. Er kennt diesen, kennt auch sie. Auf einigen Gesellschaften ist er mit ihr zusammengekommen. Er reitet an sie heran, grüsst sie vom Pferde herab.
Da kommt sie, die solange wie gelähmt auf ihrem Sitz verharrt, zur Besinnung.
„Herr Hauptmann“, ruft sie ihm durch das geöffnete Fenster zu, „gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, dass ich den Mann, den sie da eben abführen, auf eine Sekunde sehen könnte?“
„— Sie ihn sehen?“
Er hat nicht recht verstanden.
„Ich habe selbstverständlich einen Grund für diese Bitte. Es wäre möglich, dass ich eine sehr wichtige Aussage machen könnte.“
„In diesem Falle, ja. Der Wagen, in den man ihn da lädt, fährt unmittelbar an dem Ihren vorbei. Wenn Sie also achtgeben wollen —“
Schon naht das von mehreren Schutzleuten besetzte, von berittener Polizei zu beiden Seiten eingeschlossene Gefährt. Die immer noch dichtgestaute Menge macht eine langsame Fahrt notwendig.
Einen kurzen, scheuen Blick wirft Inge durch das Fenster.
Nein, der blutjunge, todbleiche Bursche, der, an den Händen gefesselt, in zerfetzter Kleidung dort zwischen den Bewaffneten sitzt — — —
So stark ihre Erregung ist, wie von schwerem Alp erlöst, lehnt sie sich in das Polster.
„Nun, gnädiges Fräulein —?“
„Ich danke Ihnen, Herr Hauptmann. Es war ein Irrtum.“
Der Offizier grüsst, gibt seinem Rappen die Sporen.
„Wohin jetzt?“ hört sie Friedrich Glienke fragen.
Ja, wohin jetzt? Nach Hause? In dieser Verfassung? Unmöglich! Besuche machen? Noch unmöglicher!
Was war das alles denn nur, was sie da eben —? Ein Traum? Nein ... nein! Es war ja Wirklichkeit. Aber dass sie ihn für einen Raubmörder gehalten hat! Nun ... eine Pistole hatte er ja auch. Ganz deutlich hatte sie sie gesehen.
Friedrich Glienke wiederholte seine Frage.
Ja, wohin jetzt? Nein, auch keine Besorgungen! Doch ... eine ... die musste erledigt werden. Das Rote Kreuz, dessen Vorsitzende die Mutter ist, gibt heute in der Stadthalle sein lange vorbereitetes Wohltätigkeitsfest. Sie hat in einem Tanze mitzuwirken. Furchtbarer Gedanke! Wozu ist alles so etwas nur? Welchen Sinn hat es, besonders wenn —? Aber jetzt im letzten Augenblick absagen? Schon der Mutter wegen darf sie es nicht. Die ganze Veranstaltung wäre gestört. Ihr Kostüm, das noch nicht recht sass, hat sie bei der Schneiderin — — —
„Zu Frau Meerwald!“
*
Die Anprobe war beendet. In völliger Abwesenheit hatte Inge sie über sich ergehen lassen. Und während Frau Meerwald sich in Lobeserhebungen erschöpfte: zu welcher Geltung ihr Wuchs in dem schmucken Biedermeierkleid käme, wie ausgezeichnet der hellblaugepresste Samt mit dem silbergrauen Pelzbesatz zu dem dunklen Blond ihrer Haare passte, irrten ihre Gedanken durch allerlei Labyrinthe und Wirrnisse und waren von nichts so weit entfernt als von dem Fest, auf dem sie heute für Kranke und Kriegsbeschädigte tanzen, und von dem Kleid, das sie dabei tragen sollte.
Sie setzte den Hut auf, wollte sich verabschieden —
Doch nein, das ging ja nicht. Frau Meerwald hatte eine Tochter, die, durch einen bösen Unfall schwer verletzt, heute morgen erst aus dem Krankenhaus entlassen war und nun da drüben in ihrem kleinen Zimmer lag.
In einem Hause aufgewachsen, über das die schweren Nöte und wirtschaftlichen Sorgen der Zeit spurlos dahingegangen, von der zärtlichen Liebe zweier Eltern behütet, deren Lebenszweck die einzige Tochter war, gesellschaftlich verwöhnt und gefeiert, hatte Inge von dem, was ausserhalb ihrer Kreise vor sich ging, wenig Ahnung. Sie wusste nichts von dem heissen Ringen und Entbehren, das die Jugend anderer Kreise heute durchzumachen hatte, war viel zu sehr mit sich beschäftigt und hatte sich durch einen genügsam behaglichen Egoismus vor allem, was unangenehm und traurig war, mit einer Absichtlichkeit bewahrt, die ebenso ihre wie ihrer Eltern Schuld war, wenn von einer solchen die Rede sein konnte.
So war auch die Frage, mit der sie sich nach dem Befinden der armen Lore erkundigte, mehr von einer gesellschaftlichen Höflichkeit eingegeben, die ihr allmählich in Fleisch und Blut übergegangen war, als von einer inneren Teilnahme. Dabei kannte sie das tapfere junge Mädchen. Es bediente sie stets und mit grossem Geschick, wenn sie ihre Einkäufe in dem Geschäft machte, in dem Lore Meerwald seit mehreren Jahren als Verkäuferin angestellt war.
Ihrer Mutter aber tat die Teilnahme der vornehmen Kundin sichtbar wohl. Sie streifte die glatt eingestellte Miene der um ihre Damen beflissenen Modistin von sich, war nur noch Mutter, die um ihr Kind sich sorgt:
„Es wird nicht besser. Die Wunde ist noch immer offen. Hundebisse heilen schwer. ‚Man muss Geduld haben‘, das ist der Trost, den ihr der Professor jedesmal gibt, wenn er sie verbindet.“
„Solch ein infamer Hund!“
Ohne Ärger oder gar Leidenschaft erwiderte es Inge. Sie warf es so nebenhin. Ihre Gedanken gingen heute andere Bahnen. Am liebsten hätte sie der Schneiderin von dem unglaublichen Erlebnis erzählt. Es wäre Wohltat gewesen, sich wenigstens einem Menschen aussprechen zu können. Aber das durfte sie ja nicht. Niemandem! Nicht einmal den Eltern. Denn ihr Leben war bedroht. Und nichts war ihr so wichtig und erschien ihr so wertvoll wie dieses.
„Ja“, erwiderte Frau Meerwald. „Das sagt Herr Bernhardi auch immer. Er hatte eine derartige Wut auf den Hund —“
„Herr Bernhardi ... wer ist das?“ fragte Inge zerstreut.
„Der junge Assessor, der bei uns wohnte. Ich erzählte dem gnädigen Fräulein wohl einmal von ihm. Er hoffte, hier eine Anstellung zu finden. Aber mit den studierten Herren ist es noch schlimmer als mit den einfachen. Denn wenn man bedenkt, was die alles lernen und studieren und die Examen, die sie haben machen müssen, und das viele Geld, das es die Eltern kostet. Und dann alles umsonst! Er hätte jede Stelle angenommen, keine wäre ihm zu gering gewesen. Daher kam denn auch das ganze Unglück.“
„Ihr Mietsherr hatte daran schuld?“
„Nun, schuld gerade nicht. Ihm war alles fehlgeschlagen. Er hatte keinen Pfennig mehr und musste deshalb auch seine Wohnung aufgeben. Da liess der alte Feldhammer eine Anzeige erscheinen, dass er einen Privatsekretär für den Nachmittag suche. Er meldete sich, und Lore erbot sich, seine Bewerbung, da ihr Weg zum Geschäft sie an dem Hause vorüberführte, dort abzugeben. Da fiel der Hund über das arme Mädel her. Sie können sich mein Entsetzen denken, als ich plötzlich vom Krankenhaus angerufen werde, meine Tochter sei dort eingeliefert und eben operiert worden. Der Professor beruhigte mich zwar: es wäre nur ein kleiner Eingriff gewesen. Aber ich habe immer die Furcht, dass das Mädel nicht wieder richtig wird gehen können und dass sie womöglich noch ihre Stellung verlieren wird. Sie fehlt jetzt bereits sechs Wochen im Geschäft, und man kann nicht wissen, wielange es noch dauern wird. Und das wäre hart für uns. Denn von meiner Schneiderei könnte ich uns beide bei diesen Zeiten nicht ernähren.“
„Aber Ihre Tochter ist doch in einer Krankenkasse. Sie muss es als Angestellte ja sein.“
„Gewiss. Aber die weigert sich zu bezahlen. Sie hat die ganze Rechnung vom Krankenhaus an den alten Feldhammer überwiesen, weil der Unfall durch seinen Hund herbeigeführt ist.“
„Dann muss der dafür aufkommen. Geld hat der alte Geizhals genug und kann sich freuen, es einmal für eine gute Sache zu verwenden.“
„Er denkt nicht daran. Er hat sich um das arme Mädel nicht ein einziges Mal gekümmert, und auf die Eingabe, die Herr Bernhardi für die Lore machte, antwortete er, sein Hund sei versichert. Wir sollten uns an die Versicherung halten.“
Inge überlegte, ob sie der Kranken einen Besuch machen müsste. Doch schon stiegen Bedenken in ihr auf: Was sollte sie ihr sagen? Trösten konnte sie schlecht. Und ein paar Redensarten zu machen lag ihr noch weniger. Die bekam sie schon in den Gesellschaften nicht über die Lippen, obwohl ihr die Mutter dann Unhöflichkeit vorwarf. Aber niemand kann gegen seine Natur. Die ihre war bei ruhig gesichertem Selbstbewusstsein im letzten Grunde von einer manchmal fast scheuen Zurückhaltung. Wer sie nicht kannte, legte sie ihr als Stolz oder Kälte aus. Aber von beiden war sie weit entfernt.
‚Nein‘, entschied sie schliesslich. ‚Wer eine Kranke besuchen will, der muss mit seinem Herzen bei ihr sein. Ich aber bin nur noch bei mir, bin mit soviel Gedanken und Fragen beschäftigt, die nicht zur Ruhe kommen wollen, dass man es sofort fühlen würde.‘
Sie sagte Frau Meerwald ein paar freundliche Worte und liess sich ihr Kostüm in den Wagen tragen.
In ihrem kleinen Mädchenzimmer, das ihr die Mutter mit viel Liebe eingerichtet und dessen Wände sie selber mit einigen guten Steindrucken geschmückt hatte, lag Lore Meerwald.
Gewiss, sie konnte das Bett den Tag über verlassen und auf dem Sofa ruhen. Sie sah auch kaum wie eine Leidende aus. Die Farben ihres hübschen, vielleicht etwas derben Gesichts waren frisch, und in den kecken blauen Augen hatte auch die lange Krankheit die sprudelnde Lebenskraft nicht auszulöschen vermocht. Aber das Gehen fiel ihr noch schwer, obwohl der Professor ihr Bewegung zur Pflicht gemacht hatte. Da die Mutter jetzt für zwei zu arbeiten hatte, war sie viel allein. Ab und zu besuchte sie wohl eine Kollegin aus dem Geschäft. Aber das war doch nur in den Abendstunden, wenn sie frei hatte, und dann ging sie auch lieber mit ihren Freunden in ein Café oder ins Kino.
Sie war ein Kind ihrer Zeit, wenn sie sich auch von deren Auswüchsen fernhielt. Sie liebte ihre Arbeit und tat gern und gewissenhaft ihre manchmal nicht leichte Pflicht. Danach aber wollte sie auch ihren Feierabend und sein Vergnügen haben, wollte den Tag pflücken wie eine schöne Blume, die am Wege stand, und, wenn es einen lustigen Tanz galt, auch gern die Nacht zu Hilfe nehmen.
Das alles war nun vorbei ... vielleicht für lange Zeit. Und darüber war sie traurig.
Da trat die Mutter zu ihr: „Der Herr Inspektor von der Versicherung ist da und will dich sprechen.“
„Lass ihn eintreten! Übers Ohr hauen lassen werde ich mich von ihm nicht.“
Zugleich aber dachte sie: ‚Wenn Kurt Bernhardi jetzt da wäre, würde alles besser werden. So aber muss ich die Sache allein erledigen.‘
„Ich bin von meiner Direktion gesandt“, führte sich Herr Rohrtanz, der Agent der Versicherung, ein, „um mit Ihnen über die Ansprüche zu verhandeln, die Sie infolge eines Hundebisses an uns gestellt haben. Ich hoffe, dass wir einig werden.“
„Wenn Sie meine berechtigten Forderungen erfüllen.“
„Jede berechtigte Forderung wird meine Gesellschaft erfüllen. Wir werden die Krankenhauskosten decken, auch etwaige Ärzterechnungen, die darüber hinausgehen sollten. Zu mehr aber werden wir uns nicht verstehen.“
„Und mein zerfetztes Kleid? Meine Unterwäsche?“
„Das sind Bagatellen, um die wir keine Schwierigkeiten machen werden.“
Herr Rohrtanz sprach ein wenig von oben herab, wie er es für die Verhandlung mit einer kleinen Verkäuferin, die schliesslich auf sein Wohlwollen angewiesen war, für gut befand.
Um Lores Lippen zuckte es unwillig. Sie lehnte sich in die Kissen zurück, blinzelte in die Sonne, der der trübe Tag einen freien Blick gönnte. Als sie die Decke zur Seite schob, um nach ihrem Verband zu sehen, kam ihr schön gebautes Bein und die schlanke Wade zum Vorschein, der auch die Verletzung keinen Eintrag getan hatte.
Herrn Rohrtanz gingen die Augen über. ‚Alle Wetter! Was ist das für ein Mädel! Wenn ich hier noch lange sitze, dann verspreche ich ihr, was sie will.‘
„Ich möchte Ihnen entgegenkommen, soweit es in meiner Macht steht. Darum mache ich Ihnen einen Vorschlag: Wir übernehmen die Kosten für das Krankenhaus nach den bei uns geltenden Sätzen.“
„Also nicht einmal alle?“
Herr Rohrtanz zuckte die Achseln, mitleidsvoll und zugleich beschwichtigend.
„Ich glaube nicht, dass meine Gesellschaft über eine bestimmte Höchstgrenze hinausgehen kann. Aber sie wird sich bestimmt mit den dortigen Rechnungen decken.“
„Und wenn mir meine Stellung gekündigt wird?“
„Wer beweist uns, dass es die Folge des Hundebisses wäre?“
„Und die Badekur, die der Arzt für notwendig hält?“
„Wer kann heutzutage Reisen machen? Ich kann es nicht, und meine Frau auch nicht. Und Sie wollen eine Vergnügungsreise machen, eines einfachen Hundebisses halber?“
Wenn Herr Rohrtanz die Bahn liebenswürdiger Verbindlichkeit jetzt verliess, so war auch das wohlerprobter Geschäftskniff, die Klientin einzuschüchtern. Aber bei Lore Meerwald war er an die Unrichtige gekommen.
„Zuerst handelt es sich weder um eine Vergnügungsreise noch um einen einfachen Hundebiss“, entgegnete sie in aufsteigender Erregung, „sondern um eine schwere Verletzung, für die Sie aufzukommen haben. Sodann werde ich den Nachweis führen, dass es ein ausgesprochen böser Hund war, der bereits mehrere Menschen verletzt hat.“
Herr Rohrtanz kniff die Augen zu. „Dieselben Argumente machte bereits gestern Ihr Rechtsbeistand geltend.“
„Mein Rechtsbeistand?“
„Jawohl. Der Herr Assessor, dem Sie Ihre Sache übertragen haben.“
„Er war bei Ihnen?“
„Er sagte, dass er unmittelbar vor seiner Abreise stünde und Ihre Angelegenheit vorher ordnen wollte.“
In Lores Zügen leuchtete es auf. ‚Wie gut von ihm!‘
Dem Agenten aber erwiderte sie kühl: „Und der Erfolg?“
„Ich sagte ihm, dass wir nichts dafür könnten, wenn sich Herr Feldhammer einen so bösen Hund hielte und ihn noch dazu zu einem sehr geringen Satze versichert hätte. Dass wir deshalb weitere Verpflichtungen ablehnen müssten. Für den Schaden, den Sie sonst erlitten haben, zahlen wir Ihnen eine Summe von hundert Mark.“
„Hundert Mark? Für alles? Sind Sie toll?“
„Solange Sie mich nicht dazu machen — nein. Aber ich will mein möglichstes tun und erhöhe die Abstandssumme, obwohl ich dadurch meine Machtbefugnis überschreite, auf das Doppelte. Ich gebe Ihnen hier ein Formular. Sowie Sie es unterschrieben haben, zahle ich Ihnen die zweihundert Mark aus.“
„Wie gnädig Sie sind!“
Die kleine Lore sagte es mit beissendem Hohn, aber schon war etwas Wehrloses in ihr. Sie überflog das bedruckte Blatt, das er vor sie hingelegt hatte.
„Hier steht, ich sollte mich mit der zu zahlenden Summe, also mit zweihundert Mark, ein für allemal abgefunden erklären. Das werde ich niemals tun.“
„Es wird Ihnen nichts anderes übrigbleiben.“
„Wie kann ich heute wissen, ob ich nicht mein Leben lang lahm sein werde, ob solch ein körperliches Gebrechen nicht einer Heirat, auf die ein Mädchen ohne Stellung doch angewiesen ist, entgegenstehen würde.“
Herr Rohrtanz verzog die Lippen zu einem halb ungläubigen, halb verliebten Lächeln, das die vielen Goldfassungen seiner Zähne freigab und ihn nicht schöner machte. Aber wieder siegten Vernunft und Versicherung.
„Mein liebes Fräulein, Sie haben doch keine Aussteuerversicherung bei uns abgeschlossen. Mit dieser stehen wir Ihnen zu jeder Zeit zur Verfügung, wenngleich sie ein schlechtes Geschäft für uns bedeuten würde. Denn ein Hundebiss wird eine so hübsche junge Dame an einer netten Partie gewiss nicht hindern.“
Lore warf den Kopf zurück. Sie war für Scherze durchaus zu haben. Herr Rohrtanz war aber nicht der Mann, dem sie sie zugestand. Sie erhöhten nur die gereizte Stimmung, in der sie sich während der ganzen Unterredung befand.
„Es ist unerhört, wie man mit einem armen Mädchen umgeht. Ahnungslos betrete ich das Haus dieses Mannes, mich eines Auftrags zu entledigen, werde von einem sibirischen Wolfshund zu Boden geworfen und zerfleischt, liege wochenlang im Krankenhaus, dulde die heftigsten Schmerzen, bin jetzt noch ausserstande, mich ohne fremde Hilfe zu bewegen, werde wahrscheinlich mein Leben lang lahm bleiben. Und für alles das wollen Sie mich mit einer Bettelsumme abfinden!“
Herr Rohrtanz machte den schwachen Versuch, etwas zu erwidern, aber sie hatte sich derartig in Empörung hineingeredet, dass sie ihm gleich das erste Wort abschnitt.
„So spielt man uns mit, nur weil wir arm sind und niemand haben, der sich vor uns stellt. Aber so verlassen, wie Sie und Herr Feldhammer denken, bin ich denn doch nicht. Was gehen Sie und Ihre ganze Versicherung mich überhaupt an? Ich halte mich an den Besitzer des Hundes und denke nicht daran, Ihr Formular zu unterschreiben. Ich werde Herrn Assessor Bernhardi beauftragen, meine Ansprüche bei Herrn Feldhammer persönlich geltend zu machen. Dann werden wir sehen, was wir erreichen —“
„Das wird Ihnen wenig nützen. Herr Feldhammer ist tot.“
Eine lange Pause. Bewegungslos sass Lore auf ihrem Ruhebett, die kleine Hand noch immer geballt.
„Er ist tot?“ wiederholte sie wie abwesend. „Und der Hund?“
„Ist auch tot.“
„Und das sagen Sie mir erst jetzt?“
„Sie liessen mich ja nicht zu Worte kommen. Als ich eben bei den ‚Neuesten‘ vorbeikam, las ich es im Schaufenster. Sie sehen, mein liebes Fräulein, ich habe Ihnen das mir irgend Mögliche vorgeschlagen und vielleicht mehr als dies. Willigen Sie jetzt nicht ein, so fürchte ich, dass meine Gesellschaft auch die recht hohen Krankenhauskosten nicht bezahlen, sondern es auf einen Prozess ankommen lassen wird, dessen Ausgang zum mindesten ungewiss sein wird. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, so unterzeichnen Sie —“
„Geben Sie her!“
Ein kurzes Schwanken noch, dann schrieb eine kleine zitternde Hand einen kaum leserlichen Namen unter das Formular.
*
„Rätselhafter Mordin der Villa Feldhammer!“
Eine dichtgedrängte Menschenmenge umlagerte das Schaufenster der „Neuesten Nachrichten“, in dem fettgedruckt auf grossem Aushängebogen diese Worte zu lesen waren.
Und darunter: „Als heute um die zehnte Morgenstunde die Aufwärterin die obengenannte Villa auf dem Hohen Wall betrat, fand sie den Besitzer, Herrn Alois Feldhammer, der das grosse Haus allein bewohnt, leblos auf seinem Armstuhl sitzend. Sein Körper wies zwei Wunden auf, die eine rührte von einem Hundebiss, die andere von einem in nächster Nähe abgegebenen Schuss her. Zu seinen Füssen streckte sich, gleichfalls erschossen, sein sibirischer Wolfshund, der seinen Herrn wohl hatte schützen wollen und dabei den Tod fand. Auf dem Boden, dicht neben dem Hund, fand man einen sechsläufigen Revolver älteren Modells, aus dem zwei Schüsse abgegeben waren. Ein Haufen grösserer und kleinerer Geldscheine, mit deren Zählung und Einordnung Herr Feldhammer gerade beschäftigt schien, lag auf dem Tische vor ihm, teilweise zerstreut auf dem Boden, so dass es den Anschein gewann, als wären die Täter in ihrer Arbeit gestört worden. Wir haben unseren Sonderberichterstatter sofort in die Villa entsandt und werden einen eingehenden Bericht über den geheimnisvollen Vorgang in der heutigen Abendausgabe bringen.“
Alfred Siedenbiedel, der seine Berichte und Feuilletons für die „Neuesten“ mit dem bereits volkstümlich gewordenen „Schnurstracks“ zeichnete, kam heute später nach Hause, als Frau Lisa, seine junge blonde Gattin, es von ihm gewohnt war. Nicht nur des Mittagessens wegen wartete sie sehnsüchtig auf ihn, sondern weil sie nach fast sechsjähriger Ehe noch in ihn verliebt war und sich Gedanken und Sorgen machte, wenn er nicht zur festgesetzten Stunde zu Hause war, obwohl sie genau wusste, dass ihm sein Beruf eine solche Pünktlichkeit nicht gestattete.
„Habe bis jetzt an meinem Bericht geschuftet“, sagte er, nachdem er ihren hübschen Mund geküsst. „Ist aber auch was geworden. ‚Graf, dieser Mortimer starb Euch sehr gelegen.‘ Mir der Alle auf dem Hohen Wall nicht minder. Es ist noch nichts geklärt. Da kann man immer Neues herausschlachten. Ich sage dir, ein Brillant reiht sich an den anderen. ‚Sehr gut‘, meinte Herr Gericke, nachdem er ihn gelesen. Ich nützte die Konjunktur und fragte ihn, ob er mir das Zeilenhonorar nicht um fünf Pfennige erhöhen wollte. Er bekam einige Anfälle, aber ich habe meine fünfzehn Pfennige. Hab’ daraufhin eine Buddel Wein mitgebracht. Und für dich einen Gast, den Correggio.“
„Nur einen? Ich hatte mich auf mehrere eingerichtet. Und Correggio? Was für ein spassiger Name!“
„Ein alter Schulfreund. Ist akademisch geprüfter Zeichenlehrer am Städtischen Gymnasium. Aber nur aushilfsweise. Liest bei uns Korrekturen. Aber wieder nur aushilfsweise.“
„Und deshalb nennt ihr ihn Correggio!“
Das Gesunde und Herzhafte, das ihr ganzes Wesen erfüllte, war auch in ihrem Lachen.
Da erschien der Eingeladene und überreichte Frau Lisa einen Strauss duftender grünweisser Nelken, der mindestens die Summe für ein Dutzend Mittagessen ausmachte, die man ihm einen Tag um den anderen aus einer Garküche schickte. Sein Äusseres war nicht gerade anziehend, der Kopf mit den borstigen gelben Haaren gross und eckig. Die Brust schmal, die in unmodernen Hosen steckenden Beine lang und spindeldürr. Aber sein Gesicht gewann durch einen leidvollen und zugleich treuherzigen Ausdruck.
„Ist auf der Redaktion etwas vorgefallen?“ fragte Siedenbiedel.
„Doch. Ein Briefträger war da und machte eine wichtige Mitteilung. Er behauptete, dass er heute morgen, als er auf seinem ersten Bestellgang war, gesehen hätte, wie ein Mann eilenden Schrittes aus der Gartentür der Feldhammerschen Villa heraustrat und sich schnell davonmachte.“
„Konnte er die Stunde angeben, in der er diese Beobachtung machte?“
„Ganz genau. Er hatte sofort nach der Uhr gesehen. Es war zehn Minuten nach zehn.“
„Du hast mit ihm gesprochen?“
„Ich fragte ihn nach Möglichkeit aus.“
„Und mit welchem Erfolg?“
„Offen gestanden kam mir die Sache nicht wahrscheinlich vor. Er will einen fremden Mann beim Verlassen der Villa gesehen haben, ist dann aber selber bis an die Haustür getreten, um die Post für Herrn Feldhammer in den Briefkasten zu stecken. Wäre ein Fremder dort eingebrochen, so hätte er doch irgendwelche Spuren bemerken müssen — an der Tür oder im Vorgarten, durch den er hindurchmusste. Vor allem hätte es ihm auffallen müssen, dass der Hund, der, wie er selber sagte, einen Mordskrach macht, sowie er sich sehen lässt, diesmal völlig ruhig blieb.“
Frau Lisa bat zu Tisch.
Aber kaum hatte sie ihrem Manne aufgelegt, als nebenan der Fernsprecher läutete. Sie hatte sich längst damit abgefunden, dass dies mit unverbrüchlicher Regelmässigkeit jedesmal geschah, wenn sie ihr Essen eben aufgetragen hatte, und unterhielt sich mit ihrem Gast über seine Kunst und sonstige Tätigkeit. Als sie dabei in sein durchsichtiges blasses Gesicht sah, kam ihr der Gedanke, dass er hungerte.
Da kehrte auch schon Fred zu ihnen zurück.
„Allerlei Neues in der geheimnisvollen Geschichte am Hohen Wall. Die Sektion hat stattgefunden. Und das Ergebnis? Dass weder Hundebiss noch die Schusswunde, die der alte Mann davongetragen, seinen Tod herbeigeführt haben. Zudem ist der sechsläufige Revolver, den man auf dem Fussboden neben ihm gefunden, einwandfrei als sein eigener erkannt worden.“
„Und was ist daraus zu schliessen?“ fragte Correggio.
„Dass ein Raubmord kaum in Frage kommt. Vielleicht überhaupt kein Täter.“
„Kein Täter?“ riefen beide.
„Aber der erschossene Hund?“
„Kann sich gegen seinen eigenen Herrn gewandt haben, der ihn in der Not erschossen hat.“
„Aber er selber hat eine Schussverletzung —“
„Die könnte er sich selber beigebracht haben. Der Mann war alt und im Gebrauch der Schusswaffe nicht erfahren.“
„Haben Sie den Hund einmal gesehen?“ wandte sich Frau Lisa an Correggio.
„Ich sah ihn in dem kleinen Vorgarten. Ein grosser zottiger Wolfshund, ein Prachtexemplar, dem man es kaum zutrauen möchte, dass er seinen eigenen Herrn anfallen konnte.“