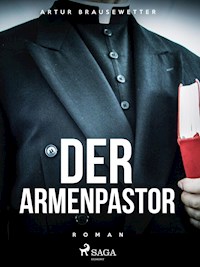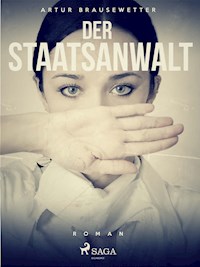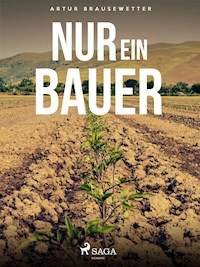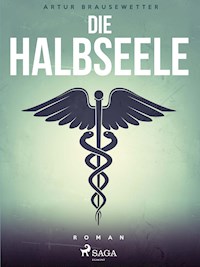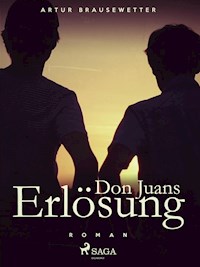Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Auf einer Seereise von Zoppot nach Swinemünde lernt Ulrich von Kleist den undurchschaubaren Herrn von Mirbach kennen und die ebenso geheimnisvolle Dame Rosi. In einer Zoppoter Villa sind eben Brillanten geraubt worden und die Polizei sucht nach den Tätern. Während der Schiffspassage verschwindet nachts aus Ulrichs Brieftasche eine größere Menge Bargeld. Ulrich von Kleist reist nach Venedig weiter und begegnet dort zu seiner Überraschung wieder Mirbach und Rosi. Außerdem trifft er dort einen alten Kameraden seines Vaters, Oberst a. D. Franz Lüderitz, der ihn wiederum mit den Damen Nebeltau – Mutter Beate mit den Töchtern Constanze und Christel – bekanntmacht, just denen, die in ihrer Zoppoter Villa Valeska beraubt worden sind. Die ganze Gesellschaft reist von Venedig nach Gossensaß in Südtirol. Dort spitzen sich die Dinge zu, als plötzlich der Prokurist der Nebeltau'schen Firma, Heinrich Westfal, vor der Tür steht. Er hat schlechte Nachrichten.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Brausewetter
Ein jeder treibt's wie er kann
Roman
Saga
Ebook-Kolophon
Artur Brausewetter: Ein Jeder treibt's wie er kann. © 1936 Artur Brausewetter. Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711487761
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
„Ja, Sie müssen auch Ihre Aktentasche öffnen!“ sagt der Zollbeamte mit Bestimmtheit, nachdem er im Verein mit einem anderen den braunen Lederkoffer auf das genaueste untersucht hat.
„Was in aller Welt ist denn hier geschehen? Eine so peinliche Kontrolle habe ich nicht einmal im Korridor erlebt. Und auf dem Schiff hat man mein Gepäck sonst kaum geöffnet.“
Der Beamte antwortet nicht, lässt den prüfenden Blick über die hochgewachsene Männererscheinung vor ihm gleiten, als sähe er sie heute zum erstenmal, nimmt die Aktentasche, holt jedes Buch, jedes Blatt aus ihr hervor, entfaltet, schüttelt, durchstöbert es, macht schliesslich mit Kreide ein kurzes Zeichen, gibt die Tasche zurück. „Ich danke.“
„Es ist allen so gegangen, die in Zoppot auf das Schiff stiegen. Man hat in der Villa einer reichen Dame, als sie mit ihrer Tochter zu einem Konzert gefahren war, einen Einbruch verübt und kostbaren Schmuck gestohlen.“
Ein mit lässiger Eleganz gekleideter noch jüngerer Mann mit hellgrauem, keck auf die Seite geschobenen Filzhut und intelligentem pfiffigen Gesicht darunter, sagt es nebenhin, bläst den Rauch der Zigarette durch die dünnen Nasenflügel, hat aber die eigentümlich schillernden Augen unter den beinahe zusammengewachsenen Brauen mit einem forschend gespannten Blick auf sein Gegenüber gerichtet.
Ulrich ist die Sache nicht geheuer. Es ist derselbe Herr, der eben, als sein Gepäck so eingehend untersucht wurde, neben ihm gestanden, jeder Frage und Bewegung des Beamten mit sichtbarer Aufmerksamkeit gefolgt ist.
„Vielleicht ein verkappter Zollbeamter!“ denkt er, hält sich zurück, obwohl der andere beflissen scheint, ein Gespräch mit ihm anzubandeln. Zum drittenmal lässt die Sirene ihren Ruf ertönen. Das Fallreep wird hinaufgezogen. Der schlanke schneeweisse Leib der „Hansestadt“ erzittert, stampfend arbeitet der Motor.
Von der erhöhten Estrade des Seesteges her ein Abschied nehmendes Winken, ein lebhaftes Schwenken von Hüten und Tüchern, scherzende und ernste Rufe, die die Abfahrenden suchen, aber in der von einem auffrischenden Wind bewegten Luft unhörbar zerflattern.
Auf dem Oberdeck, dicht an der braungetäfelten Scheidewand, die die Kommandobrücke durch ein strenges „Eintritt verboten“ von den Fahrgästen abschliesst, lehnt Ulrich an der Reeling.
Keiner da drüben, der ihm den letzten Gruss sendet, ihm Lebewohl und frohe Fahrt wünscht. Und an Bord nur fremde Gesichter. Er ist es gewohnt, empfindet kaum ein Gefühl der Verlassenheit. Es hat ja auch sein Gutes, überall fremd zu sein, ein Fremdling zu kommen, ein Fremdling zu gehen. Die Welt ist weit. Aber die Menschen sind dieselben, und die Bekanntschaften, die er auf seinen vielen Reisen gemacht, haben sich als flüchtig und leer erwiesen.
Zwar manchmal kommt es doch über einen: Einmal einen Menschen finden! Der Ausspruch einer bekannten Frau geht ihm durch den Sinn: Ich würde kein Fenster öffnen, um den Golf von Neapel zu sehen, aber Berge übersteigen und Meere durchqueren, einen Menschen zu finden.
Er kennt den Golf von Neapel, kennt alle blauen Wunder des Südens, hat die höchsten Berge bestiegen, die weitesten Meere durchfahren — — einen Menschen hat er nicht gefunden.
Nun, es muss schliesslich auch so gehen, wenn man sich selber nur hat. Und vielleicht ist die still wartende Sehnsucht nach dem Menschen besser als sein Besitz, den es im Grunde gar nicht gibt.
„Guten Tag, Herr von Kleist! Willkommen auf der Hansestadt“, ruft ihm der Kapitän von der Kommandobrücke herüber.
„Ah, Kapitano! Seemannsheil! Jubiläumsfahrt! Die zehnte, wenn mein schadhaftes Gedächtnis mich nicht trügt. Jedenfalls werden wir sie begiessen!“
Der Kapitän wechselt einige Worte mit dem diensthabenden Offizier, kommt, die absperrende Brüstung öffnend, auf ihn zu, streckt ihm die starkbehaarte Hand entgegen. „Es sind zwei Monate her, dass Sie nicht mit uns fuhren.“
„Ja, es war im Frühjahr, als ich das letzte Mal hier oben bei Ihnen war. Ich kam von meinem Gut aus Ostpreussen und fuhr mit Ihnen bis Swinemünde.“
„Um von dort eine grössere Reise anzutreten.“
„Von der ich bereits zurück bin, um mich, wie Sie sehen, von neuem auf die Fahrt zu begeben. Was bleibt einem übrig, wenn man nirgends zu Hause ist und nichts anderes zu tun hat.“
„Sie haben Ihren schönen Besitz.“
„Den besorgt mein Verwalter besser als ich. Und dann die Abende so ganz allein in einem grossen öden Gutshause — nee, das ist wirklich nichts für mich!“
„Das will ich glauben. Da karre ich schon lieber meinen Omnibus hin und her.“
Die weissen Zähne blitzen zwischen den bartlosen Lippen.
Ulrich ist erfreut, ihn wiederzusehen. Denn er mag ihn gut leiden. Es ist etwas Kerniges, der Natur und dem Meere Verwandtes in seiner gestrafften, sehnigen Erscheinung. Aus dem blendend weissen Stehkragen hebt sich der scharfgeschnittene Kopf mit den klugen Augen und der leichgekrümmten Nase. Die dunkelblaue Marineuniform mit den vier goldenen Streifen an den Ärmeln gibt ihm ein Etwas, das Eindruck macht.
„Aber manchmal ist die Sache doch nicht so einfach wie sie aussieht. Und wenn das Wetter so unsicher ist wie heute — “
„Ich glaubte, wir würden eine gute Fahrt haben.“
Der Kapitän geht an das Barometer, blickt auf den Himmel.
„Es sieht nicht gut aus“, sagt er. „Die Wolkendichtung da drüben weist auf Sturm oder Nebel. Wahrscheinlich auf beides. Aber so schlimm wird es nicht werden“, setzt er beruhigend hinzu. Denn Ulrich, der nicht seefest ist, macht ein besorgtes Gesicht.
„Vorläufig sieht es doch ganz ruhig aus.“
„Ja, weil wir jetzt noch in der Bucht sind, da merken wir vom Winde nicht viel. Wenn wir Hela hinter uns haben, wird er die Backen schon voller nehmen. Doch zum Abend wird es Nebel geben, und der ist mir weniger angenehm, weil ich gerne die Verspätung eingeholt hätte, die wir durch diese langweilige Zolluntersuchung gehabt haben.“
„Selbst meinen Koffer hat man bis auf den letzten Grund durchstöbert. Ich hätte so etwas einem alten Stammgast gegenüber auf Ihrer gastlichen Hansestadt gar nicht für möglich gehalten.“
„Es kommt auch sonst nicht vor. Aber der verdammte Zoppoter Brillantendiebstahl hat die Beamten wild gemacht. Und sie wittern in jedem den Dieb und besonders in den Frauen, die sie wenig glimpflich behandeln. Es waren schon mehrere bei mir gemeldet, die sich beschweren wollten, als ob ich etwas dabei tun könnte!“
„Hat man irgendeine Spur?“
„Nicht die leiseste. Die Sache muss mit einem unglaublichen Raffinement ausgeführt sein. Man hat einen gewiegten Kriminalinspektor aus Berlin kommen lassen. Er soll heute auch an Bord gewesen sein, und einer meiner Offiziere behauptet, dass er die Fahrt mitmacht. Aber bestimmt weiss es keiner, denn solche Leute pflegen sich durch allerlei Masken unkenntlich zu machen.“
Ulrichs Augen blicken über ihn, über das Schiff hinweg auf die weite Meeresfläche, deren Spiegel bereits aufsteigender Gischt kräuselt.
„Nun wird mir alles klar!“ ruft er lebhaft aus. „Ihr Offizier hat richtig gesehen! Der Mann ist an Bord!“
„Woher wissen Sie?“
„Weil er mich ansprach. Ganz unvermittelt nach meiner eingehenden Gepäckrevision, der er mit einer Aufmerksamkeit beiwohnte, die mir nicht entgangen ist. Ich hielt ihn für einen höheren Zollbeamten oder dergleichen. Aber es war der Berliner Kriminalinspektor, und ich hatte gleich den Eindruck, als ob er mich irgendwie ausforschen wollte.“
„Ich glaube das nicht“, erwidert der Kapitän. „Wenn er die Fahrt mitmachte, würde er sich bei mir vorgestellt haben. Das tun diese Herren meistens, schon um in etwaigen Fällen eine Unterstützung bei uns zu finden. Vielleicht auch, weil sie hoffen, durch uns auf eine Spur gebracht zu werden.“
„Er kann seine Gründe gehabt haben, es nicht zu tun.“
„Das wäre möglich, kommt wohl auch vor. Aber in diesem Falle —“
Mitten im Satz hält er inne, denn er fühlt sich heftig am Arm gefasst.
„Sehen Sie!“ hört er Ulrichs erregte Stimme, „nein .. dort auf der anderen Seite .. der Herr, der mit dem Obermaat spricht! Das ist er!“
Der Kapitän klemmt das Einglas in das rechte Auge, mustert den Fremden genau.
„Ich habe ihn noch nie auf meinem Schiffe gesehen. Nun, die Sache werden wir bald haben.“
Mit schnellen Schritten begibt er sich in seinen Empfangsraum, drückt den Knopf der elektrischen Leitung.
Friedrich Gutzke, sein Leibsteward, ein stramm gebauter Mann mit listigem, zugleich Vertrauen erweckendem Gesicht, der von seiner frühesten Jugend an bei der Marine gedient, tritt, als hätte er bereits auf den Befehl gewartet, lautlos vor seinen Kapitän, nimmt militärische Haltung an.
„Hören Sie mal, Gutzke, was ich Ihnen jetzt sage —“
„Jawohl, Herr Kapitän!“
„Sie begeben sich gleich nach unten zum Herrn Zahlmeister, sagen ihm, ich liesse ihn bitten, sich zu mir zu bemühen, und zwar so unauffällig wie möglich! Haben Sie verstanden?“
„Jawohl, Herr Kapitän!“
„Er möchte mir auch gleich die Passagierliste mitbringen und das Verzeichnis der verkauften Kabinen.“
„Jawohl, Herr Kapitän!“
Eine Minute später erscheint Leo Wörrman, der Zahlmeister, ein wohlgebauter junger Mann mit intelligentem Gesicht und dienstlich eingestellter Miene.
Der Kapitän tritt mit ihm auf die Brücke, weist auf den Fremden, der jetzt allein und ganz in den Anblick des langsam, aber bereits stetig auf und nieder gehenden Wassers versunken scheint.
„Kennen Sie den Herrn?“
„Ich kenne ihn nicht. Aber er war vorher bei mir unten und belegte eine Kabine.“
„Welche?“
„Kabine 9. Unmittelbar gegenüber der Luxuskabine des Herrn von Kleist.“
„Das kann ja nett werden“, scherzt Ulrich. Aber im Grunde ist ihm wenig scherzhaft zumute.
„Den Namen haben Sie in Ihrem Verzeichnis?“
„Ich werde nachsehen: Egon, Freiherr von Mirbach, Herr Kapitän.“
„Mirbach .. Mirbach ..?“ wiederholt Ulrich. „Ich hörte doch vor kurzem von einem Freiherrn von Mirbach, der als junger Offizier wegen einer dummen Sache — aber es gibt mehrere dieses Namens. Und es könnte auch ein Deckname sein.“
„Warum sollte ein Kriminalinspektor nicht Freiherr sein?“
„Ein Kriminalinspektor?“ fragt der Zahlmeister erstaunt.
Einen Augenblick überlegt der Kapitän.
„Es ist die Vermutung aufgetaucht, dass dieser Herr der Berliner Kriminalist sein könnte, der wegen des Zoppoter Brillantendiebstahls dorthin gesandt wurde.“
„Aber er ist bereits von Pillau aus an Bord.“
„Das würde nicht gegen die Vermutung sprechen. Er könnte die Absicht haben, die Fahrgäste zu überwachen und zu diesem Zweck die ganze Reise mitmachen. Haben Sie vielleicht bemerkt, ob er auch auf der Hinfahrt von Zoppot nach Pillau auf dem Schiffe war?“
„Das kann ich nicht sagen. Das Schiff war wegen des Königsberger Verlegerkongresses überfüllt.“
Der Kapitän begibt sich an seinen Schreibtisch, nimmt den Hörer.
„Verbinden Sie mich mit dem Passbüro!“
Und als sich dieses meldet: „Sehen Sie doch bitte gleich mal nach, ob sich unter den Pässen, die Sie ja noch zur Einzeichnung des Sichtvermerks haben, einer auf den Namen Freiherr von Mirbach befindet.“
Einen Augenblick dauert die Nachforschung.
„Nein, Herr Kapitän“, erwidert dann der Beamte. „Ein auf den Namen Freiherr von Mirbach lautender befindet sich unter den zur Kontrolle erhaltenen Pässen nicht.“
„Sehen Sie lieber noch einmal nach!“
„Ich habe ganz genau nachgesehen, Herr Kapitän. Es ist auch nicht ein auf einen ähnlichen Namen lautender Pass hier.“
Der Kapitän legt den Hörer fort.
„Also den Pass hat er nicht abgegeben“, wendet er sich an den Zahlmeister.
„Das sagt nicht viel. Es kommt öfter vor, wie der Herr Kapitän wissen, besonders bei grossem Andrang, dass ein Pass nicht abgenommen wird, wenn ihn der Besitzer aus irgendeinem Grunde nicht abgeben will.“
„Jedenfalls ist die Angelegenheit für uns belanglos“, sagt der Kapitän. „Will der Mann im Interesse seiner Untersuchungen unbeobachtet und ungekannt an Bord bleiben, so mag er seinen Willen haben. Wir wollen ihn darin nicht stören. Und entdeckt er den Täter an Bord, ist er ihm gar auf der Spur — um so interessanter.“
„Aber seltsam bleibt die ganze Sache doch“, meint Ulrich.
Friedrich Gutzke nimmt wieder militärische Haltung an: „Soll unten im Speisesaal für den Herrn Kapitän ein Tisch für das Abendessen vorbehalten werden? Und zu welcher Stunde befehlen der Herr Kapitän zu essen?“
„Belegen Sie meinen Ecktisch für 2 Personen. Nicht wahr, Herr von Kleist, Sie werden mir Gesellschaft leisten. Um 8 Uhr, wenn ich bitten darf.“
„Solch Kapitän ist doch ein Mensch!“ denkt Ulrich bei sich, als er in dem geschmackvoll eingerichteten Speisesaal der „Hansestadt“ sitzt und Friedrich Gutzke, der auch hier seinen Herrn bedient, die gebackene Steinbutte aufträgt, zu der er einen rassigen 29er Mosel schänkt. „Gibt sich schlicht und ohne Falsch, hat gute Manieren ohne Tünche und Mache, ist gesund am Körper wie im Denken, dem Genuss des Lebens nicht abgeneigt, wie man an dem Vergnügen sieht, mit dem er seine Steinbutte zerlegt und den wundervollen Neunundzwanziger über die Zunge spielen lässt. Dabei ist er ein König auf seinem Schiffe, sieht jeden Tag andere Menschen, lädt sie an seine Tafel — —“
Er wird in seinen Gedanken unterbrochen.
Ein Herr tritt, von den Stewards ehrerbietig gegrüsst, in den Speisesaal, geht auf den Tisch des Kapitäns zu.
„Ich habe die Ehre, Herrn Kapitän Flügel zu begrüssen?“ sagt er mit leicht schnarrender Stimme.
Ulrich sieht mit fragendem Erstaunen auf den Fremden.
Obwohl er jetzt so ganz anders aussieht, den Reiseanzug mit der Abendjacke vertauscht hat, die man hier nicht zum Abendessen anzuziehen pflegt, zweifelt er keinen Augenblick —
„Freiherr von Mirbach“, hörte er den anderen in seiner die Worte lässig hinwerfenden Weise weiterreden. „Ein gemeinsamer Bekannter, Herr von Telemann, der ja wohl oft auf der „Hansestadt“ fährt, wies mich an den Herrn Kapitän.“
Er überreicht eine Karte.
„Gewiss, Herr von Telemann ist manches Mal bei mir an Bord gewesen. Wir machten auch einmal, als die „Hansestadt“ zwei Tage in Swinemünde lag, einen gemeinsamen Ausflug nach Rügen. Aber wollen Sie nicht an meinem Tische Platz nehmen, Herr von Mirbach, und darf ich vorstellen?“
„Ah, .. von Kleist! Ich kannte mehrere Ihres Namens, war mit einigen von ihnen enger liiert. Da ist zum Beispiel —“
Er nennt verschiedene Namen. Aber sie sind Ulrich unbekannt, scheinen ihn auch wenig zu interessieren.
Nun sitzen sie zu dreien am Kapitänstisch, und die Unterhaltung schleppt sich, nur durch die frische Art des Kapitäns in Fluss gehalten, in jener Gebundenheit, in der die Worte keine andere Aufgabe haben, als gesprochen zu werden.
Der Fremde, der er für Ulrich trotz seiner Vorstellung bleibt, hat Gutzke einen Wink gegeben, ihm dieselbe Flasche zu bringen, die neben dem Kapitän im Eiskübel steht, und schenkt Ulrich ein. Dem ist es wenig recht; er kann es aber nicht hindern, ohne den anderen zu kränken.
Die gute Stimmung, in die ihn eben noch der feurige Wein versetzt, ist längst verflogen. Es verdriesst ihn, dass dieser fremde Mensch den unbefangenen und gemütlichen Austausch, den er gerade mit dem Kapitän gehabt, durch sein Dazwischentreten gestört und zu jener gesellschaftlich geschnörkelten Unterhaltung gewandelt hat, die ihm von Grund aus zuwider ist.
Mehr aber noch verdriesst es ihn, dass dieser Mensch, wohl wenig auffällig und niemals taktlos, aber dennoch mit beflissener Stetigkeit das scharf zufassende graugrüne Auge unter den zusammengewachsenen Brauen auf ihn gerichtet hat, als suche es in seinen Zügen zu lesen.
„Was will er nur von mir? Hält er mich für den Diamantendieb oder wenigstens für einen verborgenen Teilnehmer? Und wartet er nur auf die Sekunde, wo er seinen Unterbeamten, die er sicher auf dem Schiff verteilt hat, einen Wink geben kann?“
Noch hat die „Hansestadt Danzig“ ruhige Fahrt. Nur manchmal glucksen die Wasser stärker an den Bug. Dann schwankt und stampft der Schiffsleib, hebt sich, senkt sich. Aber die Bewegungen sind noch unverfänglich und fechten selbst die Ängstlichen nicht an.
In der Ecke, dem Kapitänstisch gegenüber, sitzt eine Dame. Sie trägt ein dunkles Wollkleid, das den Reiz des leicht geschminkten Gesichts merkbar erhöht. Sonst ist die Entfernung zu gross, als dass man sie mit einiger Deutlichkeit erkennen könnte. Nur den Umriss eines keckgezeichneten Profils sieht Ulrich und blauschimmerndes, wellig gekämmtes Haar.
Jetzt sind auch die beiden anderen auf sie aufmerksam geworden.
„Eine schmucke Frau!“ sagt der Kapitän, scheinbar froh, einen Unterhaltungsstoff gefunden zu haben. „Sie fiel mir bereits auf, als ich meinen Gang durch das Schiff machte und sie auf dem Promenadendeck in einem Liegestuhl sass .. Sie kennen Sie?“ fährt er fort, als der Freiherr, in seinem Stuhle halb sich erhebend, zu ihr hinübergrüsst, und sie mit einer leichten Neigung des Kopfes dankt.
„Flüchtig. Die Witwe des rumänischen Konsuls, der in der Gesellschaft eine Rolle spielte. Ich traf sie auf einigen Empfängen und Bällen in Königsberg.“
„Aber sie kann erst in Zoppot an Bord gestiegen sein.“
„Das mag sein. Ich bin ihr lange nicht begegnet.“
„Sie sitzt allein und scheint sich zu langweilen. Vielleicht bitten Sie sie an unseren Tisch! Oder soll ich es selber tun?“
„Ich danke, Herr Kapitän! Wenn Sie gestatten, übermittele ich Ihre Einladung.“
Nun tritt an den Tisch des Kapitäns eine vollschlanke Erscheinung und ruft eine schnelle Wandlung an ihm hervor.
Denn Frau Konsul Orloff ist nicht nur jung und fesch, sie hat eine so anziehende Art zu sprechen, zu lachen, sich zu geben, hat ein so fein abgewogenes Mass von Koketterie dabei, eine die Pikanterie leicht und sorglos streifende Art der Unterhaltung, dass sie ihrer Wirkung auf empfängliche Männerherzen von vornherein gewiss ist.
Und empfängliche Herzen findet sie hier, insbesondere bei dem Kapitän, der für hübsche Frauen eine kleine Schwäche hat. Und da ihr diese auf den ersten Blick offenbar wird, beginnt sie in weiblicher Taktik ihre Plänkeleien mit ihm.
„Es ist allerhand, Herr Kapitän, dass ich mich an Ihren Tisch verfügt habe. Denn, das darf ich Ihnen nicht vorenthalten, noch nie in meinem Leben bin ich so unfreundlich behandelt worden wie auf Ihrem Schiff.“
Der Kapitän, der leicht, insbesondere von kecken Frauen, in Verlegenheit zu bringen ist und dann wie ein Knabe errötet, nimmt das Einglas aus dem Auge, sieht sie mit seinen treuherzigen Blicken an, weiss jedoch in seiner Befangenheit nichts als ein: „Aber gnädige Frau —“ hervorzubringen.
Das entzückt und ermutigt sie zugleich, den glücklich angeschlagenen Ton festzuhalten.
„Nicht genug, dass man mir mein ganzes Gepäck durchwühlte, meine Wäsche und besten Kleider durcheinanderriss, ich musste mich, was auf einem Schiffe wohl noch nicht vorgekommen, einer höchst peinlichen und plumpen Leibesuntersuchung unterziehen, und wenn ich nicht energisch Verwahrung eingelegt, wahrhaftig, man hätte mich bis auf das Hemd ausgezogen.“
„Aber das ist doch lediglich ein Vorgehen, wenn Sie wollen, ein das Mass überschreitendes Vorgehen der Zollbehörde, für das man unmöglich den Kapitän des Schiffes verantwortlich machen kann.“
„Meine Ansicht mag Ihnen weiblich erscheinen. Aber ich meine, ein Kapitän ist der Herr auf seinem Schiffe, und wenn er der Zollbehörde auch nicht gebieten kann, soweit muss seine Macht doch gehen, die Würde einer schutzlosen Frau vor so brutalen Angriffen zu schützen.“
„Sie haben sich nicht an mich gewandt —“
„Sollte ich etwa in der Verfassung zu Ihnen auf die Kommandobrücke kommen? Nein, Herr Kapitän, das wäre denn doch nicht möglich gewesen.“
Sie neigt den Kopf zu der üppigen, aber noch in der Knospe schlummernden Maréchal-Niel-Rose hinab, die sie unterhalb der Brust angesteckt hat. Ein halb verschämtes, halb schelmisches Lächeln schwebt auf den rosig bemalten Lippen.
„Was alles ich heute schon wegen dieser Zolluntersuchung über mich habe ergehen lassen müssen! Und nichts ist daran schuld als dieser unselige Diamantendiebstahl. Und nun mussten Sie auch gerade in Zoppot einsteigen!“
„Wie viele andere.“
„Die gewiss nicht zarter behandelt wurden.“
„Mag sein. Aber wer den Diebstahl begangen, den bekommen sie trotz aller ihrer vermeintlich klugen Massnahmen, trotz ihrer brutalen Eingriffe doch nicht heraus. Er mag hier auf dem Schiffe sein, mag in diesem Raume mit uns essen, mag die Brillanten bei sich tragen — kein Zollbeamter und kein Kriminalist, auch nicht der Berliner, der mit uns fahren soll, wird sie ihm abnehmen. Denn solche Leute sind ein Teil klüger als die gewiegtesten Zollinspektoren und Kriminalisten. Die haben Verstecke, die keine Untersuchung, keine Leibesvisitation aufzustöbern weiss.“
Der Kapitän sieht sie erstaunt an, wendet sich, vielleicht um abzulenken, mit irgendeiner gleichgültigen Frage an Ulrich.
Der ist der Unterhaltung bisher nur mit halbem Ohr gefolgt. Bei den letzten Worten aber hat er aufgehorcht. Und ohne dass er es beabsichtigt hat, begegnet sein Blick dem des Freiherrn. Wieder sieht er in den grauen Augen ihm gegenüber denselben forschenden Ausdruck.
Aber nur eine kurze Weile sind sie auf ihn gerichtet. Dann gleiten sie von ihm fort zu der schönen Frau.
„Gnädigste“, sagt er in seiner ruhigen, jetzt beinahe nach einem Verhör klingenden Sprechweise, „kommen doch eben von Zoppot, waren vermutlich zur Zeit des Diebstahls dort. Können Sie uns nicht etwas von dieser bisher völlig ungeklärten Angelegenheit berichten?“
„Nur, was ich gehört habe: Dass der Diebstahl bei einer vornehmen und vermögenden Dame verübt sein soll, die mit ihren beiden Töchtern eine einsam am Waldesrand gelegene Villa bewohnt und im Begriff war, eine längere Reise in den Süden anzutreten. Einige Tage vorher gab sie, wohl zum Abschied, eine Gesellschaft, und am Abend vor der Abfahrt besuchten die drei Damen ein Konzert in Danzig. Als sie am nächsten Morgen ihre Koffer packen, entdecken sie den Diebstahl —“
„Etwas anderes war nicht geraubt?“
„Nicht das geringste. Solche Diebe pflegen ihre Spezialität zu haben und nur in ihr zu arbeiten. Übrigens haben sie ihnen noch genug für ihre Reise gelassen.“
„Hat man niemand in Verdacht?“
„Da alle Anzeichen dafür sprachen, dass der Diebstahl nur von einem in die Gewohnheiten der Damen eingeweihten Täter begangen sein konnte, verhaftete man die Zofe. Die aber konnte ihr Alibi einwandfrei nachweisen. Sie hatte die Nacht bei ihrem Geliebten zugebracht.“
„Und der?“
„War am nächsten Morgen spurlos verschwunden.“
„Aha!“
„Für den Diebstahl kam er nicht in Betracht. Er hielt sich nur vorübergehend in Zoppot auf. Niemand wusste, wer er war und wohin er gegangen. Auch das Mädchen hatte er erst in Zoppot kennengelernt, und seine Wirtin konnte bezeugen, dass es gerade zu der Zeit, da der Diebstahl begangen wurde, bei ihm gewesen.“
„Eine freilich rätselhafte Geschichte“, meint der Kapitän.
„Man nahm später noch den Lohndiener in Gewahrsam, musste ihn aber, da jeder Anhalt fehlte, wieder entlassen.“
„Seltsam“, denkt Ulrich, „dass sich der Mann von dieser Frau Geschichten erzählen lässt, die er genau kennt. Oder spielt er vielleicht nur den Gleichgültigen? Denn eine Absicht verfolgt er doch mit allem, was er sagt oder tut.“
Da hört er, wie dieser in seiner lässigen Art die unterbrochene Unterhaltung aufnimmt:
„Sie äusserten vorhin, meine Gnädigste, dass der Diebstahl unmittelbar nach einer Gesellschaft verübt wurde.“
„So wurde mir erzählt.“
„Da wird man die Zofe und den Diener zu Unrecht verdächtigt haben. Man hätte den Dieb unter den Gästen suchen sollen!“
„Ich bitte Sie! Bei der Dame — man nannte mir auch ihren Namen — verkehren die vornehmsten Kreise.“
„Um so sicherer wird sich der Dieb oder wahrscheinlich die Diebin unter ihnen befinden.“
Und dann noch gleichgültiger: „Sie verkehren nicht dort?“
Ein kurzes Aufzucken, ein spöttisch ablehnendes Lächeln.
„Nein, Herr —“
Sie unterdrückt den Namen. Sie muss ihn also kennen. Weiss vielleicht mehr von ihm, weiss — —
Der letzte Zweifel ist für Ulrich geschwunden. Er wartet nur auf den Augenblick, wo der Mann da drüben aufstehen, den Arm auf die schöne Frau legen, sie verhaftet erklären wird.
Aber nichts dergleichen geschieht.
Die Unterhaltung verlässt die eingeschlagene Bahn, wendet sich belanglosen Gegenständen zu.
Da schneiden seltsame dumpfe Töne sie ab: die Nebelhörner.
Sofort erhebt sich der Kapitän, grüsst kurz, verlässt den Speisesaal. Sein Platz ist jetzt auf der Brücke.
Man bleibt allein. Das Gespräch sickert träge dahin, verstummt manchmal ganz.
Selbst der jungen Frau scheint ihre kokette Plänkelei jetzt, wo ihr reizvoller Gegenstand verschwunden, nicht mehr zu lohnen.
Unaufhörlich, schon in geringen Abständen, ertönt das Nebelhorn.
Eine merkbare Unruhe bemächtigt sich der Reisenden. Einige Damen schrecken, sowie das Signal ertönt, nervös zusammen.
Ulrich lehnt sich in seinen Sessel zurück.
Nun ist er wieder auf der Fahrt .. irgendwohin ins Ferne .. Ungewisse .. Uferlose. Wie er es so oft gewesen .. im D-Zuge .. im Flugzeug .. auf dem Schiffe! Und weiss heute noch nicht, wohin die Fahrt führen und wo sie enden wird. Einmal vielleicht in unbegrenzten Fernen .. da, wo Meer und Land und Himmel ein Einziges nur sind .. wo der Menschen Sehnsucht verstummt. Und auch sein Zweifeln und Fragen.
Er muss daran denken, wie mancher vor ihm vielleicht auf demselben Platz gesessen und Antwort auf dieselben Fragen erheischt hat. Aber sie wurde ihm nicht.
Die Nebelsignale werden seltener. Man erwartet die Rückkehr des Kapitäns. Besonders die junge Frau, die ihre beiden Schiffsgenossen zu langweilen scheinen. Denn sie tupft mehrere Male mit den rosig schimmernden Fingerspitzen an die Lippen, das aufsteigende Gähnen zurückzudämmen.
„Sie werden vergebens warten, meine Gnädigste“, wendet sich der Freiherr zu ihr. „Solange die leiseste Nebelgefahr ist, rührt sich der Kapitän nicht von der Brücke.“
„Aber ich möchte nicht schlafen gehen, ohne ihm Gute Nacht zu sagen“, entgegnet Ulrich.
„So gehen wir zu ihm auf die Brücke!“
„Prachtvoll!“ ruft Frau Rosi begeistert. „Jetzt in der Nacht auf die Brücke!“
Man winkt dem Steward, zu bezahlen. Ulrich findet nicht das nötige Geld in seiner Börse, öffnet seine Brieftasche, die mit allerlei Scheinen dicht gefüllt ist, gibt achtlos einen grösseren von ihnen zum Wechseln.
Als sie die Treppe zum Promenadendeck hinaufschreiten, fühlt er eine leichte Hand auf seiner Schulter:
„Ob es sehr vorsichtig war, eine Brieftasche mit Bündeln von Geldscheinen vor den Augen so vieler Gäste und Stewards offen auf den Tisch zu legen, das müssen Sie selber wissen“, sagt der Freiherr. „Ich für mein Teil möchte es bezweifeln.“
„Ich kenne die Stewards von meinen vielen Reisen her“, erwidert Ulrich ablehnend, „und weiss, dass sie ehrliche Leute sind. Und von denen, die im Speisesaal mit uns sassen, nehme ich auch nicht an, dass sie stehlen.“
„Alle stehlen heutzutage .. jeder auf seine Weise .. der eine viel, der andere wenig. Das ist der einzige Unterschied.“
„Das ist eine Einschätzung der Menschen, um die ich Sie nicht beneiden möchte.“
„Die aber einer reichen Erfahrung entspringt. Und gerade heute .. nach diesem Diebstahl, wo man gar nicht weiss, wer alles an Bord ist.“
Er fügt es leiser hinzu. Denn Frau Rosi, die stehen geblieben, wartet auf sie.
„Ich habe Sie gewarnt. Ob Sie meine Worte nützen wollen oder nicht, das überlasse ich gern Ihnen.“
Sie sind auf dem Oberdeck angelangt. Das dämmernde Helldunkel einer frühen Juninacht empfängt sie. Einige elektrische Flammen werfen spärliches Licht, das sich gegen die noch vorherrschende Tageshelle nicht behaupten kann. Unwirsch pfeift der Wind. Aus dem Meere steigt ein salziger Odem, streift die Gesichter, legt sich auf die Zunge, mischt sich eigentümlich mit dem Ölgeruch und dem Dunst der Speisen, der von der unten gelegenen Küche aufwärtsdringt.
Ulrich lehnt sich über die Reeling. Der Nebel hat abgenommen. Die Küsten treten in dämmernden Umrissen hervor, schwinden. Ein gelblich grauer Dunst liegt auf dem Wasser, scheint zuerst wie ein feingewebtes durchsichtiges Seidentuch, für das die an den Bug schlagenden Wellen die silbernen Spitzen abgeben, dann wie ein Netz, das seine Maschen allmählich dichter spinnt. Wenn der Nebel sich löst, raucht und qualmt das Wasser.
Der Mond ist in seinem ersten Viertel, steht hinter einer dünnen Wolkenwand, durch deren leichte Schleier er neugierig hervorblinzelt. So hat er ihn gern. Schön ist der Vollmond, insbesondere über dem Meere. Aber er ist etwas Fertiges, Abgeschlossenes. Er lässt nichts zu wünschen und zu erhoffen übrig. Er ist poetisch ein bisschen abgenutzt, trivial möchte man sagen. Aber die dünne Mondsichel, die durch lichte Wolken wie eine silberne Barke segelt, schwindet, wieder da ist, die ist das Verheissende, ist der Fingerzeig des Himmels, der in ein fernes Land weist. Die lässt Wünsche aufkeimen, Sehnsüchte entbrennen ..
Er ist allein. Die beiden anderen sind bereits auf die Brücke zum Kapitän gegangen. Er hört das zwitschernde Lachen der jungen Frau, die wieder in ihrem Element ist. Auch die ruhig satte Stimme des Freiherrn klingt in einigen Zwischenräumen hinüber.
Das Dunkel hat zugenommen. Siegessicher schon schimmern die elektrischen Lampen. Man hat keine Fernsicht mehr. Nur vereinzelt flattern noch dünne, sich lösende Schleier über die dunkle Fläche, die stetig wogt. Wundervoll hebt sich von ihr der perlende Gischt, der gegen den mächtigen Schiffsleib andringt. Weit breitet sich der Himmel. Einige Sterne leuchten durch milchigblasse Dunstgebilde, neue tauchen auf, funkeln hell in der frischkühlen Juninacht.
„So allein? Und ganz in Meer und Himmel versunken?“
Der Kapitän steht vor ihm.
„Sie werden mich nicht vermisst haben.“
„Doch. Die schöne Frau hat schon mehrere Male nach Ihnen gefragt. Also reissen Sie sich los und kommen Sie zu uns! Die Nebelgefahr ist vorüber. Da können wir noch eine Stunde gemütlich bei mir zusammensitzen.“
Über die Brücke und durch das Kartenhaus treten sie in den Empfangsraum des Kapitäns.
Es ist urbehaglich hier oben: Ein viereckiges Gemach mit einladenden Polstersesseln, über dem Sofa ein künstlerisch ausgeführtes Pastell der Oberpfarrkirche St. Marien von einem bekannten Danziger Maler, Anrichte und Schreibtisch. Anschliessend der Schlafraum mit grossem, durch hellblaue Vorhänge abgeschlossenen Bett.
„Fabelhaft!“ ruft Frau Rosi aus. „Kein Mensch hat es so gut wie ein Kapitän. Der sitzt bei sich wie zu Hause, fährt dabei, ohne dass er es merkt, durch die weite Welt, hat die schönste Aussicht auf Himmel und Meer und immer hübsche Frauen um sich.“
Lautlos erscheint Friedrich Gutzke, macht sich auf einen leisen Wink seines Herrn an der Anrichte zu schaffen, stellt Gläser auf den Tisch und kristallene Schalen, bringt Wein und Zuckergebäck in zarten Verpackungen. Blumen stehen überall, blühen, duften.
Die leichte Befangenheit, die im Speisesaal noch zwischen Menschen geherrscht, die sich fremd begegneten, ist gewichen. Ungezwungener wird der Ton.
Der Kapitän hat eine wundervolle Gabe, den Wirt zu machen, und einen gewandteren und aufmerksameren Diener als Friedrich Gutzke kann sich auch ein hochherrschaftlicher Haushalt nicht leisten. Alles sieht er und alles bringt er herbei, sodass kein Wunsch unerfüllt bleibt.
Ab und zu begibt sich der Kapitän noch auf die Brücke. Aber er hat erprobte Offiziere, auf die er sich verlassen kann, die ihre Pflicht mit unbeirrbarer Selbstverleugnung tun, selbst wenn sie seekrank werden. Wie der junge Mensch, den er erst vor kurzem übernommen hat, der den Schiffsdienst von der Pike an durchgemacht, Meere überquert hat und dennnoch auf der Ostsee, die tückischer ist als alle anderen Gewässer, dieser Krankheit rettungslos verfällt.
„Ich glaube, ich bin seefest“, meint Frau Rosi. „Ich bin schon viel auf dem Wasser gefahren, aber es ist mir immer gut gegangen.“
„Dann haben Sie immer gute Fahrt gehabt“, erwidert der Kapitän.
„O nein. Wir hatten auch Sturm. Einmal sogar starken.“
„Nun .. wir werden heute die Probe machen.“
„Glauben Sie, dass wir schlechtes Wetter bekommen, Herr Kapitän?“
„Nicht gerade schlechtes — aber ob wir noch lange eine so glatte Fahrt haben werden —?“
„Seekrank bin ich noch nie geworden“, wirft der Freiherr ein. „Aber ich bin bei schwankendem Schiff ein anderer Mensch. Ich fühle mich matt und zerschlagen .. möchte immer schlafen und verspüre Neigung zum Nachtwandeln.“
„Gibt es denn kein Mittel gegen diese abscheuliche Krankheit?“ fragt Frau Rosi.