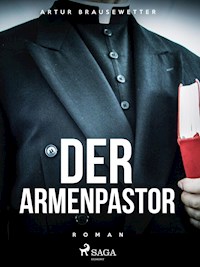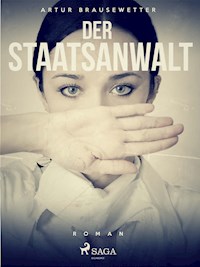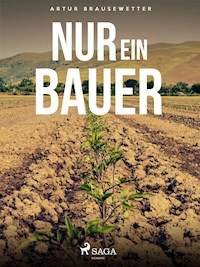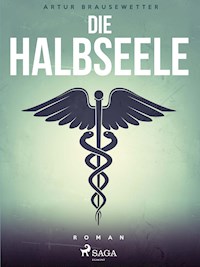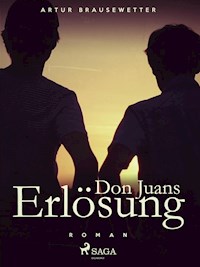
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist die bewegende Geschichte zweier Freunde, des Gutsbesitzers Werner von Berkow und des erfolgreichen Theaterdichters Rolf Uckermann, die sich als gestandene Männer in der Residenzstadt kennenlernen und vom ersten Moment verstehen. Und es ist die Geschichte der Frauen, die diese beiden Männer lieben und die an ihnen zerbrechen. Erst im letzten Moment erkennen die Freunde, dass ihr eigenes Lebenskonzept nicht dafür geeignet ist, die Frauen glücklich zu machen. Sigrid von Berkow wagt es am Ende und verlässt mit ihrem gemeinsamen Sohn für immer das Gut Alt-Stürckau. Bei Rolf Uckermann ist es sein unstetes Wesen, das lange Zeit in seiner Beziehung zu den Frauen die wirkliche Katastrophe zu verhindern weiß. Erst als Uckermann allen Beziehungen beraubt dasteht, löst sich bei ihm die künstlerische Hemmschwelle, die sich aufgebaut hatte: Jetzt kann er sich an die große Tragödie aller Liebenden heranwagen, den Don Juan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Brausewetter
Don Juans Erlösung
Roman
Saga
Ebook-Kolophon
Artur Brausewetter: Don Juans Erlösung. © 1915 Artur Brausewetter. Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711487754
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
Professor Münchhausen nahm den Zettel, den die hagere Schwester mit den strohblonden Haaren ihm reichte: „Werner von Berkow; Stand: Rittergutsbesitzer; Wohnort: Alt-Stürckau; Alter: 35 Jahre.“
„Schicken Sie den Herrn zu Doktor Wurmb, zur Voruntersuchung!“
„Herr von Berkow wünscht den Herrn Professor persönlich. Er wird warten.“
Die Schwester begab sich in das Empfangszimmer zurück. Es war streng quadratisch, die hellgraue Tapete kalt und kahl wie der ganze Raum, an den Wänden einige Bilder, die nichts sagten, auf dem einzigen Tisch in der Mitte ein Stapel abgegriffener Zeitschriften. Ein alter Herr, schlecht rasiert und mit vergrämtem Gesicht, blätterte nervös in einem Heft; eine blühende Frau liess keinen Blick von einem eingefallenen Manne, der, ungeduldig und unwirsch, weil man ihn noch immer warten liess, bald auf den Arzt, bald auf seine Frau schimpfte. Die andern sahen stumpf vor sich hin.
Eine Dame, mit Augen, die viel geweint hatten, trat mit einem Knaben von frühwelkem Gesichtsausdruck aus dem Sprechzimmer. Die Schwester winkte dem alten Herrn. Ihr Schritt, ihr Öffnen und Schliessen der schweren Doppeltür geschah ohne Geräusch, wie ein Schatten ging sie durch das Zimmer. Endlich sagte sie mit ihrer dünnen Stimme: „Herr von Berkow!“ Der erhob sich, trat in das ernste, lichterfüllte Zimmer des Arztes.
Er war mittelgross, jugendlich und sehnig. Seine Nase war stark und kühn, sein Auge von verschlossener Traurigkeit. Das gebräunte Gesicht wies auf den Landmann.
Die Gedanken des Professors weilten noch bei einer eben entlassenen Patientin. Jetzt nahm er den Anmeldezettel, der auf dem Schreibtisch lag. „Herr von Berkow? Landwirt — und krank?“
„Landwirt und krank.“
„Wo fehlt’s?“
„Das zu erfahren, suche ich Sie auf.“
„Aber irgendeinen Anhalt müssen Sie mir doch geben.“
„Ich komme zu Ihnen, weil ich meine, eine seelische Depression, wie sie mich heimsucht, müsse ihren Grund in einer Störung des Nervensystems oder des Organismus haben. Ein andrer ist nicht denkbar. Meine Vorfahren waren gesund, meine Verhältnisse sind die besten, ich habe keine materiellen Sorgen.“
„Hm! ... Lassen Sie einmal sehen ... So, ich danke ... Nun bitte: tief atmen ... Ich sehe, Sie haben bereits Übung ... haben sich gewiss schon oft untersuchen lassen.“
„Ich kann es nicht leugnen.“
„Hat einer meiner Kollegen etwas Nennenswertes gefunden?“
„Nein.“
„Und nun einen Augenblick den Atem anhalten!“
Eifrig beklopfte der Professor die Brust- und Rückenwände des entblössten, schöngebauten Körpers, setzte sein Hörrohr an, lauschte mit angespannter Aufmerksamkeit.
„Nichts. Alles in bester Ordnung. Ich kann so wenig finden wie meine Kollegen.“
„Es tut mir leid.“
„Das tut Ihnen leid? Danken sollten Sie Ihrem Herrgott, dass Sie gesund sind.“
Da sah ihn Werner von Berkow mit den grossen, ernsten Augen an: „Ich verstehe Sie sehr wohl, Herr Professor, verstehe auch Ihren Vorwurf. Und doch — wenn Sie mir heute gesagt hätten: Ihr Herz ist nicht in Ordnung, oder: Ihr Nervensystem ist ernstlich gestört — ich hätte einen Anhalt für mein Befinden gehabt, hätte versuchen können, meiner Erkrankung durch passende Bäder oder Brunnen auf den Leib zu rücken, hätte wieder hoffen und aufatmen können. Und wenn nicht — nun, ich hätte auch das getragen, vielleicht gar nicht schwer.“
Ein Blick erwachender Anteilnahme glitt durch die dicken Brillengläser, die Münchhausens kluge Augen deckten. Was der blühend kräftige Mann da sagte, klang echt und männlich.
„Aber sehen Sie“, fuhr jener fort, „so ein Leben, das eigentlich doch kein Leben ist, überdunkelt von einer unbegreiflichen Traurigkeit, gehemmt im besten Wirken durch ein Etwas, das keine Wirklichkeit und doch immer da ist —“ Er brach ab.
Der Professor wies ihm einen Stuhl und setzte sich zu ihm. „Erlauben Sie mir jetzt einige Fragen, die dem Nervenarzt oft mehr Aufschluss geben als seine Instrumente und Untersuchungen. Zuerst: Nimmt Sie Ihre Tätigkeit sehr in Anspruch? Ist Ihre Wirtschaft in guter Verfassung?“
Ein Lächeln spielte um Werners Lippen. „Wenn Sie Zeit hätten, mich einmal auf meinem Gute zu besuchen, würden Sie mir vielleicht ein Recht zugestehen, auf diese Frage mit einem Ja zu antworten. Ich betätige mich auf manchem Gebiete, habe ausser rationeller Bodenwirtschaft Brennerei und eine Pferdezucht, die meine Nachbarn für vorbildlich halten, trage mich auch mit einem neuen Projekt der Koppelberieselung.“
„Sie sind unverheiratet?“
„Ja.“
„Haben Sie einmal ein schweres Schicksal durchmachen müssen?“
„Nichts, als was jedem Menschen zuerteilt ist ... nichts Besonderes.“
„Vielleicht eine unglückliche Neigung?“
Werner lächelte. „Ich nahm es einmal sehr ernst mit der Liebe zu einer Cousine, ich war damals noch jung.“
Der Professor merkte, dass er sich nicht weiter mitteilen wollte. „Ich kann Ihnen nur ein Rezept verschreiben, von dem ich mir etwas verspreche: Sie müssen heiraten. Die Einsamkeit erscheint mir der Hauptgrund Ihrer Leiden.“
„Sie ist schwer zu ertragen, ich muss es zugeben. Aber was Ihr Rezept betrifft: ich fürchte, ich werde keinen Gebrauch von ihm machen.“
„Weshalb nicht?“
„Weil ich Idealist bin. Ich würde die Frau nicht finden, die meinen Wünschen, meiner Sehnsucht entspräche.“
„Man kann gegen die Ehe alles mögliche ins Feld führen, lieber Herr von Berkow, von der Idee aus, wie Sie sagen. Aber sie hat einen Wirklichkeitswert: sie ist gesund.“
„Ich habe keine Neigung für solch ein Experiment.“
„Ein um so besserer Ehemann würden Sie werden. Und dann: Lebt Ihre Mutter noch?“
„Ja.“
„Wie stehen Sie zu ihr?“
„Gleichgültig.“
„Wem geben Sie die Schuld?“
„Ich habe mir längst abgewöhnt, in solchen Fällen nach Schuld und Nichtschuld zu fragen.“
„Aber woher dann diese unnatürliche Gleichgültigkeit?“
„Ich war schon als Kind anders als meine Geschwister: in mich gekehrt, still. Mein Vater starb früh.“
„Woran starb Ihr Vater?“
„An einer typhösen Erkrankung.“
„Bitte, weiter.“
„Die Verwandten meiner Mutter, die auf unsere Erziehung wesentlichen Einfluss übten, liebten mich nicht. Meine Mutter wandte sich immer mehr von mir ab.“
„Und Sie?“
„Damals litt ich sehr darunter. Jetzt habe ich es überwunden.“
„Machten Sie nie den Versuch, ihr näherzukommen?“
„Doch. Als ich nach dem hinterlassenen Willen meines Vaters das Familiengut übernahm.“
„So haben Sie nie einen Menschen gefunden, dem Sie Zuneigung entgegenbrachten?“
„Nie.“
Der Professor erhob sich. „Ich danke Ihnen. Ich kenne jetzt einigermassen den Herd Ihrer Leiden.“
„Aber eine Heilung —?“
Er zuckte die Achseln. „Sie sind ein einsichtiger Mann, lieber Herr von Berkow. Was soll ich Ihnen geheimnisvolle Sprüchlein hersagen oder Sie in Bäder schicken? Und wenn Sie auf den Mond gingen, es wäre Ihnen nichts nütze. Ich kann Ihnen nur meinen Rat wiederholen: heiraten Sie. Warum sollte ein Mann wie Sie die Frau nicht finden, die seiner Eigenarr entspräche? Und bis dies geschehen, Arbeit und Zerstreuung! Das erste haben Sie, aber vielleicht fehlt es am zweiten.“
„Ich gehe viel auf Reisen. Bin ich zu Hause, so klebe ich an der Scholle.“
„Besuchen Sie kein Theater oder Konzert?“
„Hier nie.“
„Sie sollten es tun. Unser Hoftheater ist jetzt gut, ich sah gestern eine Aufführung des ‚Oberon‘.“
„Ich habe für die Oper wenig Sinn. In meiner Jugend interessierte mich das ernstere Schauspiel.“
„So pflegen Sie das! Ich hörte einige meiner Patienten ein neues Stück rühmen, dessen Verfasser ein noch wenig bekannter Mann ist. Uckermann nennt er sich, ein Deckname, wie man mir sagte —“
Die Schwester brachte einen neuen Meldezettel. Er brach ab und entliess Werner, der ihn stark als Mensch, als Patient gar nicht interessierte.
*
„Kommt denn der Stürckauer nicht?“ fragte der lange Stechern seinen Nachbarn, Dietz von Hayne, als sie sich am Stammtisch der alten Weinstube von Brest am Langen Markt zum Frühschoppen niederliessen. „Ich sah seinen neuen Wagen doch auf der Strasse.“
„Ich habe ihn selber gesehen. Er verschwand im Hause des Nervenonkels, bei dem er jetzt wohl seine letzte Zuflucht nimmt.“
„Weshalb seine letzte?“
„Weil er die Reihe der andern Ärzte durch ist.“
„Na, der kann ihn doch auch nicht gesünder machen, als er ist. — Guten Tag, Berkow, ich sag’s ja immer, man braucht einen nur redlich durch die Zähne zu ziehen, gleich ist er da. Wären natürlich lieber allein, hilft nicht, Sie müssen an unsern Tisch, wir haben Sie selten genug. Oder hat Ihnen der Professor schlechte Gesellschaft verboten? Odi profanum vulgus et arceo — ich hasse die profanen Junker und halte sie mir vom Leibe.“
Der Stammtisch füllte sich. Einige Herren von der Regierung kamen, ältere und jüngere Offiziere, mehrere Künstler und ein Teil des Landadels, der sich heute zu einer wirtschaftlichen Besprechung in der Residenz versammelt hatte. Aus seiner Mitte bekam Berkow noch manches neckende Wort zu hören. Aber selbst in der scherzenden Art, mit der sie ihm begegneten, lag eine gewisse Vorsicht; niemand ging über die Grenze, die ihm gegenüber geboten erschien.
„Warum haben Sie Ihren Vetter nicht mitgebracht, den Kosswitz?“ fragte Oberst Bensing den dicken Rittmeister Fang, den besten Kunden der Brestschen Weinstube, „er hat immer die Tasche voll kleiner pikanter Theatergeschichten, ich höre sie für mein Leben gern.“
„Wer an der Schmiede sitzt, hat leicht zu erzählen“, sagte Dietz von Hayne.
„Er kommt nicht gern ohne seinen hohen Chef“, bemerkte Fang, nachdem er mit Hilfe von Fritz, seinem Leibkellner, die richtige Wahl des Weines getroffen, „und dem haben sie den Appetit zum Frühstück verdorben.“
„Was hat er wieder schlucken müssen?“
„Bittere Hofpillen, Herr Oberst. Für ihn war der Rücktritt des Herzogs kein Glück — nee, wahrhaftig nicht. Er hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, den neuen Herrschaften was Besonderes zu bieten; ‚Oberon‘ in einer Ausstattung, wie sie Berlin und Wiesbaden nicht leisten, Ballette, die dem Grossmogul Bewunderung abnötigen würden. Eine neue Auffahrt ist gebaut, weil die hohen Herrschaften keiner Berührung mit dem Publikum ausgesetzt sein wollen, ihr Foyer ist mit Geschmack — haben Sie es sich schon angesehen, Herr Oberst? Ich sage Ihnen mit auserlesenem Geschmack — hergestellt, und aller Mühe Lohn? Die Herrschaften haben sich eine Aufführung von ‚Oberon‘ angesehen, und die nicht einmal bis zu Ende!“
„Das liegt aber nicht am Prinzen, meine Herren“, warf ein pensionierter Geheimer Hofrat ein, der immer noch über alles, was bei Hofe vorging, gut unterrichtet scheinen wollte. „Seine Hoheit haben den Intendanten in die Loge rufen lassen und ihm viel Angenehmes gesagt, ja befohlen, die Oper an einem bestimmten Tage noch einmal anzusetzen. Aber die Prinzessin, für deren verwöhnten Geschmack alles geschehen, hat keine Silbe gesagt. Und als die befohlene Wiederholung stattfand, erschien der Prinz allein.“
„Das wird dem armen Brunkow das Herz gebrochen haben. Er hat keinen Schimmer von der Kunst, aber er ist ein leidlicher Dekorateur und ein guter Kerl, er tut mir leid.“
„Und mit seinem neuen Ballett, das Tausende gekostet, hat er noch weniger Glück gehabt. Die hohen Herrschaften erschienen, er empfing sie und verhiess siegessicher Grosses. Nach dem ersten Akt befahl die Prinzessin ihren Wagen.“
Das Gespräch war laut und lärmend geworden. Eine Schnitzeljagd bildete den Inhalt, die Namen von Pferden, Hunden und Reitern schwirrten über die Tafel. Die Kellner liefen mit erhitzten Köpfen hin und her, die geleerten Flaschen gegen neue auszutauschen.
„Sagen Sie mal — finden Sie das nun sehr nett?“
Herr Hendewerk, der Abteilungsdirektor für Kunst und Wissenschaft im Unterrichtsministerium, bog seinen kahlen Kopf, auf dem eine kleine Insel silbergrauer Haare schimmerte, zu dem Berkows, der nach Art schwermütiger Weltverneiner ein Feinschmecker und gerade damit beschäftigt war, eine feiste Hummerschere mit kunstgeübter Hand aus ihrer Schale zu lösen.
„Was denn?“
„Nun, das von der Erbprinzessin.“
Berkow schien seiner Hummerschere mehr Aufmerksamkeit entgegenzubringen als der Erbprinzessin. Aber das hielt den kleinen Ministerialdirektor nicht ab, seinen Faden weiterzuspinnen, immer in der leisen, wichtigen Sprechweise, die er von seinem Arbeitszimmer mit an den Stammtisch brachte. „Einige Rücksicht sollte man doch nehmen. Unser Hoftheater leistet das Mögliche, unsre Symphoniekonzerte sind in der Welt berühmt. Brecher tritt in den nächsten Monaten seine Kunstreise durch die grössten Städte Deutschlands an. Und mit dem machen sie es nicht anders; er gibt gestern einen Beethovenabend, die hohen Herrschaften lassen sich zu acht Uhr ansagen, der Beginn war bereits um halb acht Uhr festgesetzt. Brecher bittet das Publikum, sich bis acht Uhr gedulden zu wollen —“
„Warum tat er das?“
„Er glaubte, als Hofkapellmeister solche Rücksicht üben zu müssen. Wer aber um acht Uhr nicht erscheint, sind die hohen Herrschaften.“
Berkow bearbeitete augenblicklich die weniger ergiebigen Teile seines Hummers; der kleine Ministerialdirektor konnte ungestört weitersprechen. „Und die Geschichte von der Toskati kennen Sie doch auch? Nicht? Dann wissen Sie wenigstens, dass sie eine unsrer grössten Sängerinnen ist. Brecher hat sie mit viel Aufwand von Mühe und Geld zu einem Konzert bei uns gewonnen. Als die Toskati ihre erste grosse Arie beendet, erscheint ein Kammerherr und überbringt ihr den Wunsch des Erbprinzen, am nächsten Tage im Schlosse zu singen. Die Toskati gerät in die grösste Verlegenheit, jeder Tag ihrer Reise ist besetzt, aber sie will nicht absagen und bewegt ihren Impresario zu einer Verschiebung, die mit Hilfe eines unbesetzten Sonntags im letzten Augenblick gelingt. Als sie aufs Schloss kommt, wird sie vom Prinzen empfangen, er hört voller Aufmerksamkeit ihren Liedern zu, überreicht ihr eigenhändig ein Platinarmband. Die Prinzessin aber lässt sich den ganzen Abend über nicht sehen. Und als der Prinz sie schliesslich ruft, gibt sie zur Antwort, sie höre das alles ebensogut von ihrem Zimmer aus. Na, was sagen Sie?“
Berkow schob den Teller fort, tauchte die Fingerspitzen in eine Wasserschale und trocknete sie sorgfältig ab. „Dass, wenn ich Brecher wäre, ich nicht bis acht Uhr gewartet hätte. Und wäre ich die Toskati, so hätte ich eine festgesetzte Reise einmal nicht abgesagt, um in einem prinzlichen Schloss zu singen, hätte zum zweiten aber meinen Wagen sofort vorfahren lassen, wenn man mich nicht so behandelte, wie es meiner Kunst zukommt.“
„Das hätten Sie tun können in Ihrer unabhängigen Stellung.“
„Nein, das sollte jeder Mensch von einigermassen anständiger Gesinnung tun. Warum werfen sich die Leute so weg? Es geschieht Ihnen schon recht. Ein Fürst zu sein und kein Menschenverächter, muss ein Kunststück sein; ich würde sie alle verachten.“
„Das tun Sie ja schon sowieso“, rief der lange Stechern von der andern Seite des Tisches herüber.
„Wahrhaftig, sie zu lieben ist nicht leicht.“
Das Gespräch schwieg. Ein neuer Gast war in die Weinstube getreten: ein Mann vielleicht in der Mitte der Dreissiger. Unter der wohlgeformten Stirn beseelte, halb feurige, halb nachdenkliche Augen, die Nase leicht gebogen, der Mund herb.
Fritz war dienstbeflissen hinzugestürzt, hatte dem Fremden den Mantel abgenommen und einen Tisch für ihn freigemacht. Die Stammtischrunde, die durch den kleinen Zwischenfall für einen Augenblick aus dem gewohnten Gleise gekommen war, nahm die unterbrochene Unterhaltung um so lebhafter auf. Der lange Stechern gab bei der vorgeschrittenen Stimmung einen seiner schlimmen Witze zum besten. Eine dröhnende Lachsalve antwortete ihm. Durch den lauten Beifall aufgemuntert, rüstete er sich zu einem zweiten. Der Fremde zuckte bei dem Lärm zusammen, sah sich einen Augenblick wie hilflos um, stand auf, nahm seinen Mantel und verliess die Weinstube, diesmal ohne zu grüssen, wie er es beim Eintritt getan hatte.
„Zum Teufel, wer war der wunderliche Kerl?“ fragte Stechern, ärgerlich, um seinen zweiten Witz gekommen zu sein, für den jetzt nicht die rechte Stimmung war. „Tat ja, als wär’ er in des Teufels Küche geraten!“
„Faust in Auerbachs Keller: ‚Mir widersteht das tolle Zauberwesen — Versprichst du mir, ich soll genesen — In diesem Wust von Raserei?‘“ zitierte ein Geheimrat von dem Schlage derer, die jedermann erzählen, dass der Faust ständig auf ihrem Nachttisch liegt.
„Heda, Fritz, wer war der Herr, der uns eben die kurze Aufwartung machte?“
„Kennen die Herren den nicht? Herr Doktor Uckermann, der Dichter von dem neuen Stück, das sie jeden Abend da drüben spielen.“
„Potztausend, der?“ rief Oberst Bensing. „Ich sah sein Stück. Wieder solche Offiziersgeschichte, die ich nicht ausstehen kann, besonders wenn sie tragisch verläuft. Dazu noch stark philosophisch angehaucht; solchen Leutnant wie den — na, wie heisst er gerade? richtig, Bernstoffer —, gibt’s ja gar nicht.“
„Warum soll es den nicht geben, Herr Oberst?“ warf ein Rittmeister ein.
„Haben Sie schon so einen kennengelernt? — Na also.“
„Aber alles, was das Stück aus dem Offiziersleben bringt, ist vorzüglich beobachtet, ohne jede Übertreibung oder Karikatur. Wirklich ganz so, wie es ist, auch das Ernste und Tragische.“
„Ist kein Wunder. Der Mann soll eine Reihe von Jahren Offizier gewesen sein“, sagte Dietz, „bei einem Kavallerieregiment da irgendwo im Osten.“
„Sie irren, meine Herren“, warf der Hofrat dazwischen, „er ist von der Zunft, er war Zeitungsschreiber in irgendeiner kleinen Stadt. Bis er seinen Genius entdeckte und Dichter wurde.“
„Das eine schliesst das andere nicht aus. Ein Kamerad, mit dem ich gut befreundet war, ist heute einer der bekanntesten und bissigsten Theaterkritiker in Berlin.“
„Kavallerieoffizier — Zeitungsreporter — Stückeschreiber, die Frage ist nur, ob man solchen Sprung freiwillig macht, nur aus Liebe zur Kunst“, meinte der kleine Ministerialdirektor.
„Nee, aber aus einer andern Liebe!“ rief Fang, der nach eifriger Unterredung mit Fritz zu einer neuen Sorte übergegangen war. „Eine Frau steckt dahinter, wie immer in solchen Sachen. Eine Dame aus unsrer nächsten Nachbarschaft auf dem Lande, Herr Oberst kennen sie auch.“
„So lassen Sie doch den elenden Klatsch, meine Herren“, sagte Berkow, in dem das Gespräch mit dem Arzt auflebte, sowie der Name Uckermann gefallen war. „Was spielt man heute abend? Fritz, reichen Sie mir doch mal den Theaterzettel!“
Und er las: „Jenseit der Heerstrasse. Ein tragisches Spiel in vier Vorgängen von Rolf Uckermann.“
„Jenseit der Heerstrasse!“ höhnte der lange Stechern mit seiner glucksenden Stimme. „Na, Berkow, das wäre doch was für Sie! Da können Sie gleich mitspielen. Würden Ihre Rolle schon machen.“
*
In dem sein abgestimmten Raume eines kleinen Interimtheaters, das, dicht neben dem grossen Hoftheater gelegen, der Darstellung moderner Stücke diente, sah Werner das neue Stück von Rolf Uckermann. Es war schon oft aufgeführt und schien seinen Reiz verloren zu haben; zudem gab man auf der grossen Hofbühne nebenan eine Wagneroper, die alles angezogen hatte. Hier war es so leer, wie Werner es eigentlich noch nie in einem Theater gesehen hatte.
Aber weder dies noch das matte Spiel der Darsteller, die der gähnenden Öde nicht Herr werden konnten, hemmte den tiefen Eindruck, den er von dieser Tragödie empfing. Es schien ihm gar kein Theaterstück, sondern ein Etwas, das, unmittelbar aus dem Leben herausgeschnitten, zugleich über das Leben wies. Wie der Schrei einer Sehnsucht erschien es ihm nach dem, was einmal war und dann verloren ging in der Habsucht und Enge der Tage, nach dem Ursprünglichen, das irrende Menschen mit der Inbrunst ihrer Seele suchten und nicht mehr fanden.
So löste dies wunderbare Spiel in seinem Herzen manches aus, was dumpf in ihm gärte und nach Ausdruck verlangte. Als er auf seinem Wagen sass und durch die klare Sternnacht seinem Gute zufuhr, da wusste er, dass ihn dieser Abend klarer und reicher gemacht hatte.
*
Ermüdet kam Rolf Uckermann von der Leseprobe seines neuen Stückes am späten Nachmittag nach Hause. Nur einer erwartete ihn dort: sein Teckel. Der stürzte ihm durch die kaum geöffnete Tür entgegen, sprang in wilden Freudentänzen bald um ihn herum, bald an ihm empor, legte sich dann auf den Rücken, wälzte und streckte sich mit den wunderlichsten Mätzchen und Mienen auf dem Boden und ruhte nicht, bis sein Herr gleichfalls auf der Erde hockte, mit einem geübten Griffe seiner Rechten die kalte Hundeschnauze fest umspannte und mit der andern Hand das braune glatte Fell seines Lieblings kraute und liebkoste. „Alter“ hatte er ihn getauft. Nicht etwa weil Männe ein alter Hund, sondern weil er sein alter ego — sein andres Ich — war.
Nun stand er auf, legte den Ulster ab und trat in sein Arbeitszimmer.
Dem grossen Mittelfenster zu stand der gewaltige, mit Büchern und Schriftstücken übersäte Schreibtisch, über ihm, das ganze Zimmer beherrschend, ein Gipsabdruck von Goethes Weimarer Büste, rechts in der Ecke auf schwarzer Säule eine Bronze von Shakespeare. Die Wände entlang liefen Bücherregale von schwerer, dunkelgebeizter Eiche, alle gefüllt mit Werken aus der Philosophie, Geschichte und Literaturwissenschaft; und wo diese Regale an den Wänden Platz liessen, hingen Bilder: ein fein ausgeführter Kopf Friedrich Nietzsches, neben ihm Beethoven. Anfangs verblüffte die Zusammenstellung, dann sah man auf den Gesichtern beider den ganz ähnlichen Ausdruck: das Ahnungsdunkle des zum Leid geborenen Genies, die Schatten der anbrechenden Nacht. Nicht weit von ihnen das gebietende Haupt Henrik Ibsens, darüber Guido Renis Christus mit der Dornenkrone — eine seltsame Anordnung in dem scheinbar chaotischen Nebeneinander. Aber immer ein innerer Zusammenhang erkennbar oder wenigstens zu ahnen.
Rolf hatte die eingegangene Post durchgesehen, es war nur ein Brief, den er erwartete. Der fehlte, die andern lohnten das Öffnen nicht.
Es war inzwischen Zeit geworden, sich umzukleiden, denn er war zum Abend eingeladen. Sein Kopf war dumpf, sein Verlangen nach frischer Luft unbezwinglich. Deshalb machte er den weiten Weg zu Fuss.
Endlich war er vor dem vornehmen Hause im neuen, stillen Villenviertel angelangt, dessen Erdgeschoss Wanda Ellenburger bewohnte, die erste Tragödin des Residenztheaters, die einzige, die der Hof in seine Kreise zog und die das Publikum vergötterte.
Sowie sie eintrat, merkte er, dass sie verstimmt war.
„Man sieht, dass Sie verwöhnt werden. Ich erwarte Sie seit einer Stunde.“
„Ich bitte um Entschuldigung, ich kam zu Fuss. Die lange Probe hat mich mitgenommen, ich musste einige Bewegung haben.“
„Um auf dem weiten Gange sich ungestört in Ihre Arbeit zu vergrübeln.“
„Auch das.“
„Ich wusste es. Und das gerade ist es, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte, ich habe genug darüber nachgedacht. Sie ahnen gar nicht, wieviel ich mich mit Ihnen beschäftige. Sie haben eine Bühnengabe, wie ich sie selten gesehen, es war mir klar von der ersten Stunde an, in der ich einen Einblick in Ihr Schaffen erhielt. Aber wenn Sie erreichen wollen, wozu Sie das Zeug haben: einer der ersten Dramatiker Deutschlands zu werden — lassen Sie, ich übertreibe nicht, ich weiss, was ich sage —, dann müssen Sie mit Ihrer unseligen Veranlagung brechen.“
„Es wird mir schwer werden.“
„Hilft nichts, Sie müssen eben. Sie sind zu sehr Grübler, das ist Ballast für den, der Theaterstücke schreiben will. Christiani, unser Spielleiter, sagte es mir heute erst nach der Probe, und der Intendant selber —“
„Ich bitte Sie, was versteht der vom Schaffen eines Dichters?“
„Er ist ein gewiegter Theatermann, und er hat vollkommen recht wie auch Christiani. Es ist zuviel Ballast der Gedanken in Ihrem neuen Drama; gerade auch in meiner Rolle. Ich kann das unmöglich alles bringen, was Sie da schreiben.“
„Aber wenn ich darauf bestände?“
Sie massen sich mit einem schnellen Blick. Die Ellenburger war den Widerspruch nicht gewohnt.
„Ich werde keinesfalls auf alle die Striche eingehen, die Christiani haben will. Eher —“
„Ziehe ich mein Stück zurück — sieh, sieh, der poeta, laureatus. Aber wenn man es gut mit ihm meint und ihn gern so recht berühmt haben möchte, wie er es verdient — in dieser Beziehung sind wir Frauen nun einmal eitel —, nicht wahr, dann lässt er mit sich reden?“
Sie lenkte ein, er fühlte es. Ihr dunkles, tiefes Auge ruhte mit weichem Glanz auf seinem Antlitz.
Das Mädchen meldete, dass angerichtet wäre.
Sie waren nur zu zweien, aber es war alles auf das festlichste bereitet. Auf dem Tisch Kerzenlicht in antiken Kandelabern, duftende, dunkelrote Rosen, Altmeissner Geschirr, die Gläser gleichfalls alt und von wundervollem Schliff. Statt des Tees, zu dem sie ihn gebeten, ein auserlesenes Essen: Kaviar, Forellen, Geflügel, köstliche Weine.
„Es ist eine Geburtstagsfeier. Heute vor einem Jahre sahen wir uns zum erstenmal.“
Die Ellenburger war eine gewandte Wirtin, sie verstand mit Grazie zu plaudern. Dann und wann sprach sie auch von seinem neuen Stück, aber sie betrachtete es jetzt lediglich vom Gesichtspunkt der Darstellerin. Er war nicht bei der Sache. Ihre Worte, die sie ihm beim Empfang gesagt, gingen ihm durch den Kopf. Es lag etwas Wahres in ihnen, er konnte nicht von ihnen los. Sowie sie die Tafel aufgehoben und ihn in ihr kleines Gemach gebeten, zu dem nur die Auserwählten Zutritt hatten, kam er auf sie zurück.
„Sie haben alles, was der Schöpfer braucht“, entgegnete sie, „Gestaltungskraft, Geist, Plastik — aber eins fehlt, dabei bleibe ich: das Theaterblut. Sie stammen nicht von der Zunft wie ich. Wir sind Komödianten seit Jahrhunderten, meine Grossmutter fuhr noch im Wanderkarren, meine Mutter spielte dieselben Rollen wie ich. In Ihrer ganzen Familie war nie ein Dichter, ein Schauspieler oder dergleichen — nicht wahr?“
„Einige meiner älteren Vorfahren waren Geistliche, die späteren Soldaten, Landleute, auch Beamte.“
Das Mädchen brachte den Sekt und die Gläser. „Stelle noch eine Flasche in den Kühler! Dann kannst du schlafen gehen, auch Irma. Ich kleide mich heute allein aus.“
Auf dem Tische brannte eine Lampe; die elektrischen Birnen an der Decke waren nicht eingeschaltet, dämmernd nur war die Helle. Schweigen war zwischen ihnen. Er grübelte immer noch über ihre Worte.
„Wenn ich an unser erstes Zusammensein denke, da oben in Tilsit! Ich hatte die Jungfrau zu spielen. Überall auf meinen Gastspielen hatte ich sie gegeben; die Zeitungen sangen Hymnen über sie, ich las sie gar nicht mehr, die eine war wie die andre Ich hatte auch Ihre Besprechung nicht gelesen. Aber als ich zur zweiten Gastvorstellung auf die Bühne kam, da merkte ich gleich, dass etwas vorgefallen war: die verlegenen Gesichter der Kollegen, die Andeutungen des Spielleiters. Schliesslich konnte der gute Direktor nicht mehr an sich halten: ‚Sie dürfen sich halt nicht aufregen über das Geschreibsel von dem Uckermann, kein Mensch nimmt ihn ernst, er hätte bei seinen Rekruten bleiben sollen‘ — na, und dann gab er mir die Zeitung. Und während ich mich zur Judith ankleidete, las ich die wundervolle Kritik, in der der Herr Berichterstatter des Tilsiter Anzeigers den Nachweis führte, dass meine Auffassung der Jeanne d’Arc von Anfang bis zu Ende theatralisch und papieren war, dass mir diese meine Hauptpartie ganz und gar nicht lag.“
„Ich halte heute noch aufrecht, was ich damals schrieb.“
Sie runzelte die Stirn. „Lieber Freund, wir wollen diesen Abend darüber nicht streiten, Sie haben genug erreicht, ich spiele die Jungfrau nicht mehr, weder hier noch auf meinen Gastspielen.“
Ihre Demut entwaffnete ihn. „Aber dann kam der nächste Abend: ich sah Ihre Judith.“
„Und sagten mir kein Wort als wir uns nach der Vorstellung im Hause Ihres Chefs, Braunsdorf, trafen.“
„Ich konnte einfach nicht; gerade wenn mein Herz voll ist, wenn nur etwas ganz Neues geworden, ist mir die Sprache versagt. Aber ich schrieb alles, die ganze Nacht schrieb ich unten auf der kalten Geschäftsstube, während Sie oben in Sekt und Austern schwelgten.“
„Mir war es wenig recht, dass Sie gingen. Und als dann Ihre Besprechung der Judith erschien, als Sie mir mit wenig hingeworfenen Strichen Tiefen in dieser Frauenseele erschlossen, die ich bis dahin kaum geahnt — da taten Sie mir unendlich leid in Ihrer untergeordneten Stellung; ich wusste, dass Sie zu etwas anderm berufen waren.“
„Sie haben recht. Ein Frondienst war es schlimmster Art.“
„Warum erwählten Sie ihn? Verzeihen Sie mir — es ist nicht Neugierde, die mich fragen lässt —, ich habe nie verstanden, wie Sie Ihre gesicherte und verheissungsvolle Laufbahn aufgeben konnten, um Zeitungsschreiber in Tilsit zu werden.“
Ein Schatten flog über sein Gesicht.
„Ich weiss, Sie sprechen nicht gern darüber. Die Zeit wird kommen und ist vielleicht nicht mehr fern, in der Sie Ihren Tausch nicht mehr bereuen werden.“
„Dann hätte ich es Ihnen zu verdanken!“ sagte er mit plötzlich erwachter Wärme.
Ein Leuchten flog über ihre Stirn. „Wenigstens darf ich das Verdienst der Entdeckerin beanspruchen. Braunsdorf gab mir Ihr Stück; ich weiss wohl, es geschah ohne Ihren Willen. Ich las es auf der Reise nach Petersburg. Dass ich dann auf der Rückfahrt noch einmal in Tilsit haltmachte, dass wir uns zu Mittag bei Braunsdorf trafen und dass Sie mich zu Tische führten — glauben Sie wirklich, dass das alles Zufall gewesen? Sehen Sie, das wollte ich Ihnen nie verraten — aber ein Abend wie dieser öffnet auch verschwiegene Lippen.“
Sie hatte sich in den Sessel zurückgelehnt.
„Nein“, sagte er offen, ohne sie anzusehen, „das habe ich nie geahnt. Um so erstaunter war ich, als ich vierzehn Tage später von Ihrem Intendanten die Nachricht erhielt, dass mein Stück zur Aufführung angenommen war.“
„Ich war schnell am Werke, wie immer, wenn das Herz mich treibt. Denn dass ich alles der Sache halber tat — nein, so schlecht werden Sie die Frauen nicht kennen. Wir tun eigentlich nie etwas der Sache halber. Und täten wir es einmal, dann bliebe es eben — eine Sache.“
Jetzt war sie, wie er sie von der Bühne her kannte: von schelmischer Koketterie und jenem prickelnden Reiz, der ihren mondänen Frauengestalten das Unnachahmliche gab.
„Und ich war nicht weniger erstaunt“, fuhr sie nach einer kleinen Weile fort, „als Sie mir sofort nach dem Erfolge Ihrer ‚Heerstrasse‘ mitteilten, dass Sie Ihre Tilsiter Stellung aufgegeben hätten und jetzt hierher übersiedeln wollten — erstaunt und erfreut, wie Sie sich wohl denken können.“
Er vermochte ein Erschrecken nicht zu verbergen. Sollte sie wirklich glauben, dass er ihretwegen —? Er war aufgestanden, schnell und ein wenig unvermittelt. Aber die warme Luft, der Sekt, den er reichlich genossen, die Gespräche, die in ihm fortarbeiteten, alles das hatte eine gärende Unruhe in ihm erzeugt, der er am ehesten Herr zu werden pflegte, wenn er im Zimmer auf und ab ging. Da fiel sein Blick auf ein Bild, das über dem Ecksofa hing, auf dem sie sassen: eine weibliche Gestalt mit entblösstem Oberkörper, die quellenden Brüste von einem dunklen Schleier halb gedeckt, das Antlitz schön, aber sehr ernst, die grossen Augen gierig und zugleich traurig.
„Was stellt das Bild vor?“ fragte er.
„Etwas, das Sie nicht kennen — die Sünde.“
„Was ich nicht kenne?“ gab er lachend zurück. „Ich bin Ihnen für Ihre gute Meinung dankbar, aber ich kann sie aus bester Erfahrung nicht teilen.“
„Und ich sage noch einmal: was Sie nicht kennen. Es ist nicht die Sünde, das ist eine falsche Bezeichnung für dies Bild. Ich will ihm eine treffendere geben: der Dämon des Blutes —“ Sie atmete gepresst.
Er sah, dass ihre Augen einen stahlblauen Glanz hatten und einen Ausdruck, nicht unähnlich dem auf dem Bilde.
„Jenes Blutes“, fuhr sie schneller fort, „das unser Schicksal ist, das nicht Mitleid übt und Schonung, das nur sich selber will —“
„Wo haben Sie das Bild her?“
„Ich kaufte es auf einer Reise in Verona.“
„Und warum hängten Sie es gerade hierher?“
„Vielleicht als ein Memento ... ein Memento, dem man so lange folgt, bis eines Tages —“
Sie hatte sich erhoben und stand ihm gegenüber. Ihr Blick streifte den seinen, irrte von ihm ab, kehrte mit einem Male wieder, heiss und bittend.
„Bleiben Sie bei mir!“
Wie ein Feuerfunke fiel ihr Wort in seine Seele. Er gab ihr die Hand, die sie suchte, er liess sie in ihren glühenden, zitternden Fingern.
„Ich habe die Mädchen schlafen geschickt — wir sind allein.“
Ganz dicht stand sie neben ihm, er fühlte den erregenden Duft ihres Körpers, ein Taumel packte ihn, trieb ihn ihr entgegen. Dann aber — —
*
Weshalb war er gegangen? Die Frage begleitete jeden seiner Schritte durch die Nacht, die sternenklar, von leichtem Mondlicht durchzittert, ihre Fittiche über die herbstduftenden Gärten der Vorstadt spann. Warum hatte er die schöne Frau nicht in seine Arme geschlossen, die ihm freiwillig bot, wofür mancher sein Leben hingegeben hätte?! Sie galt durchaus nicht als freigiebig, er hatte nie von einem gehört, der sich ihrer Gunst erfreute. Und er?
Hatte sie recht? Fehlte es ihm an dem Blute, das nicht Mitleid kennt und Schonung, das sich nur selber will?
Sie irrte. Er hatte dies Blut wie kein andrer. Es blühte in ihm und sang seine wilden Lieder, hätte ihn willenlos heute in ein Meer von Flamme und Glut gestürzt — wenn nicht das Eine gewesen wäre! Aber das wusste sie nicht und kein Mensch ausser ihm.
Er war zu Hanse angelangt, es war spät geworden. Alter brauchte eine Weile, den Schlummer von seinen Gliedern zu schütteln, den er auf dem Fell vor dem Schreibtisch seines Herrn schwer und wohlig genossen.
Die Abendpost hatte wieder eine Reihe von Briefen gebracht. Er sichtete sie mit schnellem Blick und erregter Hand — endlich der eine, den er früher gar nicht erwarten konnte und auf den er gehofft von der frühen Morgenstunde bis in die tiefe Nacht! Rasch hatte er die Umhüllung zerrissen und las:
Schloss Edeltann.
Ja, was soll ich jetzt sagen, lieber Herr Uckermann? Was soll ich tun? Soll ich danken oder schelten? Soll ich jubeln oder weinen? Sie waren auf dem Wege zu uns. Sie! Endlich! Nachdem Sie drei lange, lange Jahre nicht das leiseste Lebenszeichen von sich gegeben, für mich verschollen blieben wie ein Toter? Warum taten Sie das? Und warum kamen Sie, als Sie sich endlich dazu entschlossen, ohne Anmeldung und mussten unverrichtetersache schon auf der Station umkehren? Kein Mensch fährt so weit aufs Land, ohne sich zu vergewissern, ob wir zu Hause sind. Und wie es das grausame Geschick immer will, mussten wir gerade an dem Tage zu dem langweiligsten aller Essen ausserhalb sein. Ich musste meine ganze Kraft zusammennehmen, meine Erregung zu meistern, als ich nach Hause kam und Ihre Nachricht fand. Mein Mann merkte doch meine Veränderung. Aber Sie können ruhig sein, er hatte nur ein Lächeln. Die Zeiten ändern sich, er freut sich auf Sie, Sie dürfen es glauben.
Aber nun will ich nicht schelten und klagen, sondern nur danken, danken aus tiefster, glückdurchströmter Seele! Und mich auf Ihr Wiederkommen freuen wie ein Kind auf Weihnachten. Denn wiederkommen müssen Sie, und zwar so schnell wie möglich. Morgen — nein, dann werden Sie ja meinen Brief noch kaum haben. Aber übermorgen, hören Sie, übermorgen! Obwohl wir gerade übermorgen — wieder ein boshaftes Geschick — einen Ball geben. Doch in der nächsten Woche verreisen wir — die Silberhochzeit meiner Eltern —, es ist also nicht aufzuschieben, und bis zu unsrer Rückkehr kann ich unmöglich warten. Das sehen Sie ein — nicht wahr? Der Ball ist störend, gewiss. Aber Sie kommen eben vor den andern, am besten am Nachmittag ... nein, am Morgen schon. Ich richte mich so ein, dass ich mit allem fertig bin, und dann haben wir den ganzen folgenden Tag, an dem mein Mann auf eine Herrengesellschaft fährt, ungestört für uns. Ist es nicht herrlich? Ganz allein ... Ganz für uns! Was habe ich Ihnen alles zu sagen! Was werde ich von Ihnen hören! Eine Ewigkeit ist es bis dahin für Ihre auf Sie harrende, sich kindisch freuende
Erna von Winterfeld.
Alter schlief längst wieder seinen festen Schlummer, ab und zu nur knurrte er im Traum, einmal bellte er sogar laut auf. Von der Strasse her drang der Lärm eines rasselnden Wagens oder die Hupe eines Autos, es war hier nicht so still wie in dem Villenviertel vor den Toren.
Rolf hörte von alledem nichts. Immer aufs neue las er den Brief, der vor ihm lag, immer aufs neue vergrübelte er sich in tausend Fragen und Gedanken.
Eine so aufrichtige, warme Freude sprach aus diesen Zeilen. Gewiss, er sollte darüber glücklich sein. Aber nach den drei Jahren voller Qual und Leid, voller Schweigen und Weichen mutete ihn dieser Brief doch anders an, als er erwartet hatte. Es lag an ihm, ohne Frage. Aber damals, als er sie kennenlernte — wie schüchtern, wie verschlossen, wie ängstlich jedes Wort wägend war sie ihm erschienen. Wie spröde in ihrem Empfinden, wie entzückend keusch, wenn sie für das, was ihre Seele füllte, keinen Ausdruck fand!
So hatte er ihr Bild im Herzen getragen all die schweren Jahre hindurch, so lebte sie vor ihm im beseligenden Gedanken eines endlichen Wiedersehens. Mit voller Absicht war er ohne jede Anmeldung zu ihr gefahren, unerwartet wollte er vor sie treten, den Ausdruck beobachten und tief in sein Innerstes schliessen, mit dem sie ihm entgegenkommen würde. Dies Glück war ihm vereitelt worden. Jetzt sollte er sie inmitten einer grossen Gesellschaft, unter gleichgültigen und fremden Menschen wiedersehen!
Aber länger warten konnte und wollte er so wenig wie sie. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und sagte ihr zu. Natürlich, er wollte schon des Vormittags kommen ... doch nein, das ging nicht. Für übermorgen war die zweite Leseprobe für sein neues Stück angesagt, sie konnte wieder bis zum Nachmittag dauern, und erst gegen Abend ging der nächste Zug, der ihn zu der Station brachte, auf dem ihr Wagen ihn erwartete. Er würde mit den andern allen zusammen kommen, würde sie nicht eher sehen, bis sie die Gäste begrüsste ... kein Wort allein konnten sie tauschen. Aber er hatte dann wenigstens den nächsten Tag. Wäre er doch erst da! Alles, was dazwischenlag, war bleierne Ewigkeit ... brückenlos breitete sie sich zwischen ihm und dem heissersehnten Tage.
*
Gerüstet steht Schloss Edeltann zum Empfang seiner Gäste. Sie kommen in hellen Scharen: von den umliegenden Gütern, aus der Residenz, von den benachbarten Garnisonen.
Auf einem offenen Wagen, dem ersten in der grossen Reihe, fährt Rolf dem Augenblick entgegen, von dem er geträumt, auf den er geharrt und gehofft drei schwere Jahre seines Lebens hindurch, und vor dem er zittert, wo er endlich Wirklichkeit werden soll. Zwei Offiziere fahren mit ihm. Selbstverständlich haben sie, als er sich vorstellt, längst von ihm gehört: das neue Stück, der kolossale Erfolg, die Freude, den Verfasser persönlich kennenzulernen — —
Er hat sich nach vorn zu dem Kutscher gesetzt, als solle die brennende Ungeduld seiner Seele den Pferden Flügel leihen, die schon so kaum zu zügeln sind und wie der Sturmwind durch den unfreundlichen Novemberabend dahinrasen, dessen Niederschlag feucht und fröstelnd von den Äckern emporsteigt. Jetzt eilen sie die mit Asphalt belegte Rampe empor ... jetzt halten sie.
Das also ist Edeltann, das seine Phantasie so oft in blühenden Farben sich ausgemalt, mitten im strengen Frondienst des Tages, wenn die Feder der müden Hand entsank, in der Einsamkeit stiller Mussestunden, die kein Freund, keine Geselligkeit ihm kürzte; Edeltann, dessen hohe Bäume hineinrauschten in das wogende Werden seiner ersten dichterischen Entwürfe, dessen Lüfte ihm Grüsse brachten von einem Glück, das noch in weiter Zukunft für ihn lag ... das er sich erobern wollte um jeden Preis!
Der Diener hat den Herren die Zimmer angewiesen; er erhält eins mit seinen beiden Weggenossen zusammen. Aber dann erscheint ein zweiter Diener: Herr Doktor Uckermann — Verzeihung, es sei ein Versehen, der Herr Doktor habe sein Zimmer für sich.
Und nun ist er allein in dem kleinen, mit aller Behaglichkeit eingerichteten Gemach, dessen Fenster auf den grossen, stillen Park schauen, während im Kamin das Feuer gemütlich prasselt.
Er hat sich, mit tausend Gedanken beschäftigt, langsam umgekleidet, sich eine Zigarette angezündet und in einen bequemen Korbsessel gestreckt. Der Novemberwind rüttelt an den Fensterläden, da draussen fahren immer noch Wagen und Autos vor, nichts hört man als ihr Töff-Töff und das Trappeln der Pferdehufe auf dem glatten Asphalt. Aber jetzt — nein, er hat sich nicht geirrt, das schüchterne Klopfen wird vernehmbarer. Schnell öffnet er. Ein niedliches Mädchen mit weisser Schürze und Haube im schlichtgescheitelten Haar steht vor ihm: „Die Frau Baronin schicken mich. Frau Baronin möchten dem Herrn Doktor einen guten Abend wünschen.“
Er kann trotz der Erregung des Augenblicks ein Lächeln nicht unterdrücken. Irgend etwas muss der Mensch in diesem Leben doch sein, darum nennt ihn alle Welt den Herrn „Doktor“, und er hat es längst aufgegeben, sich gegen diese ehrenhafte Benennung zu wehren.
Das Mädchen geht voran, und er folgt, den grossen Korridor entlang, über den einige festlich gekleidete Gestalten, hier und da auch ein Bedienter und ein Stubenmädchen eilig huschen, vorbei an der grossen Haupttreppe, einen schmalen Gang hindurch, dann eine zweite Treppe hinunter, die für das Hauspersonal bestimmt scheint, zu einer mit Wandtapete verkleideten Tür — steht Erna gegenüber.
Kein Wort vermag er herauszubringen. Die tiefe Bewegung lähmt seine Zunge. Genau so sieht sie aus wie damals, da er sie verlassen, wie sie ihm vorgeschwebt in den wachen Träumen der Nächte, in dem zehrenden Suchen der Tage: dasselbe schlanke Ebenmass der Glieder, in dem blühenden Antlitz keine Linie verändert, in den grauen Augen jener weiche Schimmer, der so warm zu leuchten wusste, wenn ihre Gedanken und ihre Blicke sich begegneten.
Sie ist gefasster und gewandter. Er kommt sich ihr gegenüber so verändert vor, so viel älter geworden und abgesonderter von der Welt und den andern. „Ich konnte Sie unmöglich zum erstenmal da drüben begrüssen im Gewühl der Leute, ich musste Ihnen zuerst allein Willkommen auf Edeltann sagen.“
Sie reicht ihm die Hand, erst die eine, dann auch die andre. Er führt sie beide an die Lippen, er küsst sie heiss und inbrünstig, wie ein Waller das erste Gnadenbild seiner Heimat, wenn er nach langer Pilgerfahrt endlich wiederkehrt aus der Fremde in den Frieden, in das Glück. „Ich danke Ihnen!“
„Nein, Sie dürfen nichts verkehren, zu danken habe ich allein. Drei Jahre keine Silbe, kein Hauch, der von Ihrem Leben hinüberwehte zu dem meinen — und doch haben Sie mich nicht vergessen, sind gekommen!“
„Ich Sie vergessen!“
Ein ganzes Bekenntnis von Glück und Treue liegt in seinen Worten.
Das Mädchen tritt ein. „Der Herr Baron fragen nach der Frau Baronin, die ersten Gäste sind schon in den Saal getreten.“
Noch einmal reicht sie ihm die Hand, noch einmal küsst er sie.
*
„Herr Uckermann, meine Damen und Herren, Herr Uckermann!“ Winterfeld hat den früheren Regimentskameraden freundschaftlich unter den Arm genommen und geht mit ihm von Gruppe zu Gruppe. „Gestatten Sie, Gräfin, Herr Uckermann; hier, lieber Trewitzsch, Herr Uckermann, von dem ich Ihnen gestern erst erzählte; der Schriftsteller, Frau von Bonin, den zu allererst zu Ihnen zu führen Sie mir eben noch auf das Gewissen banden; mein gnädiges Fräulein, erlauben Sie, dass ich Ihnen einen Dichter vorstelle, der zugleich ein ausgezeichneter Tänzer ist, Sie werden sehen, dass ich nicht zu viel sage.“
Von dem Landadel, der gut die Hälfte der Geladenen bildet, kennt kaum einer seinen Namen. Aber einige Gäste aus der Residenz besinnen sich, ihn rühmend gehört zu haben, manche haben sein Drama gesehen, vor allem einige Offiziersdamen: dies wunderbare Stück, über das ihre Männer schimpften, weil es ihnen nicht korrekt und standesehrfürchtig genug erschien, und das sie mit um so heisserer Spannung im Theater oder zu Hause verschlungen haben.
„Hast du sein Stück gesehen?“ fragte die kleine, schlecht gewachsene, aber um so eitlere Gräfin Roeder Lisa Bensing, die bildhübsche achtzehnjährige Tochter des Obersten, den frisch aufgegangenen Stern der Bälle in der Residenz und Umgegend.
„Nein, Vater hat es mir nicht erlaubt. Aber gelesen habe ich es. Mutter hat es sich gekauft; ich sage dir: grossartig! Ich habe nur noch den einen Viertanz frei — wenn er mich doch auffordern wollte!“
Die Diener reichen Erfrischungen. Rolf leert mehrere Kelche echten Sekts. Eine Unruhe ist in ihm und eine Ungeduld, die er betäuben muss. Um ihn steht alles in Gruppen, plaudert und lacht. Immer noch wächst der Kreis, ganze Wellen von Farben fluten in den Saal, dazwischen leuchten die Uniformen der Offiziere. Die Gruppen verschieben sich, die Plätze werden gewechselt, alles ist langsam gleitende Bewegung.
Rolfs Augen blicken auf das Spiel. Wie oft hat er früher in seinem Mittelpunkt gestanden! Wieviel Frauenherzen sind ihm zugeflogen, wieviel Liebe hat er gegeben und empfangen! Das liegt nun weit hinter ihm, durch all das leuchtende Wirrwarr hindurch sucht sein Auge nur eine.
Sie steht am Eingange des Saales; es kommen immer noch einige Spätlinge, die sie begrüssen muss. Ein lichtgrünes Kleid umspielt die schöne Form ihres Körpers, auf dem dunklen Haar funkelt ein Reif von Edelsteinen. Jedem reicht sie die Hand zum Kuss, für jeden hat sie ein verbindliches Lächeln, ein freundliches Wort; jetzt ruft sie dem Gatten, der einige Schritte von ihr entfernt empfängt, eine kurz Bemerkung zu, dann schweift ihr Auge durch den weiten Saal, suchend, die Lider ein klein wenig gekniffen, wie er es von früher von ihr kennt — von niemand beobachtet winken sie sich einen kurzen Gruss zu, wie in unvergessenen, vergangenen Tagen auf solchen Gesellschaften.
„Wahrhaftig, er ist es — Odysseus, genannt Uckermann, der endlich wiederkehrt zu den heimatlichen Gestaden!“
Der Rittmeister, der Rolf die beiden Hände entgegenstreckt, war ihm einer der liebsten seiner früheren Regimentskameraden, dennoch ist ihm die Bewegung wenig erwünscht, er hätte gern seine Rolle als Unbekannter und Verschollener in diesen Kreisen weitergeführt. Aber gegen die Herzlichkeit, mit welcher ihn der alte Kamerad begrüsst, gibt es kein Wehren.
„Und Sie, Trotha, wie kommen Sie hierher?“
„Freundschaft gegen Winterfeld, die wir weiterpflegten, als ihm das alte Familiengut in den Schoss fiel und mich ein wenig günstigerer Wind hierher in die Garnison verwehte. Wahrhaftig, ich sah Ihr Stück und hatte keine Ahnung, dass Rudolf von Willecke sein Verfasser war.“
„Der ist tot. Ich bitte Sie, mich hier nur als den Schriftsteller Rolf Uckermann zu kennen.“
„Selbstverständlich, wenn Sie es wollen. Aber Winterfeld und seine Frau?“
„Sind die einzigen, die unterrichtet sind, und tun mir den Gefallen.“
„Gut; aber Sie müssen mir nachher erzählen. Für jetzt einen kleinen Dienst: Sie haben noch einige Tänze unbesetzt — alle? Um so besser. Dann bitten Sie um den Blumenwalzer die Gräfin Roeder, das kleine, aber gutartige Ungetüm mit dem Panzer auf der Brust und dem Turm auf dem Kopfe, und zur Belohnung tanzen Sie mit der reizenden Bensing, der Tochter unseres Alten. Sie gestand mir eben — ich bin immer noch im alten Fahrwasser: so eine Art Tanzordner — dass sie noch einen Viertanz unter günstigen Umständen zu vergeben hätte. Ich machte ihr Vorschläge, aber sie meinte, die Umstände wären alle nicht günstig genug, und als ich mich aufmachen wollte, ihr einen ganzen Stab dienstbeflissener Tänzer zur Auswahl zu bringen, hielt sie mich zurück und fragte, ob ich Rolf Uckermann, den Dichter, kenne. Ihr Einfluss auf die Frauen scheint Ihnen auch im neuen Gewand treu geblieben zu sein, jedenfalls verdanke ich ihm, dass ich Sie so schnell wiederfand. Also abgewacht, nicht wahr? Und auf Wiedersehen!“
*
„Ich habe noch nie mit einem Dichter gesprochen“, sagt Lisa Bensing, als Rolf sie um einen Walzer bittet.
„Wir sind ja auch heute nur zum Tanzen da. Und ob es ein Genuss ist, mit einem Dichter zu tanzen —?“
„Aber Sie tanzen gut.“
„Ich habe es früher gelernt als das Dichten.“
„Kann man denn das lernen?“
„Das Tanzen oder das Dichten?“
„Ich meine natürlich das Dichten.“
„Ich glaube, eher als das Tanzen.“
Leicht und fest zugleich lehnt Lisa Bensing in Rolfs Armen, bald schliesst sie die Augen, bald hebt sie sie zu ihm und sieht ihn an mit dem Vertrauen eines Kindes. Sie hat Augen, in die zu blicken beruhigend und friedbringend ist.
„Papa, Herr Uckermann, dessen Stück du gesehen hast“, stellt sie ihren Tänzer ihrem Vater vor, und aus jeder Silbe hört man den Stolz. Der Oberst sagt einige verbindliche Worte; nun muss Rolf auch zu der Mutter geführt werden. Er folgt gern, weil er Frau Bensing in Unterhaltung mit der Hausfrau sieht und ihm ungezwungene Gelegenheit wird, sich Erna zu nahen.
Ein warmer Blick, ein verstohlenes Sichberühren der Hände, dann rufen Erna die Pflichten der Gastgeberin. Auch die reizende Lisa ist von einem Trupp junger Offiziere umschwärmt. Rolf ist allein. Einige wohlwollende Blicke aus eben erwachten und aus reifen Augen folgen ihm, wie er langsam durch die wirbelnden Paare sich Bahn bricht.
Ihm ist das gleich, er weiss: er hat mit der verwachsenen, hochgetürmten Gräfin Roeder zu tanzen, dann noch mit einigen andern Damen, auf deren Ballkarte er seinen Namen hat verzeichnen müssen, schliesslich den zweiten Viertanz mit der kleinen Bensing — und dann wird ja auch wohl dies Fest sein Ende nehmen, und der Rest der Nacht, in der er kein Auge zutun wird. Aber aus der Nacht wird der Tag werden, der ihm das Glück bringen soll und eine ernste Entscheidung.
Man geht zum Essen. Rolf führt eine angejahrte Regierungsdame, die nur für eine Unterhaltung zu haben ist, in der er versagt. Aber Erna hat es einzurichten gewusst, dass sie ihm schräg gegenübersitzt, und während ihre Worte sich in den vorgeschriebenen Bahnen bewegen, sprechen ihre Blicke eine beredtere Sprache.
Wieder singt die Geige, wieder folgen ihr mit nüchterner Schwerfälligkeit die andern Instrumente. Das alte Cello holpert und stolpert den mühsamen Pfad, die Klarinette seufzt und stöhnt. Aber die Geige steigt aus der Niederung empor mit jubelndem Preis und schmettert ihr Lied den Lüften entgegen wie die Lerche, die sich aus dem Brachfeld erhebt; denn der sie spielt, ist ein Künstler.
Der Viertanz ist im Gange. An Rolfs Seite tanzt Lisa Bensing.
Er hat für die Mädchengestalt an seiner Seite, die ihm mit so süsser Schelmerei ihre tiefen Verbeugungen macht, keinen Blick, denn in demselben Viereck tanzt Erna von Winterfeld; sie hat auch das geschickt zu machen gewusst. Ihr Partner ist ein Besitzer aus der Nachbarschaft, der sich wie ein Elefant wendet und wie ein Elefant tritt; wenn er in den Pausen zu ihr spricht, dann gleiten seine Augen ruhig und frech über ihre Gestalt, als streiften sie die Kleider von ihr ab. Rolf findet, dass sie zu entgegenkommend ist, dann wieder sagt er sich, dass jeder Blick und jedes Wort ihm allein gelte, und wird ruhiger. Wenn sich in den grossen Runden ihre Hände berühren, brennen sie ineinander. Ein Glückstaumel packt ihn.
Nun wird er auch liebenswürdiger gegen seine Gefährtin. Aber bei alledem quält ihn eine wachsende Unruhe: dies Fest, das Ewigkeiten zu umfassen scheint, möchte doch endlich sein Ende haben! In seinen Gedanken spricht er fortwährend mit Erna, er hat ihr soviel zu sagen, Ernstes und Frohes.
Er hat Lisa zu ihrer Mutter geleitet, einige unvermeidliche Worte gewechselt und sucht jetzt Erna. Aber ihr Partner hat sie noch nicht freigegeben, er muss sich gedulden. Trotha kommt auf ihn zu.
„Welche geheimnisvollen Kräfte besitzen Sie, sich in diesem hellen Saal unsichtbar zu machen? Ich suche Sie hier wer weiss wie lange. Frau von Szmula, die schöne Polin, dort an dem letzten Pfeiler — der Herr neben ihr ist ein Landsmann, ein Magnat —, brennt auf Ihre Bekanntschaft.“
Grosse dunkle Augen begrüssen ihn; erst sind sie müde, wie zugedeckt von schattenden Schleiern, dann hemmen die deckenden Wimpern das ausbrechende Feuer nicht mehr. Sie lässt ihn so bald nicht frei, er gibt sich auch gar keine Mühe, loszukommen; es ist Temperament in dieser Frau, er hat sich lange nicht so unterhalten. Oder vielmehr lange nicht so gern zugehört, denn das Wort führt sie allein. Aber es spricht Sinn und Witz aus allem, was sie sagt; sie hat die Gabe, die ihm von jeher an Frauen am besten gefallen: so leicht zu plaudern, dass sich der Geist nie aufdrängt und die Grazie immer die Führerin bleibt.
Endlich ist er entlassen. Aber in Gnaden, wie er wohl merkt; der polnische Magnat scheint eifersüchtig zu sein.
Unglaublich — immer noch steht Erna im Gespräch mit dem Elefanten und lacht zu seinen faden Scherzen. Jetzt lässt sie sich von ihm zum Walzer führen. Wie der Elefant hinwalzt über das glatte Parkett, die plumpen Hände prall und schwer um den Leib der schönen Frau gelegt!
Der Anblick ist ihm unerträglich, er verlässt den Saal und begibt sich in die angrenzenden Zimmer. Im Rauchzimmer ist undurchdringlicher Qualm und wüster Lärm, er geht aufs Geratewohl weiter; einen Augenblick wenigstens möchte er allein sein.
Unermesslich scheinen die Räume in dem grossen Schlosse ... endlich ein grosses, nur matt erleuchtetes Zimmer, in der Mitte ein Billard, dichtgestellte Bücherregale an den Wänden — doch er irrt, auch hier ist er nicht allein. Aber der Herr, der in einem gewaltigen Klubsessel sich streckt, auf die Lehne ein Buch gelegt, liest so eifrig, dass er sein Kommen gar nicht merkt.
Rolf lässt sich in der entgegengesetzten Ecke nieder. Der andre liest weiter ... aber er wendet keine Seite mehr, die feingepflegte Hand fällt auf das Buch, die Zigarre entgleitet ihr, der Kopf kommt in eine kurze schaukelnde Bewegung, sinkt dann auf die Brust — er ist eingeschlafen. Seine ruhigen Atemzüge dringen, manchmal von einem kurzen Aufschnarchen unterbrochen, durch die Stille. Rolf muss lächeln; eine bessere Art, den elenden Kram eines solchen Abends totzuschlagen, ist nicht denkbar.
Wer das Leben verschläft, verraucht und es dreimal verachtet! — Wenn er es doch ebenso machen könnte, schlafen bis in den späten Morgen hinein, bis — wahrhaftig, eine volle Stunde ist er schon hier!
Da drüben rüsten sie zum Blumenwalzer, er hat es an dem kleinen von Sträussen und Orden übersäten Wagen gemerkt, den eben zwei schneeweisse Ziegen mit blauen Bändern und helläutenden Glocken um den Hals durch das Nebenzimmer ziehen, und der jetzt ein solches Entzücken auslöst, dass seine Wogen bis in diese Stille branden. Geschmack hat Erna von Winterfeld von jeher besessen.
Ob sie ihn vermissen, ihn suchen wird? Oder ob sie immer noch den Schwänken des Elefanten zuhört, in seinen Armen im Walzer sich wiegt? Er will zu ihr — aber als er sich erhebt, knarrt sein Stuhl, sein Gegenüber schrickt zusammen, das dicke Buch gleitet von der Lehne des Sessels, poltert auf den Fussboden —
„Donnerwetter — wo? — wer?“ Sein schlaftrunkener Blick fällt auf den Fremden. „Wo? — Zum Donnerwetter?“ — — Rolf unterdrückt ein Lächeln, kommt ihm zu Hilfe. „Sie haben das beste Mittel gewählt, einen langen Ballabend angenehm und nutzbringend zu verkürzen; ich erlaube mir einen guten Morgen zu wünschen und mich vorzustellen: Uckermann heisse ich.“
„Habe ich geschlafen? Nein, gelesen. Vielleicht ein bisschen gedämmert. Aber wie war doch Ihr Name? Verzeihen Sie, ich — Uckermann? — — Uckermann? Den Namen kenne ich doch. Sehr gut sogar. Er hat mich lange beschäftigt. Alle diese Tage hindurch. Sie sind doch nicht Rolf Uckermann, der Dichter des Stückes, das sie in der Residenz spielen?“
„Ich kann es nicht abstreiten.“