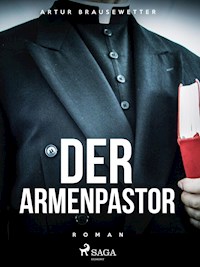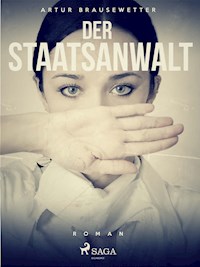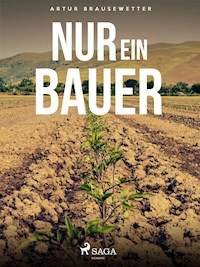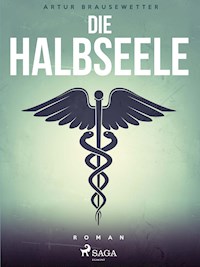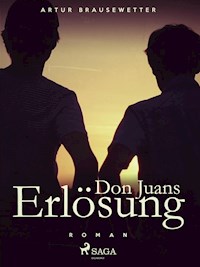Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der alte Friedrich Vandekamp führt in einer traditionsreichen Hansestadt sein angesehenes Handelskontor. Er ist als Geschäftsmann umsichtig und erfolgreich, aber auch unbarmherzig hart, wenn es um die Durchsetzung der Interessen seines Hauses geht. Sein Sohn Timm will ausgerechnet die Tochter eines Handelspartners heiraten, den Vandekamp wegen eines Auftrags, den er ihm entzieht, in den Ruin treibt. Auch gegen viele andere Misslichkeiten, teils geschäftlicher, teils familiärer Art, muss Vandekamp ankämpfen. Eines Tages eröffnet ihm sein Arzt, dass er wegen eines unheilbaren Herzleidens nur noch ein Jahr zu leben hat. Jetzt trifft der alte Kaufmann Anordnungen, die nicht jedem in der Familie gefallen ...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Brausewetter
Der Ruf der Heimat
Roman
Saga
Ebook-Kolophon
Artur Brausewetter: Der Ruf der Heimat. © 1937 Artur Brausewetter. Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711487679
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
Meta Schultz-Gora zu eigen!
Erstes Buch
Friedrich Vandekamp befindet sich auf seinem Morgenweg in sein Kontor. Es liegt auf der Speicherinsel, mitten im geschäftlichen Treiben der alten Hansestadt, die jetzt „Freie Stadt“ genannt wird. Sein Landhaus aber hat er sich draussen aufgebaut. In grün umkränzte Hügel hat er es gebettet mit weitem freien Blick auf den sanft aufsteigenden Wald und den blauenden Himmel über ihm. Kein Ton der aufgeregten Geschäftigkeit dringt in seine abgeschlossene Stille. Nur das Surren der elektrischen Bahn hört man aus verschleierter Ferne. Sonst nichts als Vogelgezwitscher und Bäumerauschen, und an Tagen, an denen die Luft besonders tragfähig ist, ein dumpf verhaltenes Murren und Grollen, als käme es vom Meere herüber. Aber vielleicht bildet er sich das nur ein. Denn seine Frau, die oben krank auf ihrem Zimmer liegt und für alles, was um sie her klingt und tönt, ein sehr feines Gehör besitzt, hat für seine Wahrnehmung nur ihr überlegenes Lächeln und meint, das Meer läge viel zu weit von ihrem waldumgebenen Hause, als dass man sein Rauschen bis hierher vernehmen könnte. Mag sein, dass er es sich einbildet. Schliesslich ist es ihm gleich. Er hat an soviel anderes zu denken, für soviel anderes zu sorgen, das wichtiger und gewinnbringender ist.
Er macht den Weg immer zu Fuss. Gewiss, er hat seinen Wagen. Aber er benutzt ihn nie. Sein Sohn Timm beansprucht ihn für seinen Sport, seine Jagden und galanten Ausflüge genügend, und er bedarf bei seiner angestrengten Tätigkeit der Bewegung und der frischen Luft.
Der Weg ist weit, aber sehr schön. Besonders in der Morgenfrühe, wenn alles um ihn her eben aufgestanden und noch jung und unverbraucht ist. In den Vorgärten, die sorgsam, manchmal bis zu gezierter Überkultur, gepflegt sind, erfreut ihn die bunte Üppigkeit der scheinbar wahllos und doch in wohlüberlegtem Gleichmass gepflanzten Bäume. Am Wegesrand sind die schattenden Kastanien beschäftigt, ihre ersten Kerzen anzuzünden, einige sind bereits weiter in der Arbeit, andere scheinen sich Zeit zu lassen. Gerade so ist es mit dem Flieder; der weisse ist in voller Blüte, der rotblaue hüllt sich noch in keusch verschlossene Knospen. Aber leiser, weicher Duft schwebt schon herüber, erquickt den Sinn und lenkt Vandekamp, für Augenblicke wenigstens, von den Gedanken und Sorgen ab, die nun einmal mit ihm gehen, wohin er den Fuss auch wendet. Dafür ist er der Inhaber einer der grössten Firmen der Stadt, und dafür hat er zu Hause die kranke Frau.
Nun ist er in die herrliche alte Allee eingebogen, die, zweireihig zu beiden Seiten der breiten, asphaltierten Strasse, den schmucken Vorort mit der Stadt verbindet.
Die Linden, die Spätlinge des Frühlings, haben weichschimmernde grüne Schleier angetan, die sich hier und da schon verdichten, so dass die Morgensonne einige Mühe hat, mit ihren des Kampfes noch wenig geübten Strahlen durch ihr im leichten Winde spielendes Gewirr hindurchzudringen.
Friedrich Vandekamp hat die Allee verlassen und wandert, den Schritt ein wenig beeilend, über die Nordpromenade, durch den winzigen Irrgarten, dessen Benennung einer übermütigen Ironie entsprungen scheint, der Stadt zu.
Der Frühling ist diesmal später und kälter als sonst wohl auf den Plan getreten. Er hat hier oben im herbgetönten Osten ja immer ein etwas sprödes Gesicht. Diesmal jedoch ganz besonders. Gerade so aber liebt ihn Friedrich Vandekamp. Denn in seiner durchsichtigen Klarheit und härtlichen Würze wirkt er um so wohltätiger auf angespannte Nerven und ein überarbeitetes Gehirn. Dankbar geniesst er ihn mit jedem Schritt, den er vorwärts kommt, zugleich mit einer leichten Wehmut, zu der er neigt. Denn er weiss, wie bald und unversehens, wenn man Tag für Tag dieselbe Strasse wandert, das Bild wechselt, wie dieser lachende Frühling dem schwülen Sommer, in dem ihm der lange Weg nicht mehr ganz leicht fällt, und dem Spätherbst, unter dessen fröstelnder Feuchtigkeit er leidet, den Platz räumen wird.
Wie pfeilschnell doch solche Jahre dahinfliessen, wenn jedes von ihnen genau dasselbe bringt: die streng geregelte Arbeit im Kontor, das anstrengende Disponieren, den niemals Ruhe lassenden Gelderwerb.
Aber diese wunderbaren Denkmäler altdeutscher Kunst, die er auch heute wieder mit stiller Ehrfurcht betrachtet, sie bleiben sich in ihrer Schönheit immer gleich, ob er sie im flimmernden Spiel der jungen Frühlingskinder, im satten Glühen der sommerreifen Sonne oder in den grotesk gezackten Gebilden des winterlichen Schnees erblickt.
Seltsam, dass das Geschaffene beständiger und dauerhafter sein kann als die Natur, ja, als das Leben selber, in dem der Wechsel das einzig Bestehende ist: dies goldgezierte Hohe Tor und gegenüber der altgotische Stockturm, über die Jahrhunderte hindurch Frühling und Herbst, Sommer und Winter dahingegangen sind und die so fest und trutzig dastehen, als gäbe es für sie weder einen Wechsel der Jahreszeiten noch der Schicksale.
Die Langgasse mit ihren alten Patrizierhäusern schreitet er hinunter, wird überall gegrüsst, hier und da auch angesprochen, obwohl er ungern stehen bleibt und Antworten gibt, deren Einsilbigkeit nicht zum Weiterreden ermuntert.
Pfeilschlank wie eine Nadel glüht der goldverbrämte Rathausturm zu ihm hinüber. Wie ein stiller Fingerzeig in Fernen, die man nur mit der Seele suchen und ersehnen kann. Feingemeisselte Spitzbogen lassen ihr wunderzartes Gewebe in der Sonne funkeln. Um den Neptunsbrunnen schwirren Tauben, flattern mit den silberglänzenden Schwingen hoch empor zum alten Artushof ...
Und nun? Was wächst ihm da entgegen? Reckt sich vor ihm empor aus dem steinernen Wald von Zinnen und Mauern, dem Geäst spitzgeschärfter Vasallentürmchen, aus dem weich und warm ihn umschmiegenden Häusergewirr? Etwas Massiges, Wuchtiges, Unaussprechliches, ein Recke, stark und gewaltig, einsam in seiner unnahbaren Majestät. Lässt den Blick auf ihn hinuntergleiten, den armen kleinen Wanderer dort, der mit seinen Geldgedanken und Geschäftssorgen seine Strasse zieht, so stolz und geringschätzig zugleich, dass Friedrich Vandekamp, der eben eine sehr gewichtige, heute abzuschliessende Berechnung durchkalkuliert hat, über sich selber den Kopf schütteln muss.
Der Turm von St. Marien ist es, das Wahrzeichen und der getreue Eckart der alten Hansestadt, der sturmverwitterte Zeuge ihrer Geschichte und Geschicke, ihrer Leiden, Kämpfe und Siege.
Friedrich Vandekamp ist kein Kunstkenner. Er will auch keiner sein. Er ist Kaufmann. Das ganze Wesen und Werk seines in nüchterner Gleichmässigkeit sich abwickelnden Daseins ist in dies eine Wort eingeschlossen wie in eine Festung. Aber die Liebe zu seiner Heimatstadt, in der er geboren ist, in der er auch sterben will, die trägt er im tiefsten Herzen, und ihre alten Bauten und Kunstdenkmäler sind ihm vertraut von seiner ersten Kindheit an.
Am Steffenshaus vorbei ist er durch das grüne Tor an die Mottlau gelangt. Und wieder ist ihm, als spürte er den Geruch der See, den der schärfer gewordene Wind von Neufahrwasser herüberträgt. Er liebt diesen Geruch. Eine erfrischende Würze ist in ihm und ein neubelebender Atem. Er muss an den Ausspruch eines süddeutschen Geschäftsfreundes denken: Dass die Leute im härtlichen Norden und Osten sich länger schaffensstark erhielten als die im weicheren Süden oder Westen.
Auch er?
Gewiss — — auch er.
Und doch — — da regt es sich wieder, dies schreckliche Gefühl der Leere, das vom Magen aufsteigt, schmerzend über Brust und Rücken streicht, auch das Herz auf einen bangen Augenblick aussetzen lässt, so dass er stehen bleiben muss ... mitten auf der Strasse.
Es sind einige Wochen her, dass sich diese Anfälle eingestellt haben, plötzlich und unvermutet, niemals mitten in der Arbeit, aber mehrere Male auf dem Wege zum Kontor, der vielleicht schon zu weit und anstrengend für ihn geworden.
Er hat mit niemand aus seinem Hause darüber gesprochen. Mit wem sollte er auch? Seine Frau ist mit dem eigenen Leiden vollauf beschäftigt, und er darf sie nicht aufregen. Seine Kinder aber, Timm in seiner strotzenden Gesundheit und Ina in ihrer abgesonderten Art, wären einer Klage von ihm gewiss wenig zugänglich gewesen.
Schliesslich hat er sich dem alten Meckbach, seinem vielbewährten Hausarzt, offenbart. Der hat ihn nach einer eingehenden Untersuchung für vollkommen gesund erklärt. „Ein bisschen Nerven- und Muskelüberanstrengung“, hatte er gesagt. „Das ist alles. In unseren Jahren muss man haushälterisch mit seinem Körper umgehen.“
Und er hatte recht behalten. Es ging vorüber, geht auch jetzt wieder so schnell vorüber, wie es gekommen ist. Und er kann seinen Weg, von Druck und Schmerz befreit, fortsetzen.
„Aber seltsam ist es doch“, denkt er bei sich selber, „komisch beinahe! Da beschäftigt man sich den ganzen Tag vom frühen Morgen bis zum späten Abend mit seinen Plänen und Geschäften, kauft die Zeit aus, wünscht der Sekunde Ewigkeitsdauer, nur um sie gewinnreich nutzen zu können. — — — Und eines Tages versagt der Körper seinen Dienst. Man wird schwach .. hinfällig .. krank .. Und dann — —“
Ja — — — und dann?
Durch die Luft schwimmt heller Glockenton. Das Uhrenspiel im Rathausturm lässt einen frommen Choral ertönen, kündet dann mit ehernen, bedächtig ausholenden Schlägen die neunte Stunde.
Es ist genau die Zeit, in der er Morgen für Morgen in die Speicherinsel einbiegt. Mit ihr beginnt die Welt, in der er lebt und wirkt. Wie ein weiter Lagerplatz dehnt sie sich mit den übereinandergetürmten Stockwerken, den scharf und spitz hervorspringenden Giebeln. Von den Stürmen der Zeit zerklüftet und zernagt stehen sie Schulter an Schulter, tragen noch ihre Inschriften, ihre meist der Tierwelt entnommenen Namen aus verklungenen Jahrhunderten.
Hier befindet sich, ein Fremdling in seiner schmalfrontigen, verträumten Umgebung und sich fast grotesk von ihr abhebend, ein nach moderner Sachlichkeit breit und hoch aufgeführtes Gebäude: das Holzexporthaus Vandekamp & Co. Und als Friedrich Vandekamp in seine weitangelegte Flurhalle tritt, lässt er Frühling und architektonische Schönheit hinter sich, denkt und lebt in ihm nichts als das Geschäft.
Im Kontor ist heute nicht die Ruhe, deren Vorbild er gibt und die er auch von den anderen verlangt. Alles ist in einer Erregung, deren Schwingungen sich von Pult zu Pult fortpflanzen. Man hat auf den Chef gewartet, gibt, scheinbar in eifriger Versenkung über seine Befrachtungstabellen und Konossemente gebeugt, gespannte Obacht, was er sagen, was er tun wird.
„Er weiss noch nichts“, flüstert Max Laudien, der Einkäufer, zu Herrn Siebenfreund hinüber, der der Abteilung für Polen und Pommerellen vorsteht.
„Er weiss alles“, gibt der zurück, „er sagt nur nichts.“
Indessen ist Friedrich Vandekamp in sein Privatkontor getreten. Es ist ein von allen anderen Räumen streng abgeschlossenes Zimmer, nicht umfangreich und mit nüchterner Einfachheit ausgestattet. In der Mitte, die grössere Hälfte des Zimmers einnehmend, befinden sich zwei gegenübergestellte Schreibtische. Auf dem des Chefs liegt ein Stoss der für ihn streng ausgesonderten Post. Der andere ist mit Geschäftsbüchern, Tabellen und Konnossementen belegt.
Von dem Augenblicke an, in dem Friedrich Vandekamp diesen Raum betritt, ist er für alle anderen gesperrt. Dafür sorgt schon Söna Sentland, die niemanden zum Chef lässt. Nur unaufschiebbare Dinge und solche von höchster Wichtigkeit werden ihm persönlich vorgetragen. Für alles andere ist Berthold Kernreif da, der schmächtige, von oben bis unten zugeknöpfte Prokurist, der im Verkehr mit den Kunden und Maklern die Unnahbarkeit und die schweigende Strenge der Zurückhaltung von seinem Chef gelernt hat, ihn überhaupt, wo es angebracht oder nur möglich ist, gern kopiert.
Und schon hat Friedrich Vandekamp den ersten Verdruss des Tages, gegen den er allmählich abgestumpft sein sollte, es aber immer noch nicht ist: der Stuhl ihm gegenüber ist leer.
„Er kann sich nicht an die Pünktlichkeit gewöhnen“, flüstert er mehr traurig als ärgerlich vor sich hin. „Vermutlich hat er wieder die halbe Nacht im Klub gesessen oder seine kleine Freundin nach dem Kino zu Lauterbach geladen ...“
Er nimmt seine Post zur Hand. Einige der zahlreich eingegangenen und meist ausführlichen Schreiben mustert er oberflächlich, um sie bald zur Seite zu legen, andere fliegt er durch, ohne ihnen weitere Beachtung zu schenken. Dann drückt er den roten Knopf auf dem umfangreichen Fernsprechapparat zu seiner Linken, nimmt den Hörer, ruft ein kurzes Wort hinein, und Theobald Kernreif, der im Dienste des Hauses ergraute Prokurist, erscheint.
Friedrich Vandekamp gibt ihm an der Hand der verschiedenen Schreiben und der zu ihnen gemachten Bemerkungen seine Weisungen, knapp, klar, ein jedes Wort wägend, damit er nicht eins zuviel sage. Denn er weiss, mit zu grossen Anforderungen darf er den nur auf sehr gerader Linie laufenden Gedankengang seines Prokuristen nicht beschweren. Schliesslich braucht er kaum einen Prokuristen. Er disponiert und verfügt allein, und Söna Sentland mit ihrem schnellen Erfassen und gewissenhaften Ausführen genügt ihm vollkommen.
So hat auch diesmal die ganze Unterredung nur wenige Minuten gedauert, und Friedrich Vandekamp gibt den üblichen kurzen Wink, der eigentlich nur ein ganz leichtes Aufheben des Armes von der Schreibtischplatte ist und bedeutet, dass Theobald Kernreif entlassen ist.
Der aber rührt sich nicht von der Stelle. Wie angewurzelt verharrt er auf seinem Platze, das ernste, in einem unbestimmbaren Blassgrau schimmernde Auge unter den gewölbten Brillengläsern mit einem halb besorgten, halb ängstlichen Blick auf seinen Chef gerichtet.
„Sie wissen wohl noch nicht, Herr Vandekamp — —“
Schon hält er inne, macht eine jener schwerwiegenden Pausen, die er als eine seiner stärksten Gesprächshilfen ansieht und die Friedrich Vandekamp unerträglich sind.
„Dass Brackmann und Collins, denen wir die grosse Lieferung von Eichenrund- und Exporthölzern übertrugen, in Schwierigkeiten geraten sind, dass die Nachrichten aus Spanien wenig günstig lauten, dass die Unruhen dort, die bereits im Abflauen sind, uns weniger Sorge machen dürften als die Mitteilung unseres Korrespondenten aus Madrid, dass die Firma, mit der wir abgeschlossen, auf nicht mehr ganz sicheren Füssen steht — nicht wahr, das wollten Sie sagen?“
„Ja, wenn Sie so genau unterrichtet sind — —“
Theobald Kernreif kaut an den Worten. Er will eine gewichtige Einwendung machen, überlegt sie aber hin und her. Denn er darf den Respekt nicht verletzen, den er seinem Chef schuldig ist und den er, solange er seine Stellung bekleidet, stets als sein höchstes Gesetz betrachtet hat.
„— — Dann verstehe ich nicht“, sagt er jetzt, „dass Sie einen so weitgehenden Vertrag mit Brackmann und Collins tätigen konnten.“
„Vertrag? Von einem Vertrag ist nie die Rede gewesen.“
„Wenn er auch nicht formuliert war, so hat ihn Herr Brackmann doch als solchen aufgefasst.“
„Das ist seine Sache.“
„Und hat danach gehandelt.“
„Das ist seine Torheit.“
„Das Material, dessen wir für unsere spanische Lieferung bedurften, überstieg das Gewohnte und ging gewiss über Philipp Brackmanns Kräfte.“
„So hätte er die Lieferung ablehnen müssen.“
„Der Auftrag war ihm zu verlockend. Er hat einen solchen seit langer Zeit nicht erhalten.“
„Man soll nicht Kaufmann werden, wenn man nicht das Zeug dazu hat.“
Die Tür öffnet sich ... behutsam und leise, als bewegte sie ein schlechtes Gewissen. Ein junger Mann mit einem für die frühe Jahreszeit stark gebräunten Gesicht tritt in das Zimmer, wirft einen etwas unsicheren Blick auf den Vater, geht auf ihn zu, streckt ihm die gleichfalls fast dunkel gebräunte Hand entgegen.
„Es wurde gestern ein bisschen später. Zudem —“
„Hattest du die fällige Autopanne.“
„Wie du immer alles weisst, bevor man es dir sagt. Auch in Kleinigkeiten. Es ist wirklich erstaunlich.“
Er hat den Prokuristen flüchtig begrüsst und sich an seinen Schreibtisch gesetzt. Eilig gleiten seine wohlgepflegten Finger durch die Postsachen, die ihm der Vater zugeschoben hat. Aber er ist nicht bei der Sache. Immer wieder schielt sein Blick zu dem Vater hinüber, der einige Tabellen und Konnossemente einer genauen Musterung unterzieht. „Ob er nichts sagen wird? Ob er wartet, bis ich die Sache anschneide?“
„Ich bringe dir dafür wichtige Nachrichten“, rafft er sich schliesslich auf und macht dazu ein ernst besorgtes Gesicht, das ihm selber fremd vorgekommen wäre, wenn er es gesehen hätte. „Freilich, ob sie gerade angenehm sind — —?“
Er merkt, wie der Prokurist, der die erledigten Befrachtungs- und Stapeltabellen wieder an sich genommen und in seine grosse Mappe versenkt hat, ihm einen Wink gibt.
„Auch das weiss der Vater schon?“ fragt er ein wenig enttäuscht und zugleich erleichtert. „Ja, was soll denn nun werden?“
Friedrich Vandekamp antwortet nicht. Der Prokurist sieht die Zeit gekommen, sich zu entfernen. Er weiss, dass die beiden Herren jetzt allein sein wollen.
„Ich wünsche Fräulein Sentland“, sagt Friedrich Vandekamp kurz. Dieser Auftrag berührt Theobald Kernreifs empfindlichste Stelle. Denn er hat es längst gemerkt, dass der Chef und auch der junge Herr, den er in die Obliegenheiten und Geheimnisse des Hauses Vandekamp & Co. seinerzeit mit Gewissenhaftigkeit und ernstem Eifer eingeführt, in wichtigen Angelegenheiten mit der kleinen Sentland, die auch noch als Lehrling unter ihm gearbeitet, lieber verhandeln als mit ihm, dem erprobten und verantwortlichen Vertreter des Hauses.
„Ja, was soll nun werden?“ wiederholt Timm seine Frage, als sie beide allein sind.
Friedrich Vandekamp erledigt eine telephonische Anfrage, beugt sich über die Papiere, die ihm der Prokurist zur Unterfertigung dagelassen.
„Mit Brackmann und Co. soll es mehr als wackelig stehen. Du gabst ihm die Lieferung ausgerechnet vor Toresschluss. Das wäre an sich ja nicht schlimm. Aber dass du ihm eine Vorausbezahlung bis zur Hälfte des Betrages zubilligtest — — —“
Er erwartet eine Antwort, sei sie auch eine Zurechtweisung.
Aber nichts von beiden. Dies verfluchte Schweigen! Diese Harthörigkeit, hinter die sich der Vater jedesmal wie hinter einen undurchbrechbaren Wall verschliesst! Wie oft haben sie ihn, den viel Lebhafteren und Impulsiveren, zur Verzweiflung gebracht!
„Freilich, dass seine Mittel damals schon erschöpft waren, das konntest du nicht wissen.“
Friedrich Vandekamp legt den Riesenbleistift, mit dem er, wenn er disponiert (und er disponiert eigentlich immer) ein paar Aufzeichnungen zu machen pflegt, auf die Schreibtischplatte.
„Wer sagt dir, dass ich es nicht wusste? Im übrigen brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Der Auftrag ist zurückgezogen. Brackmann wird meinen eingeschriebenen Brief heute morgen erhalten haben.“
„Aber die Anzahlung — —?“
„Konnte ich im letzten Augenblick noch zurückrufen.“
„Ja .. aber warum sagtest du das nicht gleich?“
„Weil du mich nicht zu Worte kommen liessest. Aber ich habe mich über die warme Anteilnahme gefreut, die du in diesem Falle meinen geschäftlichen Massnahmen entgegenbrachtest. Es war auch Zeit. In dir steckt ein besserer Kaufmann, als ich bis jetzt vermuten durfte.“
Timm lächelt sein halb überlegenes, halb geschmeicheltes Lächeln. Aber, was der Vater ihm da eben eröffnet, erscheint ihm nicht recht fassbar.
„Und Brackmann — —?“ fragt er schliesslich.
„Wie er sich damit abfindet, ist seine Sache. Im Geschäftsleben ist sich jeder selbst der Nächste. Das geht nun einmal nicht anders. Auch du wirst es lernen.“
Ein junges Mädchen steht in dem Zimmer. Unmerkbar ist es eingetreten. Es weiss, dass es leise kommen und gehen muss, dass das geringste Geräusch den Chef bei der Arbeit stört. Es kennt jede seiner Gepflogenheiten, seine Neigungen und Abneigungen, erfühlt sie mit jener feinsicheren Einpassung des weiblichen Instinktes, dem Gefühl alles, Lernen und Erfahrung nur Zubehilfe sind.
Kein Wunder! Ist es doch als fünfzehnjähriger Lehrling in das grosse Exporthaus eingetreten, vermöge seiner Begabung und Gewissenhaftigkeit bald höher gerückt, Friedrich Vandekamps persönliche, unentbehrliche Sekretärin geworden. Eine schmal, aber kraftvoll gebaute Erscheinung in schmuckem, blau und weiss kariertem Jumper mit freier Stirn unter dichten dunklen Haaren, Augen, deren überlegene Klugheit ihrer Jugend vorausgeeilt ist und denen ein leichter Hauch von mädchenhafter Schwärmerei etwas Eigenes und Anziehendes gibt, unter keck geschwungenen Lippen ein etwas hartgerundetes, energisches Kinn: Söna Sentland.
„Ich möchte diktieren“, sagt Friedrich Vandekamp. „Sie haben alles zur Hand?“
Söna Sentland setzt sich, nimmt Stenogrammheft und Stift, schreibt mit fliegender und sicherer Hand nach Friedrich Vandekamps Diktat.
Da dringen von draussen her die Töne eines leidenschaftlich geführten Zwiegesprächs. Die eine Stimme begehrt Einlass zum Chef, die andere wehrt ab, nachdrücklich und energisch. Aber ohne Erfolg.
Denn schon wird die streng bewahrte Tür mit einem harten Ruck aufgerissen. Ein Mann tritt in das Kontor, an dem alles heiss aufbegehrende Erregung ist: Philipp Brackmann.
„Ich möchte doch sehen, wer mir hier den Eintritt wehren will, wo es für mich um Sein oder Nichtsein geht.“
„Wenn Sie sich in der meinem Personal zur Pflicht gemachten Form hätten anmelden lassen“, erwidert Friedrich Vandekamp, indem er sich von seinem Stuhle erhebt, „wäre Ihnen dieser unliebsame Auftritt, den ich bedaure, erspart geblieben.“
Philipp Brackmann sieht die Hand nicht, die sich ihm entgegenstreckt, er nimmt auch den Stuhl nicht, den ihm Söna Sentland hinschiebt.
„Ich bin gekommen, mir mein Recht zu holen.“
„Von einem Recht kann wohl kaum die Rede sein.“
„Nun, dann von einem schreienden Unrecht, das Sie mir angetan haben, Herr Vandekamp.“
„Ich bitte, setzen Sie sich. Im Stehen verhandele ich nicht gern.“
Philipp Brackmann lässt den schweren Körper in den Sessel gleiten.
„Sie sandten mir heute diesen Brief.“
Er nimmt ein Schreiben aus der Brusttasche, dem man es ansieht, wie manches Mal wohl eine zornentbrannte Hand auf seine Seiten geschlagen, wie es zwischen zitternden Fingern gedrückt und zerknittert wurde.
„Sie kündigen mir eine Lieferung, für die Sie mir eine sichere, wenn nicht gewisse Aussicht gemacht, kündigen Sie mir, nachdem ich alle Vorbereitungen für sie getroffen —“
„Es hat mir sehr leid getan, Herr Brackmann, Ihnen eine so schwere Enttäuschung bereiten zu müssen. Sie können mir glauben, ich habe harte Stunden durchgemacht, bevor ich mich zu diesem Schritte entschloss. Aber er war eine Notwendigkeit, der ich mich nicht entziehen konnte, wenn ich mich nicht ruinieren wollte.“
Man hört es seinen Worten an, dass sie aus einem traurigen Herzen kommen.
Aber dazu ist Philipp Brackmann nicht hergekommen, um sich von dem, das weiss er längst und fühlt es in diesem Augenblick aufs neue, weit überlegenen Vandekamp mit ein paar freundlichen Worten abspeisen zu lassen.
„Ich kann mich mit dieser Erklärung, selbst mit Ihrem Bedauern, nicht abgefunden sehen. Entweder ziehen Sie Ihre Absage zurück und lassen mir die Lieferung —“
„Ich sagte Ihnen, dass es unmöglich ist.“
„So beanspruche ich eine Entschädigung.“
„Eine Entschädigung? Wofür?“
„Für die Arbeiten, die ich habe vornehmen lassen, für die grossen Kosten, die mir aus ihnen entstanden sind.“
„Ich wüsste nicht, welche Arbeiten und welche grossen Kosten das gewesen sein könnten.“
„Wenn ich eine so grosse Lieferung von Eichenrundhölzern und Kiefernschwellen übernehmen und zu einem festen Termin durchführen sollte, so musste ich sie entsprechend vorbereiten. Ich habe mir deshalb beim Grafen Patocki auf Brinczyn einen umfangreichen Waldbestand gesichert und eine Anzahlung auf ihn gemacht, habe vor allem ein lohnendes Angebot auf Lieferung von Exportschnitthölzern abschlagen müssen, weil man auf sofortige Entscheidung drang und ich es unmöglich mit Ihrem Auftrag in Einklang bringen konnte —“
„Bevor Sie dieses Auftrages sicher waren? Bevor Sie einen Vertrag oder irgend etwas Festes in Händen hatten —?“
„Ich meinte, wenn ein Vandekamp mir eine solche Lieferung in Aussicht stellte, dann wäre sie so gut wie getätigt.“
Ein so fester Glaube an Friedrich Vandekamp und seine unfehlbare Sicherheit spricht aus diesen Worten. Der aber hat kein Ohr für sie.
„Es tut mir leid, Herr Brackmann, aber ich verstehe Sie nicht mehr, verstehe nicht, wie ein erfahrener. Kaufmann so wenig überlegt und unvorsichtig handeln konnte. Wie durften Sie so weittragende Verpflichtungen eingehen oder ein für Sie günstiges, sicheres Angebot ausschlagen, wo zwischen uns keinerlei Bindungen, überhaupt nichts Festes vereinbart war und es sich lediglich um eine Aussicht handelte, die ich Ihnen eröffnete?“
Friedrich Vandekamp hat recht gesagt: Er ist an der Grenze seines Verstehens angelangt. Von Jugend an kaufmännisch geschult und eingestellt, nichts im Sinne habend und nichts erstrebend als sein Geschäft, dessen Nutzen und Aufblühen, kann er ein so unkaufmännisches Handeln nicht begreifen, ja, nicht einmal verzeihen.
„Sie werden einsehen, Herr Brackmann, dass Sie nicht den geringsten Anspruch auf eine Entschädigung an mich stellen können.“
Ein jäher Wechsel vollzieht sich in Philipp Brackmanns Zügen: die Zuversicht, die sie bis dahin erfüllt, ist einer Bestürzung gewichen, die zu verbergen, ihm nicht mehr möglich ist. Er erkennt, dass der Mann, der ihm mit einem Male unberührt und jedem seiner Worte unzugänglich gegenübersitzt, mit seiner nachsichtslosen Klarheit, seiner verstandesnüchternen Schlussfolge im Recht ist, dass er sein Spiel verloren hat.
Er ist Alt-Danziger Kaufmann, seine Vorfahren gehörten zu den Patriziern, genau so wie die Vandekamps. Er hat noch nie gebeten, in seinem ganzen Leben nicht. Aber jetzt ... in seiner bis zum äussersten gestiegenen Bedrängnis, in der Not, in die er sich und sein Geschäft durch eine, das kann er sich nicht länger verhehlen, übereilte Handlungsweise gestürzt hat.
„Wenn Sie die Verpflichtung zu einer Entschädigung nicht anerkennen können“, ringt es sich von der stockenden Zunge, „so gewähren Sie sie mir aus freien Stücken, und ich werde Ihnen dankbar sein.“
Sieht Friedrich Vandekamp die hilflose Verlegenheit nicht auf den fahlbleichen Zügen des bitter enttäuschten Mannes? Vernimmt er die mühsam erkämpfte Bitte nicht, die die stammelnden Lippen angsterfüllt ihm entgegentragen?
Nichts von alledem. Philipp Brackmann ist als Kaufmann für ihn gerichtet. Damit ist die Angelegenheit für ihn erledigt.
„Auch dazu kann ich mich nicht verstehen.“
Eine Pause. Nichts hört man als das dumpfe Anschlagen einer Schreibmaschine im Nebenraum, in dem Söna Sentland die Briefe fertigt, die ihr der Chef vorhin diktiert und die bis zur Mittagspost fertig sein müssen, ab und zu auch das Läuten eines Fernrufers oder einen eilenden Schritt über den Flurgang.
Philipp Brackmann sitzt nicht mehr auf seinem Platze. Mit unsicherem Schritt tastet er durch das kleine Kontor, bleibt stehen, wischt mit einem grossen blauseidenen Tuch den Schweiss ab, der ihm in hellen Tropfen von der glühenden Stirn rinnt.
„Also keine Hilfe mehr!“
Unstet, ziellos irrt sein Blick durch den stillen Raum, bleibt auf Friedrich Vandekamps geschäftlich eingestellten Zügen haften, als hoffte er immer noch etwas von ihm. In dessen Gesicht zuckt es wohl auf, er fühlt sich auch nicht mehr so sicher und geborgen in seinem Rechte. Einmal ist es, als wolle er etwas sagen, vielleicht ein Zugeständnis machen, das, und sei es noch so gering, Rettung bringen könnte. — — — Dann aber erhebt sich eine Macht, tritt zwischen ihn und sein besseres Wollen, eine Macht, der Friedrich Vandekamp gedient hat sein Leben lang, der er verfallen ist mit Leib und Seele, die sein Gott geworden ist, ein strenger und unerbittlicher Gott, der keine anderen Götter neben sich duldet ... nein, kein Gott, ein Dämon, der ihn am Gängelbande führt, dem er hörig geworden ist und untertan: das Geld.
„Ich kann nichts für Sie tun, Herr Brackmann“, sagt er nicht ohne eine gewisse Überwindung, aber kurz und unweigerlich, als könnte er gar nicht anders, als gäbe diese Macht das Wort ihm ein.
Nicht von der Stelle rührt sich Philipp Brackmann. Und wiederum nimmt sein Auge die unstete Wanderung auf, irrlichtert hin und her ...
Plötzlich findet es ein Ziel: die junge Männergestalt, die dem Chef gegenübersitzt, Friedrich Vandekamps Sohn Timm.
Und nun richtet es sich mit einer Inbrunst auf ihn, klammert sich an seine Gestalt, sein Antlitz, als müsste von ihm die Hilfe kommen, die letzte, die der Vater ihm versagt. Die Jugend ist ja verständnisvoller, ist auch mitleidiger als das hart und unzugänglich gewordene Alter, hat ein weniger beschwertes Herz. Er hat es manches Mal erfahren, warum sollte es ihm hier versagt sein, wo er seiner am nötigsten bedarf, wo es der letzte Halt sein könnte, ihn aus der Tiefe seiner Not zu retten?
Er hat sich verrechnet. Nichts begegnet dem flehend suchenden Blick als kühle Gleichgültigkeit.
Nicht als ob der da drüben ohne Mitleid oder menschliche Regung wäre. Er ist von Natur aus gutmütig und zum Geben bereit, wahllos oft und ohne Überlegung. Für ihn gibt es die Macht nicht, die hemmend und unwiderstehlich den Vater beherrscht. Gewiss, auch er liebt das Geld. Aber es ist ihm lediglich ein Gegenstand, für den man bessere Werte eintauscht, seinen Freunden Gutes tun und ihnen helfen kann, sein Diener, aber nicht sein Herr. Solche Angelegenheiten aber sind Sache des Vaters, gehen ihn nichts an. Wozu sich mit ihnen beschweren?
So hat ihn diese ganze Unterredung wenig berührt, und er hat nur den einen Wunsch, dass sie bald beendet sein möchte. Denn er hat für den Nachmittag eine Autofahrt und ist schon ungeduldig, dass dies Gespräch so lange sich hinzieht und er sich womöglich verspäten könnte. Denn bevor der Vater gegangen, wagt er nicht recht, das Kontor zu verlassen.
Philipp Brackmann ist endlich zu der Erkenntnis der völligen Zwecklosigkeit seines längeren Bleibens gelangt. Auch diesmal verabschiedet er sich ohne Händedruck.
Nun kommt über Friedrich Vandekamp eine merkbare Unruhe. Er will zu seiner kranken Frau. So lange hat er sie noch nie warten lassen. Die Mittagszeit ist bereits weit überschritten, und er weiss, dass er sie im Schlafe nicht stören darf. Er wirft einen flüchtigen Blick auf die Schreiben, die Söna Sentland ihm vorlegt, fertigt seine Unterschriften, nimmt Hut und Mantel.
Vor dem Hause steht sein Wagen. Er will der vorgeschrittenen Stunde halber diesmal nicht zu Fuss gehen. Aber Timm hat sich den Wagen bestellt. Er will ihm nicht im Wege sein. So nimmt er die Elektrische und findet, dass man auch auf ihr sehr gut fährt.
Wenige Minuten später steigt Timm in sein Auto und fährt in höchster zulässiger Geschwindigkeit der ersehnten Verabredung entgegen.
Das Haus, das sich Friedrich Vandekamp im schönen Langfuhr, dicht am Waldessaum, am Knie einer aufwärts führenden Bergstrasse als Ruhesitz hat bauen lassen, hat seinen Mittelpunkt in einer mit künstlerischen Kostbarkeiten aller Art geschmückten Diele, um die oben herum ein breiter, von einem holzgeschnitzten Geländer eingefasster Gang läuft, in den die einzelnen Schlaf- und Gastzimmer münden.
Eins dieser Zimmer, das geräumigste und sonnigste von allen, mit weit ausladendem, auf bewaldete Hügel schauendem Söller, gehört der Dame des Hauses.
Eine mattblaue Seidentapete mit behutsam gemustertem Untergrund, weisse bauschige Gardinen und sanft geschwungene Möbel neuesten Stiles aus hellgemasertem Ahornholz geben dem Raum das freundlich Heitere, zugleich das mild Beruhigende eines Krankenzimmers. An den Fenstern sind dichte, tiefdunkle Vorhänge angebracht, die auf einen Wink der Herrin jedes Licht abschliessen, denn ihre Stimmung und Neigung wechselt beständig in der Weise, dass sie einmal in den hellen Tag sehen, dann wieder von schweigender Nacht eingehüllt sein will. Ihr Bett ist in die Mitte des Zimmers gestellt; an seiner einen Seite steht ein kleiner Tisch mit Fernsprecher, Läuteapparat, einem Block mit Merkzetteln und gespitzten Bleistiften, auf der anderen ein grösserer mit Gläsern, Arzneien, einigen Zeitschriften und Büchern.
Ein Nachtgewand von olivenfarbener Seide mit eingestickter, sorgsam abgetönter Blumenzeichnung umfliesst die früher zur Fülle neigende, jetzt etwas abgemagerte, aber immer noch wohlgebaute, vornehm-kühle Frauengestalt mit dem gelblich-blassen Gesicht, strenger Stirn und herrischem Kinn.
Schwer und müde öffnen sich die in ihrer Farbe wie in ihrem Ausdruck oft wechselnden Augen, als Friedrich Vandekamp auf Zehenspitzen an ihr Lager tritt.
„Nein, nicht auf den Bettrand, bitte! Du weisst, ich kann es nicht vertragen. Nimm einen Stuhl!“
Er tut, wie sie geheissen. Zagende Besorgnis, liebendes Mitleid umfassen ihre matt ruhende Gestalt.
„Als ich nach Hause kam, liess sich Pfarrer Wendland anmelden. Vielleicht willst du ihn auch noch sehen.“
„Nein, heute nicht. Er kommt ja doch nur Inas wegen.“
„Sie schien nicht allzu erfreut über seinen Besuch.“
„Über wen freut sie sich? Wen hat sie gern? Nicht einmal die Mutter.“
Sie legt sich das Kopfkissen zurecht, scheint eine Weile teilnahmslos.
„Ich muss es verschmerzen“, fährt sie mit nachdenklicher Stimme fort. „Es ist mir mit der eigenen Mutter nicht anders gegangen, wenn auch die Schuld an ihr liegt. Alles wiederholt sich im Leben. Alles vererbt sich. Alles rächt sich.“
Er ist erstaunt über ihre Worte. So hat sie noch niemals gesprochen. Ist es das lange Krankenlager?
„Aber um ihretwillen tut es mir leid. Sie hat nie eine Freundin gehabt, wird nie eine haben. Oft fürchte ich, sie ist einer grossen Liebe gar nicht fähig. Vielleicht haben wir sie, besonders du, zu sehr verwöhnt.“
„Und den Jungen weniger?“
Schon verdriesst es ihn, dass er es gesagt hat. Über diesen Punkt ist mit ihr nicht zu reden, und er hat sich fest vorgenommen, sie nicht aufzuregen.
„Genug. Geh jetzt! Ich muss ausruhen.“
Auf der Diele trifft er mit Pfarrer Wendland zusammen.
„Haben Sie meine Tochter nicht angetroffen?“ fragt er zerstreut.
„Mein Besuch galt Ihnen. Nicht Ihrer Tochter.“
Sofort weiss Friedrich Vandekamp, weshalb er gekommen ist.
„Ich wählte diese Mittagsstunde, weil ich sicher war, Sie jetzt anzutreffen.“
Und als Friedrich Vandekamp ihn in sein Bibliothekszimmer gebeten, in dem er persönliche Besuche zu empfangen pflegt:
„Ich möchte über den Fall Brackmann mit Ihnen sprechen. Der Mann ist heute in heller Verzweiflung von Ihnen in sein Kontor zurückgekehrt.“
„Er steht Ihnen nahe?“
„Er ist meiner Seelsorge anvertraut. Man hat sich an mich gewandt, dass ich ihm zur Seite stehe in seiner Not.“
„Und was soll ich dabei tun?“ fragt Friedrich Vandekamp in der ihm zur Natur gewordenen Geschäftigkeit. Aber ein Schatten fliegt über sein Gesicht. „Ich weiss nicht, ob man Sie in die Angelegenheit, um die es sich handelt, eingeweiht hat. Es ist wohl auch gleich. Denn im letzten Grunde kann sie nur vom kaufmännischen Standpunkt beurteilt werden.“
„Ich bin in diesen Dingen wenig bewandert. Das Kaufmännische liegt mir ganz und gar nicht. Sie mögen in Ihrem Rechte sein, ich bezweifele es nicht. Aber es gibt ein anderes Recht, ein ungeschriebenes, das in unserer eigenen Brust wohnt und von höherer Geltung ist als das geschriebene.“
Friedrich Vandekamp erhebt sich von seinem Stuhle, macht einige Schritte durch das Zimmer, bleibt stehen.
„Ich meine“, fährt der junge Geistliche fort, „im letzten Grunde können Handel und Wandel, können die Gesetze des Geschäftes und Kontors das Entscheidende nicht sein. Sondern die Verpflichtung, die der Mensch gegen den Menschen hat.“
„Und in welcher Weise, meinen Sie, könnte ich dieser Verpflichtung nachkommen?“
„Indem Sie mir helfen, den niedergebrochenen Mann aufzurichten, ihm einen Beruf, ein Lebensziel zu weisen, das ihm wieder Lust und Kraft zur Arbeit gibt.“
„Er hat sein Geschäft.“
„Mit dem ist es zu Ende. Mit der grossen Lieferung, die Sie ihm in Aussicht stellten, hoffte er es noch einmal aufzubauen. Wo nun aber auch diese fehlgeschlagen — und vielleicht nicht ganz ohne Ihre Schuld —“
In Friedrich Vandekamps eisernen Zügen zuckt es auf. Er will widersprechen, will, ganz gegen seine Art, heftig werden. Er unterdrückt das aufwallende Wort. Aber diese Unterredung fängt an, ihn zu peinigen.
„Ich bin bereit, ihm einen Betrag gegen geringe Zinsen vorzuschiessen.“
„Damit ist ihm nicht geholfen. Das Geld, die dringendsten und notwendigsten Verpflichtungen zu erfüllen, hat ihm seine Tochter zur Verfügung gestellt.“
„Seine Tochter?“
Ein grosses Erstaunen ist in Friedrich Vandekamps Frage. ‚Seltsam‘, denkt er, ‚auch einmal eine Tochter, die für ihren Vater eintritt!‘
„Sie hat ihm das Erbteil ihrer Mutter zum Opfer gebracht. Nein, wir müssen andere Wege suchen, müssen ihn irgendwo unterzubringen, ihm eine Stellung zu verschaffen suchen. Denn wenn er jetzt arbeitslos würde, so wäre es sein Untergang. Und schliesslich lebt der Mensch ja nicht vom Brot allein. Aber wenn Sie mir nicht helfen wollen, nicht helfen können, so werde ich andere Wege finden.“
Friedrich Vandekamp kämpft einen harten Kampf.
„Ich werde sehen“, sagt er.
Da läutet der Fernrufer. Er nimmt den Hörer.
„Man fragt, ob Sie noch bei mir sind“, wendet er sich an den Pfarrer, indem er ihm den Hörer hinüberreicht.
Schweigend vernimmt Jürgen Wendland, was ihm durch den Fernrufer verkündet wird. Es ist nur eine kurze Botschaft.
„Es ist zu spät“, sagt er zu Friedrich Vandekamp, indem er den Hörer auf die Gabel legt. „Herr Brackmann hat einen schweren Nervenzusammenbruch erlitten und ist soeben in das Städtische Krankenhaus gebracht worden.“
Nein, ins Kontor will Friedrich Vandekamp heute nicht mehr gehen.
Was der junge Geistliche da zu ihm gesprochen, ist nicht ohne Eindruck auf ihn geblieben.
„Recht hat er“, sagt er zu sich selber. „Nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und wenn ich das Dasein bedenke, das ich so Tag für Tag führe, in dem sich alles um das Verdienen dreht und immer wieder um das Verdienen — — —
Und für wen?“
Er denkt an die Tochter des alten Brackmann, die ihr Letztes für den Vater hingibt.
Wer würde ein Gleiches für ihn tun?
Timm?
Er lebt nur seinem Sport und den Vergnügungen, die er mit sich bringt.
Ina?
Manchmal hat er das Empfinden, als hänge sie an ihm mit einer gewissen Liebe. Aber sie ist viel zu sehr in sich geschlossen und mit sich beschäftigt, um diese in irgendeiner Weise offenbaren zu können.
„Ja ... für wen lebe ich? Für wen placke ich mich vom frühen Morgen bis in die sinkende Nacht?
Und ... wer liebt mich?
Ein Einsamer bin ich ... ein Fremdling im eigenen Hause.“
Mit einer solchen Gewalt kommt dies Empfinden über ihn, dass ein Wunsch, der verborgen in ihm geruht, den er oft genug unterdrückt und der sich doch immer von neuem in ihm geregt, in dieser Stunde zur brennenden Sehnsucht wird: Einmal einem Menschen zu begegnen, der nicht nur von ihm fordert, sondern ihm auch etwas gibt, der ihn lieb hat ... nicht um seines Geldes und seines Verdienens, sondern um seiner selbst willen.
Aber der wird wohl nie kommen ... niemals.
So muss er sich mit dem abfinden, was ihm beschieden.
Und schliesslich gibt es ja auch in diesem Hause noch einen, der ihm zugetan ist. Und ist es auch nur eine alte verkümmerte Frau!
Er wird Frau Sabinchen einen Besuch machen. Er geht immer zu ihr, wenn ihm das Herz so recht voll ist. Ihr ist es eine grosse Freude und für ihn eine Befreiung von allerlei quälenden Gedanken.
Er schreitet einen langen schmalen Gang entlang, der auf einen vom Garten abgezäunten Hof führt, tritt in eine niedrige, aber von der Sonne freundlich durchspielte Stube.
Ein altertümliches Spind mit zwei Glastüren, durch deren eine ein Sprung geht, ein Biedermeiersofa mit hellgrünem, von der Sonne ausgezogenem Seidenüberzug und reichlicher Goldverzierung, zwei hochlehnige, geschnitzte Stühle, ein Prachtstück von antikem Schreibtisch aus hellem Mahagoni ... alles das steht geduckt und gedrückt, manchmal fast bis an die stuckverzierte Decke stossend, ein Zeichen verschwundener Herrlichkeit, die einmal weite, hohe Räume schmückte und sich jetzt ein bisschen missstimmig in diese für so anspruchsvolle und von sich eingenommene Möbel kaum ausersehene Stube einpferchen lässt.
Und wie das für diese Umrahmung geschaffene Bild sitzt in einem mit verschlissener mattrosa Seide bezogenen Sessel eine alte, aber in ihrer Haltung wie in ihren Bewegungen erstaunlich frische Dame: Frau Sabine Wallburg-Werra, Frau Dörthes zweiendachtzigjährige Mutter.
„Schön, dass du kommst!“
Eine Hand mit bläulich schwarzen Tupfen und prall gespannten Adern, aber immer noch die edlen Linien zeigend, streckt sich aus fadenscheinigem, an manchen Stellen geflicktem Ärmel entgegen.
„Ich bringe dir eine Karte für den Ufapalast, Sabinchen.“
Über das Gesicht mit der kreuz und quer durchfurchten Stirn und den grau hervortretenden Backenknochen geht ein Aufleuchten.
„Der Wagen steht um sechs Uhr hier an der Hinterpforte.“
„Damit Frau Vandekamp“ — sie nennt ihre Tochter nie anders — „nur nichts merkt!“
„Damit es sie in ihrer Nachmittagsruhe nicht stört.“
„Stören? So spät? Unsinn! Aber ärgern würde sie es. Sie gönnt mir nichts und ist erbost, dass ich in meinen Jahren noch an Kino und Theater denke. ‚Senile Vergnügungssucht‘ nennt sie es. Alles im Leben, das kannst du mir schon glauben, mein Junge, kommt aus dem Neid ... nur aus dem Neid. Er ist der Beelzebub unter den bösen Geistern.“
Eine energisch abweisende Bewegung antwortet ihr.
„Du weisst, Sabinchen“ — er hat diese für sie wirklich ein wenig komisch klingende Anrede, da sie die Bezeichnung ‚Mutter‘ nicht liebte, früher einmal im Scherz gebraucht und jetzt beibehalten, wie sie ihn nie anders als ‚mein Junge‘ nennt —, „dass ich Verständnis für deine Wünsche und Neigungen habe und gern bemüht bin, dir dein einsames Alter zu versüssen —“
„Ja, du bist der einzige —!“
„Nun gut — wenn du mich nicht auch verlieren willst —“
„Dann hätte ich keinen mehr —“
Wie hilfesuchend greift die gichtische Hand nach der seinen.
„So darfst du über meine Frau in dieser Weise nicht reden, darfst auf sie nicht schelten. Sie ist eine arme kranke Frau — und sie ist deine Tochter.“
„Meine Tochter war sie einmal. Ober handelt eine Tochter so an ihrer Mutter? Verbannt mich aus ihrem Gesichtskreise, steckt mich in dies Mauseloch, wo ihr die besten Zimmer zur Verfügung stehen, auf die ich einen Anspruch hätte wie sie. Hier soll ich glücklich und zufrieden sein und mich christlich auf mein Ende vorbereiten, wie es sich für eine alte Frau geziemt. Besucht mich nicht einmal —“
„Du weisst, dass sie seit Monaten ihr Bett nicht verlassen hat —“
„Aber lässt sie mich zu sich kommen? Hat sie mich ein einziges Mal um meinen Besuch gebeten? Und als ich ihn ihr ankündigte, weil mich die Sehnsucht trieb — jawohl, die Sehnsucht nach meinem Kinde! — was liess sie mir durch ihre Zofe antworten, diese unverschämte Person, die nichts anderes im Sinne hat, als uns völlig auseinanderzutreiben? Meine Gegenwart würde sie aufregen!“
„Hat sie damit unrecht? Du weisst, dass ausser mir und den Kindern niemand zu ihr darf.“
„Die Kinder sind wie die Mutter. Timm kümmert sich überhaupt nicht um mich. Und Ina macht mir alle acht Tage ihren kühl höflichen Besuch. Ich wundere mich nur, dass sie mir den Pastor noch lassen. Aber wer weiss, wie lange noch. Das letztemal war er schon so sonderbar.“
Er kennt den Wahn der alten Frau, die in allen Menschen ihre geschworenen Feinde sieht. Die traurige Lage, in die sie, die einmal in Glanz und Reichtum gelebt und alles zu ihren Füssen gesehen, durch ihre völlige Verarmung gekommen, die Erbstreitigkeiten mit der eigenen Tochter, der heiss erbitterte Kampf, den sie gegen sie zu führen hatte, die darauf folgende kühl gleichgültige Zurückziehung ihrer nächsten Angehörigen, an der sie wegen ihres verbitterten und herrschsüchtigen Wesens den grösseren Teil der Schuld trug, die Nichtachtung einer Dienerschaft, die einmal jeden Winkes ihrer Augen gewärtig war, alles das hat die hochmütige Frau gebrochen — er versteht es und hat Mitleid mit ihr.
„Du darfst mit Dörthe nicht so streng ins Gericht gehen. Es bringt ihr Leiden nun einmal mit sich.“
„Ihr Leiden!“ wiederholt sie geringschätzig. „Sie ist nicht so krank, wie sie und ihr immer tut. Vielleicht bist du kränker als sie.“
Er versteht nicht, was sie mit diesem Wort sagen will. Aber der blinzelnde Blick, der aus den trüben Schleiern ihrer Augen plötzlich mit seltsam zufassender Klarheit hervorbrechen kann, macht ihn stutzig.
„Ich bin gesund —“
„So seid ihr es beide. Und dazu jung. Ich aber bin alt.“
„Das glaubt dir nur, wer deinen Taufschein liest. In deinem Aussehen und Wesen bist du jung, Sabinchen!“
Jeden Tag muss er es ihr bestätigen, dass sie nicht alt ist. Tut er es einmal nicht, so weiss sie mit Sicherheit eine Gelegenheit herbeizuführen, die solch eine Erklärung herausfordert.
„Wenn es wahr ist“, erwidert sie beruhigt und geschmeichelt, „dass der Mensch so alt ist, wie er sich fühlt, kann ich zufrieden sein. Ich weiss, dass ich so bald nicht sterben werde ... nicht sterben will! Und nie ist etwas geschehen, was ich nicht wollte. Niemals! Schon, um Frau Vandekamp zu ärgern, möchte ich leben ... lange ... ewig, wenn es ginge. Zum mindesten so lange wie sie!“
Sie merkt, dass er eine Bewegung auf seinem Stuhl macht, als wolle er sich erheben. Das ist das einzige, was sie in Schach hält, den im geheimen glimmenden und immer wieder hervorbrechenden Groll jedesmal zügelt.
„Meine Mutter wurde neunzig, meine Grossmutter hundert Jahre.“
Auch das erzählt sie täglich und fügt mit unfehlbarer Gewissheit hinzu, dass ihre Grossmutter bis an ihr neunzigstes Jahr jedes neue Buch gelesen, jede neue Theateraufführung besucht, ja, noch ziemlich vollendet Französisch gesprochen habe.
„Nun aber habe ich noch eine Bitte, mein Junge“, bricht sie in einem Tone ab, der plötzlich ganz verändert und von fast schamhafter Verlegenheit ist. „Der alte Kullack, der Joseph, weisst du, der Jahrzehnte hindurch der herrschaftliche Kutscher auf Schloss Werra gewesen ist und der dich auch so manches Mal gefahren, wenn du zu uns kamst, feiert seinen fünfundsiebenzigjährigen Geburtstag. Es geht ihm jetzt schlecht. Ich möchte ihm eine Kleinigkeit schenken. Vielleicht zwanzig Mark. Du streckst sie mir vor, nicht wahr, das tust du? Du sollst sie mir nicht schenken, nein, mein Junge, das sollst du nicht. Du weisst, wenn ich meinen Prozess gewonnen und all das viele Geld in Händen habe —“
Da ist sie wieder bei ihrem Lieblingsgegenstand, und er lächelt, wie er es immer tut, wenn sie auf ihn kommt. Denn er glaubt nicht, dass sie diesen Prozess, der jetzt bereits in der zweiten Instanz läuft, gewinnen wird.
„Ich weiss, Sabinchen, ich werde alles wiederbekommen. Darüber bin ich nicht im mindesten beunruhigt. Aber hat dir Doktor Wolter nicht gesagt, dass den Gründen, aus denen die Gesellschaft dir damals das von deinem Manne eingezahlte Kapital zurückbehalten hat, schwer beizukommen sein wird?“
„Weshalb übernahm er denn den Prozess?“
Er will ihr nicht sagen, dass es aus Rücksicht für ihn und aus Mitleid mit ihr geschah.
„Mein seliger Mann gründete die Gesellschaft. Er war ihr Leiter. Und das ist der Dank. Aber sei ganz ruhig, mein Junge! Ich werde ihn gewinnen. Die Zeiten haben sich geändert. Recht und Gerechtigkeit stehen wieder obenauf im deutschen Vaterland. Da wird man für die berechtigten Ansprüche einer armen alten Frau Verständnis haben und nicht dulden, dass sie übervorteilt und von gewissenlosen Ausbeutern hinters Licht geführt wird.“
Nein, er bekommt es nicht übers Herz, einem so zuversichtlichen Glauben zu widersprechen, den letzten Trost ihr zu rauben.
„Ja — wenn du ihn gewinnst!“
„Dann werde ich noch an demselben Tage aus dem dumpfen Loch hier entfliehen, auf Reisen gehen, in einem grossen vornehmen Hotel wohnen. Und dich lade ich dazu ein. Hast dich ja genug abgeschuftet. Alles nur für dich und für mich.“
Da wird ihre Unterhaltung unterbrochen.
Iduna Karsten, Frau Dörthes langjährige, hager hässliche Zofe, die Todfeindin der Alten, bei der sie einmal als junges Ding auf Werra gedient, erscheint.
Mit fliegendem Atem berichtet sie, dass ihre Herrin mit einem jähen Aufschrei aus kaum gewonnenem Schlaf erwacht sei. Dass der Anfall, der sie vor einigen Tagen bereits einmal erschreckt, sich unter neuen Begleiterscheinungen und heftiger als das erstemal wiederholt habe, dass sie sofort den Arzt angerufen, dass die gnädige Frau aber auch nach dem Pfarrer gefragt habe, dessen Besuch sie noch kurz vor dem Einschlafen entschieden abgelehnt habe, und dass dieser ebenfalls benachrichtigt sei.
Bevor sie zu Ende gesprochen, hat Friedrich Vandekamp das Zimmer verlassen, ist nach oben gestürzt.
Geheimrat Meckbach, der Hausarzt der Familie, wenn auch nicht Frau Dörthes Freund und ohne den geringsten Einfluss auf sie, ist bereits zur Stelle, untersucht die Leidende in seiner gründlich umständlichen Art, gibt auf das genaueste seine Anweisungen und Verordnungen, die Frau Dörthe mit einem matt ungläubigen Lächeln und schon entschlossen, keine von ihnen zu befolgen, entgegennimmt, und empfiehlt sich in dem verlegenen Bewusstsein seiner Überflüssigkeit.
„Herr Pastor Wendland wartet draussen“, meldet Iduna Karsten.
Aber Frau Dörthe schüttelt den Kopf. „Ich kann ihn jetzt nicht haben. Ich fühle mich zu schwach. Der Pinsel von Arzt hat mich um den letzten Rest meiner Zurechnungsfähigkeit gebracht.“
Tief und müde liegen die Augen in den Höhlen; eine leichte Starrheit ist in den bleichen Zügen.
Ein beklemmendes Furchtgefühl steigt in Friedrich Vandekamp auf. Sollte sie den Geistlichen — —?
„Du hattest ihn kommen lassen“, wirft er ein. „Ich würde ihn nicht wieder abweisen. Vielleicht willst du mit ihm allein sein.“
Ein Lächeln huscht über den blassen Mund.
„Nein, so weit sind wir noch nicht. Du kannst ganz ruhig sein.“
Wieder trifft Friedrich Vandekamp auf der Diele mit dem Geistlichen zusammen.
„Vielleicht hätte mir dieser zweite vergebliche Gang in Ihr für mich ein wenig entlegenes Landhaus erspart werden können“, erwidert er mit leicht vernehmbarem Vorwurf, als er hört, dass Frau Dörthe ihn nicht zu empfangen wünsche.
Jürgen Wendland ist noch jung. Aber er ist ein Mann. Er ist gütig und verstehend, rastlos und aufopfernd in seinem Berufe, hilfsbereit gegen jeden, ein Idealist mit einem leichten Hang zur Schwärmerei. Aber er lässt es nicht zu, dass die Reichen und Angesehenen seiner Gemeinde ein grösseres Vorrecht auf ihn zu haben glauben als die Geringen und Armen, für die er sich in erster Reihe berufen fühlt.
Friedrich Vandekamp gefällt sein offenes Wort. Wie er das Mutige und Aufrechte an einem Menschen immer schätzt.
„Es ist nicht meine Schuld, Herr Pfarrer. Sie sind verstehend genug, um mit der Stimmung und den Launen einer schwerkranken Frau nicht allzu streng ins Gericht zu gehen.“
Etwas gütig Verbindliches liegt in seiner Antwort, etwas Entschuldigendes zugleich für seine Frau, die er gegen eine Welt von Widersachern in Schutz genommen hätte.
„Wenn es Ihnen recht ist, lasse ich sofort einen Wagen kommen, der Sie nach Hause fährt, oder wo Sie sonst noch zu tun haben.“
„Ich danke Ihnen. Aber da ich einmal hier bin, möchte ich der alten Dame einen Besuch abstatten und ihr ein bisschen vorlesen. Ich weiss, dass ich ihr damit eine Freude mache. Vorher allerdings hätte ich gern noch ein Wort mit Ihnen gesprochen, Herr Vandekamp.“
„So bitte ich, hier eintreten zu wollen.“
‚Wenn es nur nicht wieder der unselige Fall Brackmann ist!‘ denkt Friedrich Vandekamp, indem er die Tür zu seinem Bibliothekzimmer öffnet.
Nein, es ist nicht der Fall Brackmann. Es ist etwas anderes. Aber auch etwas, das Friedrich Vandekamp heute nicht gelegen kommt.
„Es handelt sich um meine Armen. Wir haben im vergangenen Jahre sehr viel Ausgaben gehabt. Die Not war gross, und wir mussten helfen. Es gilt jetzt, einige Fehlbeträge zu decken. Da wollte ich mich zuerst an Sie wenden.“
Das ist das Seltsame bei Friedrich Vandekamp: er gibt gern und mit vollen Händen, nicht nur seiner Frau und seinen Kindern, sondern auch einer ganzen Anzahl näherer und weiterer Verwandter. Aber für Gaben, die hierüber hinaus in das Gebiet der allgemeinen Wohltätigkeit fallen, fehlen ihm Sinn und Neigung. Wenn er so vielen hilft, tut er nach seiner Meinung genug und braucht nicht für ihm ferner liegende Dinge zu opfern. So scheint der junge Geistliche von der Gabe, die er ihm nach einigem Hin- und Herwägen auf den Tisch legt, wenig befriedigt.
„Von Friedrich Vandekamp hätte ich eine andere Unterstützung erwartet“, sagt er in seiner ruhigen Offenheit.
„Lieber Herr Pfarrer, wenn Sie wüssten, was auf mir ruht —“
„Ich weiss das sehr wohl, Herr Vandekamp, weiss, dass Sie viel geben, manchmal, verzeihen Sie, wohl zuviel. Dies aber ist wichtiger und dringender als alles andere. Denn in einer Zeit wie dieser muss der einzelne und sein Wohlleben zurücktreten gegen das, was wir dem Ganzen schulden. Nur, was wir hier geben, ist Selbstlosigkeit.“
„Gewiss ... gewiss“, erwidert Friedrich Vandekamp, bereits ein wenig zerstreut und mit seinen Angelegenheiten beschäftigt, „aber wenn man so grosse Opfer im engeren Kreise bringen muss —“
„Opfer? Ich bin auch hierin nicht ganz Ihrer Meinung. Wo opfern Sie? Sie kommen Ihren Verpflichtungen nach. Für wen legen Sie sich Entbehrungen auf? Vielleicht wird der Tag für Sie, für uns alle kommen, an dem auch das Letzte von uns gefordert wird. Dann erst wird es sich erweisen, wer der Liebe fähig ist und wer nicht.“
Ohne jeden Predigtton, schlicht und einfach hat er es gesagt. Aber eine mitschwingende Wärme ist in seinen Worten, eine still innere Begeisterung, der man es anhört, dass er, wenn es von ihm gefordert würde, auch das Letzte hinzugeben bereit wäre.
Auf Friedrich Vandekamp bleiben seine Worte nicht ohne Eindruck. Er erwägt wohl, ob er seine Gabe verdoppeln soll. Aber wieder ist es das Geld, das sich zwischen ihn und seinen guten Vorsatz stellt, das Geld, das er jeden Tag aufs neue verdienen muss und von dem sich zu trennen, ihn immer einen Entschluss kostet.
„Wir wollen sehen, Herr Pfarrer ... ein andermal. Heute habe ich noch einige Verpflichtungen, die ich zuerst erfüllen möchte.“
Jürgen Wendland hat der alten Wallburg-Werra vorgelesen und mit unerschütterlicher Geduld ihre Klagen und Vorwürfe über sich ergehen lassen.
Jetzt lässt er sich bei Ina melden, denn sie hat ihm sagen lassen, dass sie ihn noch einen Augenblick zu sprechen wünsche.
„Sie sind schon eine Stunde im Hause?“ empfängt sie ihn. „Und schon zum zweiten Male.“
„Ich kam nicht freiwillig.“
„Ich hörte es. Die Mutter liess Sie bitten. Aber Sie sprachen den Vater. Und der enttäuschte Sie auch.“
Sie weiss, dass er ihr nicht antworten wird.
„Sie dürfen es ihm nicht übelnehmen. Er kann Geld verdienen. Aber er kann es nicht ausgeben. Das ist sein Schicksal, und das tut mir immer so leid.“
Er freut sich ihrer Offenherzigkeit. In dieser Weise ist sie ihm bisher nicht begegnet.
Aber der Widerstand, den er im Geheimen gegen sie hegt und der wohl in der Verschiedenheit, ja, im Gegensatz ihrer Weltanschauung begründet ist, lässt sich auch jetzt nicht zum Schweigen bringen.
„Komisch“, erwidert er, „dass sich im Leben der meisten Menschen immer alles um das Geld dreht. Wenn ich von mir sprechen darf, mich interessiert es wenig. Es ist mir etwas völlig Nebensächliches, das mein Denken und Tun nicht im leisesten berührt.“
„Dann geht es Ihnen wie mir. Und wir haben bei allem Auseinandergehen unserer Ansichten wenigstens hier den einigenden Punkt.“
Er lächelt. „Nur dass Ihnen zu jeder Zeit so viel Geld zur Verfügung gestanden hat, wie Sie nur haben wollten. Da ist es vielleicht keine Kunst, ihm mit vornehmer Herablassung zu begegnen.“
Es kommt schärfer heraus, als es beabsichtigt ist. Aber es liegt einmal nicht in seiner Art, das Wort zu wägen, bevor er es ausspricht, sondern es zu gebrauchen, wie es ihm richtig und gut dünkt.