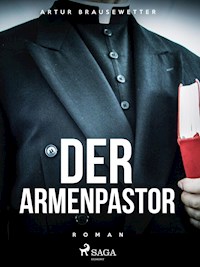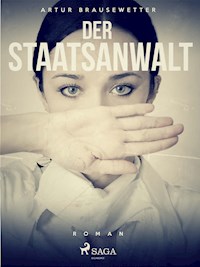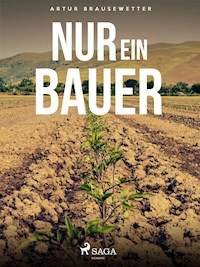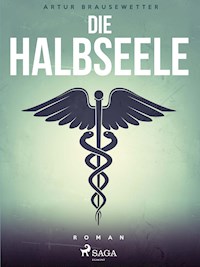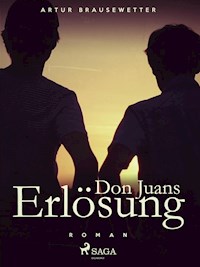Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Justizrat Martin Bernstoff ist eigentlich kein abergläubischer Mensch. Doch eines Tages holt ihn etwas ein, das er eigentlich längst hinter sich gelassen hatte: seine Vergangenheit. Die Hellseherin Fee Varena hat sich in der Stadt niedergelassen und sagt den Leuten mit erschreckender Genauigkeit ihre Zukunft voraus. Auch Martin Bernstoffs Interesse ist geweckt, und als er durch ihre Tür tritt, erkennt er, dass es sich bei der Frau um die ehemalige Liebe seines Lebens handelt. Sofort flammen alte Gefühle wieder auf, und nur die Sterne können sagen, ob die Vergangenheit ruhen oder neu aufflammen wird - und die Sterne lügen nicht.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Brausewetter
Die Sterne lügen nicht
Saga
Die Sterne lügen nichtCoverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 1930, 2020 Artur Brausewetter und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726416350
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Fee Varena!“
Wer war sie? Woher kam sie?
Niemand wusste es. Aber ihr Name war in kurzer Zeit zu leuchtender Höhe gelangt, und die Tatsache, dass sie auf ihrer Triumphreise durch Deutschland auch in die nordische, vom Weltenstrome wie vom übrigen Vaterlande abgeschnittene Hansestadt kommen würde, hatte genügt, die ein wenig nüchternen Leute dort in eine überall spürbare Erwartung zu versetzen.
Langsamen Schrittes, wie jemand, der Eile nicht kennt oder sie für nicht vornehm hält, wanderte Kurt Brüggemann die um die Mittagsstunde stark belebte Langgasse auf und nieder.
Ein anderer, auf den er zu warten schien, gesellte sich zu ihm: ein Fremder, den mancher der Vorübergehenden mit einem fragenden Blicke streifte, wenn er seinen Begleiter mit einer gewissen Ehrerbietung grüsste. Denn trotz seiner jungen Jahre war Kurt Brüggemann in dem mit Titeln gerade nicht sparsam oder engherzig waltenden Freistaate bereits zum „Staatsrat“ emporgerückt und hatte es in seiner Stellung zu Einfluss und Ansehen gebracht. Und dass ein Fremder an seiner Seite einige Aufmerksamkeit erregte, war bei dem trotz ihrer Grösse doch etwas kleinbürgerlich gebliebenen Charakter der alten Hansestadt kein Wunder.
„Fee Varena, die Sibylle von Cumä, kommt und empfängt im Hotel Exzelsior nach vorheriger Anmeldung“ gleisste und protzte es mit grossen, hellgrünen Buchstaben auf rosafarbenem Papier von allen Anschlagsäulen, an denen die beiden vorübergingen und vor denen jedesmal eine Anzahl von Menschen stand, die Ankündigung eifrig lesend und ihre Vermutungen austauschend.
„Lächerlich!“ sagte Kurt Brüggemann in seiner kühlen, kurzen Art.
„Was findest du lächerlich?“
„Das Aufheben, das man von solch einer Fran macht.“
„Man erzählt Unglaubliches von ihr. Auf meiner ganzen Reise hierher, in den Abteilen wie in den Gasthäusern hörte ich ihren Namen. Sie hat bekannten Männern ihr Schicksal vorausgesagt, und es hat sich erfüllt . . . manchmal wortgetreu, wie sie es verkündet hatte.“
„Aber die Menschen sind lächerlich, die sie wie ein Wunder anstaunen und scharenweise zu ihr laufen.“
„Okkultismus und Hellseherei stehen heute in Blüte.“
„Für mich sind sie ein unbekanntes Land, in das ich mich nicht gern begebe,“ mehrte Kurt Brüggemann ab.
„Sage das nicht. Sie sind, möchte ich vielmehr meinen, wissenschaftlich geworden. Ich kenne Menschen, sehr vernünftige und gescheite, die ihr ganzes Leben nach dem ihnen gestellten Horoskop einrichten. Mein verstorbener Vater verpflichtete keinen Beamten, keine Stenotypistin, deren Horoskop er nicht erforscht hatte. Er entliess seinen besten Bureauvorsteher, weil etwas in dessen Horoskop nicht in Ordnung war. Er sagte die Stunde seines Todes voraus — und sie traf auf die Minute ein.“
„Und du?“
„Mir wurde mein Horoskop selbstverständlich auch gestellt. Ich habe es nie beachtet. Ich weiss nur, dass ich unter dem Widder geboren bin.“
„Dazu bedürfte es für mich keines Horoskopes,“ erwiderte Kurt Brüggemann scherzend. „Unter welchem Zeichen solltest du sonst geboren sein? Du mit deinem grosszügigen Wagemut und deiner dramatischen Natur!“
„Dramatische Natur? Was verstehst du darunter, wenn ich fragen darf?“
„Nun . . . der Handeln alles ist.“
„Sehr schmeichelhaft, dass du es bei mir voraussetzest. Man sagte mir damals aber, dass dies Sternbild auch den Verbrecher hervorbringe.“
„Warum nicht auch den Verbrecher?“ erwiderte Kurt Brüggemann immer noch in demselben leicht ironischen Ton. „Die Widdergeborenen erschöpfen sich eben nie in flacher. Mittelmässigkeit. Haben sie nicht die Gabe, nach oben zu steigen, so sinken sie nach unten. Himmel oder Hölle . . . etwas anderes gibt es nicht für sie.“
„Oder, wenn ich eine ,dramatische Naturʻ sein soll, wie du es so schön ausdrücktest — vielleicht ein Handeln, das nie befriedigt, das rastlos weitertreibt, ohne Weg und Ziel,“ entgegnete der andere, und ein nachdenklicher Ernst überschattete sein Antlitz.
„Weg und Ziel wirst du schon finden. Darum ist mir nicht bange . . . Aber hier kommen wir nun wirklich nicht weiter.“
Sie waren am Ende der Langgasse angelangt, da, wo sie auf den langen Markt mündet und der wundervolle Bau des alten Rathauses sich erhebt. Stolz und schlank wie eine goldene Nadel griff der Rathausturm in den blauen, mit dünnen weissen Wolken besäten Winterhimmel. An der Freitreppe des unteren Baues aber fuhr Wagen auf Wagen vor. Festlich gekleidete Damen und Herren bestiegen sie, tauschten ein Wort mit den Zurückbleibenden, glitten lautlos von dannen.
Auf dem Langen Markt staute sich die Menge der Wagen. Weitere wälzten sich vom Hohen Tore heran. Der diensttuende Beamte erhob den Stab, winkte mit ihm den Fussgängern, gab ihnen die Bahn über den Markt frei.
An dem Portal harrte noch ein Wagen. Ein älterer Herr und eine junge Dame bestiegen ihn, verabschiedeten sich von mehreren Herren, die sie ehrfurchtsvoll die Freitreppe hinuntergeleitet hatten.
„Was geht denn heute hier vor?“ fragte Kurt Brüggemann den Schupobeamten.
„Die Einführung des Herru Justizrats Bernstoff in sein Amt als Vorsteher der Stadtbürgerschaft,“ antwortete dieser prompt, das scharfe Auge immer auf die ihm obliegende, nicht leichte Verkehrsregelung gerichtet.
„Richtig . . . ich hatte es ganz vergessen.“
In derselben Sekunde glitt der Wagen an ihnen vorüber. Der Beamte grüsste, und Arnim Bieler, um den Fremden jetzt bei seinem Namen zu nennen, sah, dass auch sein Freund tiefer, als es sonst seine Art war, den Hut zog.
„Wer war der Herr, den du eben grüsstest?“
„Justizrat Bernstoff.“
„Das war der Bernstoff?“ gab jener voller Erstaunen zurück. „Den muss ich sehen!“
Er hatte sich von seinem Begleiter losgemacht, war noch einmal in die Mitte des Marktes zurückgeeilt. Aber der Schupobeamte hatte dem Wagen bereits die Bahn freigegeben. Nur in der Ferne sah er ihn noch in der Reihe der anderen sich in rascher Fahrt fortbewegen.
„Schade, dass du es nicht gleich gesagt hast!“ meinte er, sich wieder zu dem Freunde wendend.
„Ich konnte unmöglich ahnen, dass du ein besonderes Interesse an dem Manne nehmen würdest,“ erwiderte Kurt Brüggemann. „Oder war es vielleicht die schöne junge Dame, die dein Blut in Wallang brachte?“
„Wer war sie?“
„Seine Tochter.“
„Nein, nein. Er war es. Er ganz allein.“
„Gewiss. Der grosse Bernstoff interessiert alle.“
„Den ,grossen Bernstoff‘ nennst du ihn?“
„Man nennt ihn allgemein so. Denn er beherrscht den ganzen Freistaat. Obwohl er nur Rechtsanwalt ist, soll er sich höher eingesteuert haben als unsere ersten Börsenmänner. Du hattest bisher noch nicht von ihm gehört?“
„Ob ich von ihm gehört habe! Seit meiner Kindheit. Er stand meinem verstorbenen Vater sehr nahe. Ja, er ist die eigentliche Ursache, die mich gerade diese Stadt zu meiner künftigen Wirkungsstätte wählen liess.“
„Davon hast du mir noch nie etwas gesagt. Auch in deinen Briefen schriebest du nie davon.“
„Ich werde dir später alles erzählen. Erst muss ich selber ein wenig klarer sehen.“
„Mit einer Empfehlung von ihm wird es dir nirgends fehlen. Er hat überall seine Verbindungen. Und nachdem man ihn jetzt noch zum Vorsteher der Stadtbürgerschaft gewählt hat —“
„Ich besinne mich nur dunkel auf ihn. Denn ich war noch auf der Schule, als mein Vater starb und er gleich darauf von uns ging.“
„Niemand weiss etwas von seiner Vergangenheit, und er selber spricht nie darüber.“
Arnim Bieler entgegnete nichts mehr. Schweigend schritt er an der Seite des Freundes, als sie jetzt, den Langen Markt hinunter, an das Wasser gekommen waren, das hier, ein toter Abzweig des Stromes, müde und nur von einigen kleineren Dampfern und Fisch- oder Obstkähnen belebt, die Stadt durchquerte.
„Niemand weiss etwas von seiner Vergangenheit, und er selber spricht nie davon,“ arbeiten die Gedanken in ihm fort, waren nicht mehr zur Ruhe zu bringen.
Bald nach dem Tode des Vaters, mit dem er die Praxis gemeinsam betrieben, hatte Martin Bernstoff diese aufgelöst und sich aus der Heimat entfernt. Lange hatte man nichts von ihm gehört. Dann erstrahlte plötzlich hell sein Stern am Himmel einer fernen Stadt. Die Mutter sprach oft und mit der grössten Bewunderung von ihm. Einmal tauschten sie wohl auch einen Brief. Dann blieb alles still zwischen ihnen.
Und nun hatte dieses Gespräch es wieder lebendig gemacht.
Nein, er mochte Kurt Brüggemann nicht fragen. Eine unbestimmbare Scheu hielt ihn zurück.
Dann tat er es doch.
„Du kennst den Justizrat Bernstoff nicht genauer?“ legte er die Sonde vorsichtig an.
„Recht genau. Ich verkehre viel und gern in seinem Hause. Er hat eine feine Frau und eine bildhübsche Tochter, die er ausserordentlich verwöhnt. Aber sie ist sein einziges Kind, und da ist es bei einem so reichen Manne vielleicht verzeihlich.“
„Und was man von ihm erzählt?“
„Ich habe nie etwas gehört,“ erwiderte Kurt Brüggemann mit ablehnender Bestimmtheit. „Aber es ist eine alte Tatsache, dass Klatsch und Gerüchte sich gern mit Menschen beschäftigen, die die anderen überragen. Das kann niemand ertragen. Aber der Bernstoff steht viel zu hoch, als dass es an ihn heran könnte.“
Er sagte nichts weiter. Es war für seine Verhältnisse schon viel gewesen.
Auch Arnim Bieler versank wieder in Schweigen. Aber sein Verlangen, diesem Manne von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten zu können, war nur um so stärker geworden.
Sie waren in den Ratskeller getreten, um dort vor dem Essen noch ein Glas Wein am Stammtisch zu trinken.
In den gewölbten Räumen mit seinen wunderbaren, von elektrischen Glühlampen matt erhellten Bögen, seinen geheimnisvoll dämmernden, ins Ungewisse sich verlierenden Gängen war es um diese Stunde leer.
Nur ein Herr sass an dem schweren Eichentische in lauschiger Nische bei einer Flasche Burgunder.
„Ah, sieh da . . . der Herr Feuilletonchef unserer ,Neuesten!‘“ begrüsste ihn Arnim Bieler, der ihn erst gestern hier am Stammtisch kennengelernt, aber sich nach seiner Art gleich auf einen vertraut scherzenden Ton mit ihm eingestellt hatte. „Aber Euer Gnaden sehen heute gar nicht gnädig aus.“
„Ich komme von der Varena,“ sagte Fredi Eisenbart an Stelle jeder Erwiderung.
„Von der Sphinx von Cumä? Erzählen Sie!“
„Es ist nicht viel zu erzählen. Man liess mich nicht vor.“
„Liess Sie nicht vor?“ fragte Arnim Bieler mit dem Ausdruck eines lebhaften, zugleich spöttischen Bedauerns. „Wie konnte das geschehen?“
„Man hat Grössere nicht vorgelassen. Justizrat Bernstoff soll zweimal an ihrem Hotel vorgefahren sein, und beide Male wies man ihn ab.“
Sie hatten sich wiedergesetzt. Das Gespräch war bald im Gange, kehrte aber von allen politischen oder wirtschaftlichen Fragen wie von ungefähr stets zu der rätselhaften Hellseherin zurück.
Ein ausgesprochener Gegensatz bestand zwischen den beiden Männern, die sich Freunde nannten: Kurt Brüggemann, sorgsam und gewählt in der Kleidung, die er nie anders als dunkel trug, karg und gemessen im Worte, das, ruhig wägend, stets das richtige traf. Arnim Bieler, der einen flottgeschnittenen gelblichbraunen Jackettanzug anhatte, sprunghaft und impulsiv im Wesen, unbekümmert sprudelnd in leichtfliessender Beredsamkeit, die etwas Fesselndes hatte, eine stetig wechselnde Natur, von der man nie wusste, wie man mit ihr daran war, weil sie etwas füglich Unbestimmbares hatte.
„Vielleicht war es Berechnung, dass man Sie nicht vorliess,“ wandte er sich wieder zu dem Journalisten, den er eine ganze Weile kaum beachtet hatte. „Die Wirklichkeit hätte Sie enttäuscht.“
„Das glaube ich kaum. Sie soll ebenso schön wie eigenartig sein.“
„Aber doch schon eine etwas reifere Schönheit.“
„Nach den Erkundigungen, die ich eingezogen, kann sie höchstens Ende der Zwanziger sein. Ein für solche Berühmtheit recht jugendliches Alter.“
„Hier am Stammtisch erzählte man gestern, sie käme vom Brettl.“
„Stimmt. Sie ist früher auf kleinen Bühnen aufgetreten. Bis sie ihre Gabe entdeckte.“
„Hm . . . ihre Gabe! Es hört sich so grossartig an und ist meistens wenig dahinter.“
„Bei ihr doch. Sie hat eine ganz eigene Art. Zuerst überfliegt sie das Horoskop, das sie nicht selber stellt. Dann verkündet sie aus freier Eingebung . . . im Trancezustand. Es soll fabelhaft sein, was sie da sagt.“
„Sagen kann man schliesslich alles.“
„Aber es soll auch eintreffen —“
Mitten im Worte brach er ab.
Eine Dame trat in den Ratskeller, liess sich in der gegenüberliegenden Nische nieder, gab mit gedämpfter Stimme ihre Aufträge. Der biegsame Wuchs erschien von weicher, fast knochenloser Schlankheit, der ausdrucksvolle Kopf zeigte ein Antlitz von schwermütiger Grazie, und in den grossen dunklen Augen träumte ein still in sich gekehrter Sinn.
„Die Varena!“ rief Fredi Eisenbart halblaut zu den beiden hinüber. „Ich werde sie anreden. Hier wird sie mir nicht entgehen.“
„Ich fürchte, Sie würden keinen guten Empfang haben!“ erwiderte Arnim Bieler mit kühler Ironie, zugleich aber ein wenig zerstreut. Denn sein Auge war nur auf die Fremde gerichtet.
„In der Tat . . . eine Erscheinung, die einen so leicht nicht loslässt!“ wandte er sich zu seinem Freunde, der die ganze Zeit stumm bei seiner halben Flasche Rotwein gesessen, jetzt aber mit erwachter Teilnahme auf die Dame blickte, die den Lederhandschuh abgestreift hatte und eine schlanke, nervöse Hand zeigte, an der alles sprach und lebte. „Wenn ich nicht gegen diese Dinge gefeit wäre, gerade weil mein Vater auf sie schwur, so würde ich sagen: Man merkt ihr das Hellseherische an.“
Und dann mit plötzlichem Entschlusse:
„Ich werde sie morgen besuchen! Und du wirst mich begleiten, sei es auch nur des Scherzes halber.“
„Das werde ich nicht tun,“ erwiderte Kurt Brüggemann in seiner ruhigen Art.
„Weshalb nicht? Fürchtest du dich? Oder trägst du Sorge für deine Seele, der die verführerische Frau gefährlich werden könnte?“
Aber der andere ging auf der Scherz nicht ein.
„Ich fürchte weder für mich, noch für meine Seele,“ entgegnete er ganz ernsthaft. „Aber ich habe diesen Dingen gegenüber stets eine abwartende Stellung eingenommen und gedenke es auch fernerhin zu tun.“
„Also doch etwas wie Furcht?“
„Nenne es wie du willst. Ich denke wie Hamlet, dass es am Ende mehr Dinge im Himmel und auf Erden gibt, als unsere Schulweisheit sich träumt. Schliesslich sagt einem solche Frau etwas, das einen nachher doch quält oder wenigstens beunruhigt. Und wozu? Das Leben ist so schon genug voller Rätsel, dass man ihm nicht neue hinzuzufügen braucht. Allein mit einer gewissen Nüchternheit, die über den Dingen steht, kann man ihm beikommen.“
„Das wird wohl nur Menschen ohne Phantasie möglich sein,“ warf Fredi Eisenbart ein, nicht ohne eine gewisse Spitze, weil der kühl wägende Staatsrat ihm von vorneherein wenig sympathisch war und er es nicht vertragen konnte, auf längere Zeit von der Unterhaltung ausgeschlossen zu sein.
„Auf jeden Fall ist die Phantasie ein zweischneidiges Schwert,“ erwiderte Kurt Brüggemann, durch die Verstimmung des andern nicht im geringsten berührt. „Sie mag das Leben in gewisser Hinsicht verschönen. Aber sie vermischt seine Richtlinien. Und das kann es schwer vertragen. Diesen mystischen Dingen wie Hellseherei, Telepathie und Spiritismus bin ich stets mit Vorsicht begegnet. Ich glaube nicht an sie. Aber ich verwerfe sie auch nicht. ,Wir wandeln alle in Geheimnissen‘, meint einmal Goethe, ,und sind von einer Atmosphäre eingeschlossen, von der wir noch gar nicht wissen, was alles sich in ihr regt und wie es mit unserm Geiste in Verbindung steht.ʻ Deshalb mache ich es wie er: ich hüte mich vor diesen Dingen und lasse sie parallel an mir vorüberlaufen.“
„Ich aber meine,“ warf Arnim Bieler mit emporsprudelnder Energie ein, „es gibt etwas, das stärker ist als alles dies. Das ist der Wille, der sich schliesslich auch das Schicksal, untertan macht! Manneswille quantum satis! Das ist die Losung, nach der ich stets gelebt habe und, aller Hellseherei und allen Vorbedeutungen zum Trotz, weiterleben werde.“
Er hatte es mit der ganzen Zuversicht seiner ausgeprägt männlichen Natur gesprochen, vielleicht etwas lauter, als er es bisher getan.
Denn die Fremde drüben streifte ihn mit einem kurzen Blick, der fast ein wenig spöttisch zwischen den dichtseidenen Wimpern hervorblitzte, beglich ihre Rechnung und ging.
Weich und lautlos war ihr Gang; etwas Schwebendes war in ihm; zugleich das Bewusstsein der Frau, die sich beobachtet weiss, aber zu klug ist, es merken zu lassen.
„Auf Wiedersehen, meine Gnädigste,“ rief Arnim Bieler, sowie sie die Tür geschlossen hatte, in übermütigem Scherze ihr nach. „Morgen also werden wir sehen, wer der Stärkere ist: Ihre Hellseherei, an der ich keinen Augenblick zweifele, denn Sie haben das Zeug dazu. Oder mein Wille, an dem ich noch weniger zweifele!“
* * *
In Fee Varenas Empfangszimmer im Hotel Exzelsior trat Arnim Bieler.
Es sassen bereits einige Leute dort. Als er ihre gespannten Gesichter und ihre nervöse Unruhe sah, konnte er ein Lächeln nicht unterdrücken.
Für ihn war diese ganze Angelegenheit nichts als ein übermütiger Scherz, ein mutwilliges Abenteuer, wie er solche von jeher geliebt und überall gesucht hatte.
„Herr Bieler?“ fragte das niedliche Mädchen, dessen frisch-keckes Wesen nicht die leiseste Spur des Überirdischen oder Geheimnisvollen an sich hatte. „Wir haben Ihre Anmeldung heute morgen erhalten. Aber nicht Ihr Horoskop. Fräulein Varena empfängt jedoch niemanden, in dessen Horoskop sie nicht vorher Einblick genommen hat. Deshalb können Sie erst morgen vorgelassen werden, vorausgesetzt, dass Sie heute noch Ihr Horoskop einsenden.“
„Das kann sofort geschehen, holde Egeria! Und zu welcher Stunde befehlen Sie mich für morgen?“
„Wenn Sie nicht warten wollen, erst des Nachmittags, vielleicht um vier Uhr. Es sind zwei Herrschaften vornotiert. Fräulein Varena macht zwischen den einzelnen Sitzungen grössere Pausen, weil sie sonst zu anstrengend sein würden. Nach Ihnen wird nur noch ein Herr empfangen.“
„Justizrat Bernstoff!“ entglitt es unwillkürlich seinen Lippen.
„Ich bin nicht befugt, über die einzelnen Herrschaften irgendwelche Auskunft zu erteilen.“
„Gut, schöne Schweigerin! Ich werde Punkt vier Uhr zur Stelle sein!“
* * *
Draussen fällt Februarschnee, fällt dicht, unaufhaltsam liegt wie eine schwere weiche Decke auf den Dächern der Stadt. Mit tastenden Händen gleiten die letzten Lichter der müde in fahlgelbem Nebelmeer versinkenden Sonne über sie dahin, senden den blassbläulichen Widerschein in das grosse, mit vornehmer Behaglichkeit ausgestattete Zimmer des Hotels Exzelsior, hüllen es in schnell zunehmende Dämmerung, aus der die bunten Kelims eigentümlich hervorleuchten.
Als Arnim Bieler eintritt, sieht er zunächst gar nichts. Dann gewahrt er eine Frauengestalt, die in einem bis an den Hals geschlossenen, mit leichter Goldstickerei versehenen Seidenkleid auf einem hochlehnigen Sessel nicht weit vom Fenster sitzt.
Der Ausdruck ihres bleichen, mit ruhiger Regelmässigkeit gezeichneten Gesichtes ist von einem fast feierlichen Ernst, die grossen dunklen Augen ganz in sich gekehrt, so dass sie den Eintretenden kaum zu sehen scheint. In den Händen hält sie das Horoskop, liest in ihm mit langsam sich bewegenden Lippen.
Um Arnim Bielers Mund zuckt ein halb skeptisches, halb erwartungsvolles Lächeln.
„Ist das nun Theater?“ denkt er bei sich. „Oder befindet sie sich wirklich in einem Zustande, der sie von der Welt des Sichtbaren absondert?“
Die bläuliche Winterdämmerung von den Schneedächern drüben ist im Erblassen. Ein letztes müdes Licht tastet über die Gegenstände.
Mit einer kurzen Verbeugung und einer Miene, durch die Leichte Ironie schimmert, ist er an den Sessel herangetreten.
Sie regt sich nicht. Etwas Monumentales ist in ihr.
Tiefe Stille ist ringsumher, kein Laut hörbar, nichts als das Ticken einer Uhr vom Wandgesims, das auch etwas Traumhaftes und Verlorenes hat.
Jetzt streckt sie ihre Hand nach der seinen aus . . . langsam, traumhaft. Dann heften sich ihre Augen auf die Linien der Innenfläche, liest in ihnen . . . eine ganz Zeit. Höchste Spannung ist in ihrem Antlitz und völlige Versunkenheit.
Mit einem Male öffnen sich die bis dahin streng geschlossenen Lippen . . . beginnen zu sprechen. Wie aus weiter Ferne scheinen ihre Worte zu kommen. Aus einer Welt, die mit dieser nichts mehr gemein hat.
„Helle Blüte sehe ich . . . ein Mädchen nordisch und blond . . . liebendes Glück reicht es aus kristallener Schale . . . hoch geht die Bahn . . . den Sternen entgegen . . . Und wieder eine Frau . . . blond und stolz . . . steil fällt die Bahn. Dem Abgrunde zu . . . mutwillig zertreten das blühende Glück . . . es sinkt in Trümmer . . . neu wird es erbaut mit starker Hand —“
Ein jäher Ruck durch den ganzen Körper. Als hätte man sie mit harter Hand geweckt. Das Horoskop entgleitet ihr und fällt zu Boden. Die Glieder lösen sich aus ihrer Erstarrung. Langsam kehrt Leben und Leuchten in die schwarzen Augen zurück.
Sie erhebt sich, spricht ein verbindlich entlassendes Wort. Das Lächeln auf Arnim Bielers Lippen ist erstorben.
„Und das war alles, was Sie mir zu sagen hatten?“ versucht er zu scherzen.
„Ich habe es nicht aus mir,“ unterbricht sie ihn. „Eswaren die Ergebnisse Ihrer Konstellation, die auf mich eindrangen. Und die Sterne lügen nicht — Sie werden es erfahren.“
* * *
Eine halbe Stunde später, nachdem Arnim Bieler das Hotel Exzelsior verlassen, fuhr ein Wagen auf die Rampe.
Der Begleiter sprang von seinem Sitze, aber der Portier war ihm bereits zuvorgekommen, öffnete in eigener Person den Schlag und machte dem aussteigenden Herrn die tiefste Reverenz, über die er verfügte.
Der lüftete flüchtig den hohen Hut. „Zur Varena!“ sagte er lässig.
„Gnädige Frau haben auf das strengste angeordnet, niemand vorzulassen. Aber der Herr Justizrat —“
Er winkte dem Liftboy, und der Fahrstuhl bewegte sich aufwärts.
Das Mädchen überreichte ihrer Herrin die Besuchskarte.
„Martin Bernstoff, Rechtsanwalt und Notar“ stand darauf.
„Der Herr war schon mehrere Male hier und ist für heute abend um sechs Uhr angemeldet.“
„Ich bin zu einer neuen Sitzung unfähig. Aber ich werde ihn empfangen und eine passendere Stunde mit ihm vereinbaren.“
Kaum war Martin Bernstoff durch die weitgeöffnete Tür getreten, kaum hatte sich Fee Varena von ihrem Armsessel erhoben, um ihrem Besucher einige Schritte entgegenzugehen, als sie wie festgewurzelt stehenblieb.
„Max Güldner —!“
Es war ein unterdrückter Aufschrei, leise und doch vernehmbar genug, dass er ihn stutzig machte.
Und nun sah er sie. Aber nein . . . nicht sie sah er, nicht das grenzenlose Erstaunen in dem blassen Antlitz, auch nicht ihre schöne, reiferblühte Gestalt in dem goldbesetzten Kleide — auf einen breiten Reif von mattem Gold an ihrem linken Arm heftete sich sein erschreckter Blick. Ein kostbarer indischer Saphir befand sich in seiner Mitte. Seine Färbung war wie dunkles Samtblau, und ein gesättigter Glanz ging von ihm aus.
Sie wollte etwas sagen. Aber ob es die anstrengenden Sitzungen, die sie heute abgehalten und die sie stets mitnahmen, ob es dies unvermutete Zusammentreffen verschuldet hatte — die mühsam aufgeraffte Kraft verliess sie. Die Hände hoben sich ein wenig, als suchten sie irgendwo eine Stütze, griffen ins Leere, sanken müde und schwer am Körper nieder — —
Aber schon war er hinzugesprungen, hatte sie mit kräftigem Arm umspannt und zu einem Sofa geführt.
„Meine arme, kleine Fee!“
Ein inniges Mitleid und eine tiefe Liebe sprachen aus den wenigen Worten, drangen weich und warm zu ihr hinüber.
„So müssen wir uns wiederfinden!“
Die Zeit ging dahin. Das Mädchen, das bereits einmal die Tür geöffnet, aber lautlos wieder geschlossen hatte, fragte, ob sie den Tee bereiten dürfte, musste sich aber, wiederum ohne eine Antwort erhalten zu haben, in das Vorzimmer zurückziehen. Die Uhr auf dem Gesimse pendelte ihr schläfriges Tick-Tack, ab und zu drang das Surren der Elektrischen oder die Hupe eines vorüberfahrenden Autos von der Strasse hinauf.
„Ich wollte die berühmte Seherin befragen — und finde nach soviel langen Jahren . . . nein, es ist gar nicht möglich!“
„Du wolltest die Seherin befragen?!“ wiederholte sie mechanisch, immer noch nach den Worten tastend. Und dann zu einem Scherze sich aufraffend: „Sieh, sieh . . . der grosse Max Güldner war doch früher über solchen Glauben hoch erhaben.“
„Ich werde dir etwas sagen,“ erwiderte er ernst. „Wenn man durchgemacht hat, was ich durchgemacht habe, seitdem ich damals von dir ging, dann bekommt man einen gewissen Glauben. Und wenn es auch nur ein Aberglaube ist. Oder der Glaube an seinen Stern.“
Sie war der Wirklichkeit zurückgegeben.
„Seitdem du damals von mir gingst!“ wiederholte sie, vor sich hinflüsternd, und um ihre Lippen zuckte es in verhaltenem Schmerz.
„Ja, als ich dich verliess, weil mir keine andere Wahl mehr blieb.“
„Keine andere Wahl?“
Weit und gross waren ihre Augen auf ihn gerichtet.
„Wenn du wüsstest, was geschehen! Doch du wirst es nie erfahren . . . nein, niemals!“
Als hätte sie gar nicht gehört, was er gesprochen, fuhr sie fort: „Damals, als du mich im Kolosseum als Gehilfin Scharma Natschiketas, des indischen Fakirs, kennenlerntest — du hattest mir gerade den Armreif geschenkt —“
,,Den Armreif!“ murmelte er vor sich hin, und wieder hing sein Auge wie fest gebannt an dem samtblauen Saphir.
„Ich war ausser mir vor Freude. Den ganzen Abend hätte ich dir dankbar zu Füssen liegen mögen! Du drangst in mich, sofort die Stadt zu verlassen. In einem Nachbarort sollte ich auf dich warten. Ich tat nach deinem Geheiss. Du aber kamst nie wieder —“
Er wandte sich ab, als wollte er die Bewegung verbergen, die in ihm war.
„Dass du es tatest . . . es über das Herz bekamst! Ich habe es nie verstanden. Wie entwurzelt kam ich mir seit jenem Abend vor. Hätte ich nicht den Reif gehabt —!“
Erschöpft hielt sie inne. Erst nach einer längeren Pause fuhr sie fort: „Von dem Fakir hörte ich nichts mehr. Seit er dir den Armreif gelassen, wohl in seiner grössten Not, sonst hätte er es nie getan, war es mit seiner Kunst und Kraft vorbei. Man erzählte mir später, er wäre irgendwo im Elend gestorben —“
„Nein, er lebt!“
Aber kaum hatte er es gesagt, da gereute ihn sein Wort, so entsetzt sah sie ihn an.
„Er lebt?! Dann wird er kommen, den Reif von mir zu fordern. Ja, das wird er tun!“
„Was wurde nun aus dir? Erzähle weiter!“ drang er in sie.
„Was ist da viel zu erzählen? Ich verliess die Bühne, begab mich zu einem berühmten Astrologen in die Lehre, bildete die in mir von jeher schlummernden Gaben aus, reiste durch alle grossen Städte, fand einen ungeheuren Zulauf — und das übrige . . . nun, du siehst es ja.“
„Ja . . . ich sehe es!“ wiederholte er zerstreut und mit einem Klange von Wehmut.
„Aber vielleicht lag es gar nicht an mir, auch nicht an meinen Gaben, sondern an dem Armreif, der schon dem Fakir ein nie versagender Talisman gewesen.“
Er verstand nicht recht, was sie mit diesen Worten sagen wollte, war auch nicht mehr bei der Sache. Vergangene Zeiten standen auf, ferne, schöne, schnellverwehte Zeiten. Er sah sie vor sich als blühendes, kaum den Kinderjahren entwachsenes Mädchen in blauseidenem Kittel, anschmiegendem Trikot und dem goldimitierten Gürtel, der sich wie eine Schlange mit roten Feueraugen um den jugendfrischen Leib ringelte, sah sie mit Geschick und stets sich einfühlender Sicherheit ihre Handreichungen tun. Dann wieder sah er sie auf gemeinsamen Wanderungen durch Felder und Wälder und später im einfachen Hauskleide auf seiner bescheidenen Stube, ihm noch vor der Vorstellung das Essen bereiten und nachher bis in die späte Nacht mit ihm lesen und plaudern. Es war etwas so Wundervolles um dies Zusammenleben. Nichts geschah, was die Augen der Welt zu scheuen hatte. Seine Liebe zu ihr war eine seltsame Vereinigung von väterlicher Besorgtheit und männlich gezügelter Leidenschaft.
Warum war das jetzt mit einem Male alles anders geworden? Warum fühlte er in diesem Augenblicke, wo er sie so plötzlich und unvermutet wiedergefunden, nichts als die aus ferner Vergangenheit neuaufflammende Glut, nichts als eine Sehnsucht, die ihn unwiderstehlich zu ihr zog?
Und dennoch wusste er es nie so genau wie in dieser Stunde, dass er sie nie besitzen würde. Das war das Furchtbare in all dem Glück, das ihn bei diesem Wiedersehen beseelte. Würde er stark genug sein, in dieser Prüfung zu bestehen? Oder — —?
Da entriss sie ihn seinen Gedanken.
„Und du?“ fragte sie. „Von dir hast du noch nichts gesagt. Du bist ein grosser Mann geworden. Damals warst du ein armer, kleiner Rechtsanwalt ohne Geld und Praxis, heute kennt man dich überall. Der Hoteldirektor kündigte mir deinen Besuch an, als ob er einen König anmeldete. Seitdem bin ich sichtbar in seinem Ansehen gestiegen.“
Stumm und in sich versunken sass Martin Bernstoff. Sein mächtiger Kopf mit dem scharfgemeisselten, ein wenig verarbeiteten Gesicht und dem leicht angegrauten Haar war vornübergeneigt. Die grossen Augen unter den eng zusammengeschlossenen, nur von einer steilen Falte durchschnittenen Brauen bohrten sich fest in die Tischplatte.
„Die Zeit hat mir geholfen,“ erwiderte er zögernd. „Damals war sie böse.“
„Die Zeit wird es nicht gemacht haben. Aber deine zähe Energie und dein Wille, den ich schon damals an dir bewunderte.“
Er hob die Augen, lächelte müde, ein wenig bitter.
„Eines aber musst du mir sagen,“ fuhr sie fort. Weshalb du deinen Namen abgelegt und diesen mir ganz fremden angenommen hast?“
„Du tatest ein gleiches.“
„Bei mir war es nur eine kleine Veränderung, die mein Impresario des künstlerischen Wohlklangs halber vornahm. Bei dir aber —“
„War es eine Notwendigkeit, die ich dir vielleicht später einmal erklären werde. Für heute erlasse es mir!“
Wie abwehrend streckte er den Arm gegen sie aus. Sie aber ergriff ihn, nahm seine starke, wohlgepflegte Hand in die ihre, versenkte den Blick in sie . . . aufmerksam und prüfend, als lese sie in einem aufgeschlagenen Buche . . . eine ganze lange Zeit. Dann schüttelte sie den Kopf.
„Wunderbar!“ flüsterte sie vor sich hin. „Es ist alles so ähnlich . . . es sind fast dieselben Linien und Züge wie bei dem anderen, der eben bei mir war.“
So leise sie gesprochen, er hatte jedes ihrer Worte vernommen.
„Der eben bei dir war?“ fragte er. „Wer war es?“
Sie nahm ein dunkelgrünes, ledergebundenes Buch, das neben ihr auf dem Tische lag, blätterte, suchte.
„Arnim Bieler heisst er,“ sagte sie dann.
Er glaubte, nicht recht gehört zu haben.
„Arnim Bieler?“ fragte er. „Er ist hier? Er war bei dir?“
„Er suchte mich heute nachmittag auf, und ich gewährte ihm eine Sitzung. Du kennst ihn?“ fügte sie hinzu, als sie das Erschrecken bemerkte, das dieser Name in ihm auslöste.
„Ich besinne mich dunkel auf ihn,“ erwiderte er, zu sich selber kommend. „Er war damals noch ein Jüngling —“
„Damals? Wann war das? Als du von mir gingst?“
„Erst später — nach mancher langen Irrfahrt, als ich seinem Vater begegnete. Der nahm mich auf. Und nun sagst du, sein Sohn ist hier —“
„Ja, er ist hier. Und du wirst ihn bald sehen. Und dann oft . . . jeden Tag. Eure Wege werden sich vereinen, und er wird in deinem Leben eine Rolle spielen. Denn ihr seid unter demselben Stern geboren.“
Er antwortete nicht. Auf seinem Antlitz lagen Zweifel und Erstaunen.
„Und inzwischen,“ fuhr sie langsam, zögernd fort, ,,hast du geheiratet.“
„Vor vielen Jahren.“
„Und liebst deine Frau? Aber warum frage ich das? Ich weiss es. Ich sehe deine Frau.“
„Du siehst sie?“
Als hätte ihre Seele das Körperliche abgestreift, so entrückt allem Irdischen sass sie ihm gegenüber.
„Ja . . . ich sehe sie . . . sie steht vor mir . . . ganz deutlich . . . leibhaftig. Sie ist mittelgross . . . eine anziehende Gestalt . . . ein still-vornehmes. Antlitz. Früher waren ihre Haare wohl dunkelbraun. Aber jetzt sind sie gebleicht. Vielleicht von den Sorgen, die sie um dich und mit dir getragen hat. Denn sie hat ein treues Herz . . .“
„Ja, wahrhaftig . . . das hat sie!“ entgegnete er unwillkürlich. „Aber wie ist es möglich? Alles, was du da von ihr gesagt hast, trifft zu . . .“ Und dann nach einer längeren Pause, langsam, zögernd: „ — — Und du?“
Sie verstand ihn sofort:
„Seitdem du von mir gingst, ist mir niemals wieder ein Mann begegnet, dem ich gehört habe oder auch nur hätte gehören wollen. Ich bin von alledem ganz unberührt geblieben. Es mag an dieser Gabe liegen, die ein Danaergeschenk ist. Das kannst du schon glauben. Denn sie bringt den, der sie besitzt, um jeden harmlosen Genuss, verscheucht die Unbefangenheit und die Freude . . . ja, vielleicht auch die Liebe — —“
„Aber jetzt, wo wir uns endlich wiedergefunden . . . nach so langer, schwerer Zeit?“
Sie strich ihm mit der weichen Hand über die gerunzelte Stirn.
„Lass es . . . ich bitte dich . . . lass es! Nein, wir wollen nicht mehr traurig sein und nachdenklich. Lass uns diese Stunde feiern als eine grosse, herrliche Festesstunde.“
Nun sassen sie drüben an dem schnell bereiteten blumenduftenden Tische. Sie machte mit Anmut die Wirtin, füllte auch die Kelche mit dem schäumenden Wein, wenn er es, immer noch mit seinen Gedanken beschäftigt, einmal unterliess.
„Eine Frage muss ich noch an dich stellen,“ sagte er schliesslich, „und du wirst sie mir beantworten: Glaubst du nun wirklich an all das? An Gesichter, die du in der Ferne siehst? An Stimmen, die in dir sind und Zukünftiges verkünden? An den geheimnisvollen Einfluss der Sterne auf den Menschen und sein Schicksal?“
Sie blickte ihn an, als verstünde sie gar nicht, was er sagte.
„Gewiss glaube ich daran. Fest und unverbrüchlich. Ich glaube, dass die Sternenkunde die ewigen grossen Gesetze, über die wir bisher im Dunkeln tappten, unfehlbar aufgedeckt hat, dass sie die atmosphärischen und siderischen Einflüsse erkannt hat, die auf uns wirken und unserer Seele die Struktur geben, dass die Stellung des Horoskops auf zuverlässig wissenschaftlicher Arbeit beruht und meine Kunst, in die Zukunft zu blicken, aus mir unbekannten Quellen hervorströmt. Oder, wenn du willst, eine Art sechster Sinn, der mir angeboren ist. Und was ich sehe und sage, geht in Erfüllung. Darauf kannst du dich verlassen! Es ist bis jetzt immer in Erfüllung gegangen . . . doch nun lass uns von anderem reden!“
Sie reichte ihm über den Tisch hin ihre schöne, schlanke Hand. Er schloss sie fest in die seine und gab sie erst frei, als sie sie ihm leise entzog.
* * *
Pastor Steinbach kehrte von der Sonntagsvesper in sein Pfarrhaus zurück, das, mit einem alten Beischlag versehen, schmalfrontig und hochgiebelig im Schatten der gewaltigen Kirche lag.
Seit einer Reihe von Jahren war er der erste Seelsorger an dem Mariendom, dessen bauliche Anfänge in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, ja, vielleicht in noch frühere Zeiten zurückreichten, und der in seinem Innern eine kaum übersehbare Anzahl seltener Kunstgegenstände barg. Hans Memlings Tafel vom Jüngsten Gericht befand sich in ihm, hohe, tiefgewölbte Schränke mit Messgewändern aus orientalischen Stoffen gewirkt, die einst den Thron eines Sultans geschmückt, und eine Schatzkammer voller archäologischer Herrlichkeiten, die viele Gelehrte und Kunstforscher aus allen Gegenden Deutschlands nach St. Marien zog. Er war der Verwalter dieser Schätze, und nicht nur ein kunstsinniger, sondern auch ein aufrechter Mann, fern von Dogmenstarre und priesterlicher Äusserlichkeit, aber von um so innerlicherer Frömmigkeit und seiner Kirche in tiefer Liebe zugetan. Und wenn er so des Sonntag abends auf seiner Kanzel oder am Altar stand und in die weiten, in geheimnisvolle Dämmerung sich verlierenden Gänge blickte oder auf die hochragenden, von Staub und Spinneweben in wunderlichen Verästungen gezeichneten Backsteinpfeiler, dann war ihm zumute, als wandelten durch die in feierlichem Schweigen träumende Unendlichkeit die Füsse Gottes, als vernähme er ihr Rauschen bis auf seine stille Kanzel hinauf.
„Es ist gut, dass du da bist,“ empfing ihn seine Gattin, eine etwas zur Fülle neigende Dame mit schlichtgescheiteltem Haar und treusorgendem Gesicht, in ihrer Erscheinung wie ihrem stets geschäftigen Wesen der Typus der Pfarrfrau alter Art, wie sie jetzt längst im Aussterben begriffen ist.
„Warum ist es gut?“ fragte er, während sie ihm bei dem Ausziehen seiner Amtstracht behilflich war, den Talar in den Schrank hängte und das Barett sorgsam in einer Pappschachtel verpackte. „Ist etwas vorgefallen? Du warst ja auch nicht zur Vesper.“
„Als ich gerade gehen wollte, kam Kordel nach Hause und erzählte, dass sie unterwegs Kurt Brüggemann getroffen, der sich zum Abend angemeldet und einen Freund mitbringen wollte. Da ist es mir doch lieb, dass du da bist, denn sie müssen gleich hier sein.“
Kaum hatte sie es gesagt, als von unten her schrill und blechern die alte Hausglocke schellte und gleich darauf hartauftretende Männerschritte auf der geräumigen Diele hörbar wurden.
Nun standen die beiden im Arbeitszimmer des Geistlichen. Kurt Brüggemann stellte seinen Freund vor, der in seiner frischen und von einer harmlosen Keckheit getragenen Art sich in dem völlig fremden Hause einführte, als ginge er wie dieser täglich in ihm ein und aus.