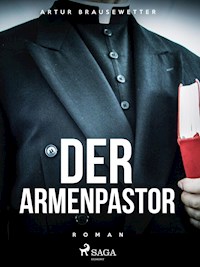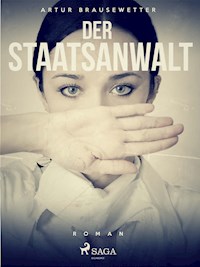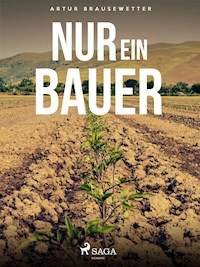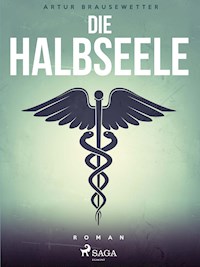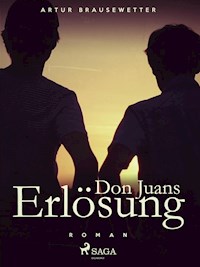Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pauline Zollbrügge versteht es, sich die Dinge zu erbitten. Ihre nur wenig jüngere Schwester vermag es nicht. Eine wiederholte Bitte würde ihr nie über die Lippen kommen, eher nimmt sie Nachteile auf sich. Von ihren Mitschülerinnen wird sie daher "Eisrose" genannt. Ihre Mutter lehnt diese Art Tochter ab und auch der Vater kann sich gegenüber der Mutter nicht durchsetzen. Niemand wundert es daher, dass Pauline bald heiratet, während es für Rose überhaupt keine Heiratskandidaten gibt. Da wendet sich das Glück der Familie zum Schlechten. Das Handelshaus des Vaters muss seine Zahlungen einstellen, die Mutter stirbt, der Vater wird zum Pflegefall. Allein Rose behält ihren Posten an der Seite des Vaters, der erst jetzt erkennt, was er an Rose hat. Genauso geht es dem jungen Pastor, an den sich Rose bald wenden muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 96
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Brausewetter
Die Eisrose und eine andere Geschichte
Saga
Ebook-Kolophon
Artur Brausewetter: Die Eisrose und eine andere Geschichte. © 1924 Artur Brausewetter. Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711487334
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
Die Eisrose
1.
„Lass sie bitten wie Pauline es tat,“ sagte Frau Zollbrügge zu ihrem Manne.
„Sie tut es doch nicht.“
„Dann bleibt sie eben zu Hause.“
„Aber sie hat schon so viel weniger als Pauline.“
„Das ist ihre Sache.“
So ging Pauline ohne ihre Schwester ins Theater. Es war ein Ereignis, denn Frau Zollbrügge hatte strenge Ansichten, sie liebte es nicht, dass ihre Kinder das Theater besuchten . . . höchstens einmal im Jahre das Weihnachtsmärchen. Aber sie lasen die „Jungfrau von Orleans“ gerade in der Klasse. Und Pauline hatte eine ganz eigene Art, zu betteln und zu liebkosen, die sonst so feste Mutter war diesem Liebesstürmen nicht gewachsen.
Friedrich, der Primaner, begleitete seine Schwester. Nicht sehr gern. Er stand dicht vor dem Abiturientenexamen und war längst über die „Jungfrau von Orleans“ hinaus; er fand sie kindlich, höchstens für Backfische geniessbar. Sie kam für ihn gleich hinter den Weihnachtsmärchen, . . . besonders seitdem er in den letzten Osterferien, zu denen ihn ein Onkel in Berlin eingeladen hatte, Gorkis „Nachtasyl“ gesehen. Aber ein Freund, dem er verpflichtet war wegen mancher Hilfe in den mathematischen Arbeiten, ging auch ins Theater. Nicht der „Jungfrau von Orleans“, sondern Paulinens wegen; die hatte es ihm angetan mit den dichten rotblonden Zöpfen und dem Kirschenmunde, der so appetitlich zu lachen wusste. Der wollte neben Pauline sitzen. Und das Abiturientenexamen stand vor der Tür, in den nächsten Tagen begannen die schriftlichen Arbeiten, und von den mathematischen träumte er beinahe jede Nacht.
„Geh doch und bitte,“ hatte Pauline mehrere Male zu Rose gesagt, denn sie war gutmütig veranlagt und ging nicht gern ohne die Schwester.
„Ich habe es getan, aber die Mutter schlug es ab.“
„Sie will eben mehr gebeten sein.“
„Ich kann es nicht, du weisst es.“
Auch der Vater hatte sich ins Werk gelegt.
„Die Mutter wird es dir erlauben, du musst nur noch einmal kommen.“
Aber Rose kam nicht. Sie verzog keine Miene, sie vergoss keine Träne, als Pauline glückstrahlend mit Friedrich und seinem Freunde ins Theater ging. Sie sass den Abend in dem kleinen Stübchen, das sie mit der Schwester teilte, sie las in der „Jungfrau von Orleans“, sie verfolgte Szene für Szene, wie sie sich jetzt auf der Bühne abspielen würde, sie war bei dem Abendessen still und ein wenig nachdenklicher, aber ohne jede Verstimmung. Und als Pauline am späten Abend mit rotglühenden Wangen nach Hause kam und im Bette noch begeistert von der Aufführung erzählte und der Lindschokolade, die Friedrichs Freund mitgebracht, da hörte sie neidlos und voller Aufmerksamkeit zu.
*
Rose war ein Jahr jünger als Pauline. Aber sie sass in derselben Klasse, denn sie war begabter und viel gewissenhafter als ihre Schwester. Pauline hatte ein halbes Dutzend Freundinnen, Rose nicht eine einzige, Pauline war hübsch und lustig, sie war nicht hässlich, aber ernst.
Doch das war es nicht, was die anderen Mädchen von Rose abstiess.
„Sie ist so kalt,“ sagten sie, „man kommt ihr nie näher.“
Und da es in der Klasse noch ein Mädchen gab das denselben Vornamen führte und mit ihr auf einer Bank sass, nannte man sie nur noch „die Eisrose“. „Der Unterscheidung wegen,“ tröstete Pauline sie und nannte sie selber so.
*
Die Mädchen der zweiten Klasse waren kritisch veranlagt. Und weil die Jugend nichts so verachtet wie den Weg der Mitte, so gab es auch hier in der Beurteilung der Lehrer nur ein Entweder — oder. Entweder schwärmte man für seinen Lehrer und fand ihn „reizend“, oder man verabscheute ihn und nannte ihn „unausstehlich“.
Die letzte, wenig schmeichelhafte Bezeichnung war mit Einstimmigkeit der ganzen Klasse Herrn Doktor Nadolmy zuerkannt, einem noch jungen, aber eingebildeten, eitlen Lehrer des Königlichen Gymnasiums, der aushilfsweise Physik an der höheren Töchterschule gab.
Für Rose allein galt das Entweder — oder ihrer Altersgenossen nicht; sie schwärmte für niemand unter den männlichen oder weiblichen Lehrkräften, nicht einmal für den Literaturlehrer, der, selber Poet und Verfasser eines historischen Dramas, das einige Male im Stadttheater aufgeführt war, mit der Lektüre der „Jungfrau von Orleans“ die Backfischherzen im Sturme eroberte.
Aber darin war sie mit der Klasse eins: sie hasste Doktor Nadolmy. Nicht seiner langweiligen Stunden, seines gespreizten Vortrages wegen, über den sie lachte. Aber er war ungerecht, er bevorzugte die hübschen Mädchen und alle, die ihm um den Bart gingen, und die übrigen behandelte er schlecht. Als seine Parteilichkeit bei den Weihnachtszeugnissen in ein geradezu grelles Licht getreten war, bildete sich eine regelrechte Verschwörung wider ihn. An ihrer Spitze stand Rose Zollbrügge.
Doch über Herrn Nadolmy waltete ein günstiger Stern. Die Verschwörung wurde entdeckt, ehe sie recht eigentlich in Tätigkeit getreten war; ein aufgefangener Zettel, den man in einer Rechenstunde mit grosser Heimlichkeit von Bank zu Bank befördrte, wurde ihr Verräter.
Eine strenge Untersuchung wurde eingeleitet. Rose nahm die ganze Schuld auf sich.
Der Direktor rief sie auf sein Zimmer. Sie hörte es aus jedem seiner Worte, wie schmerzlich bewegt er war.
„Du warst meine beste Schülerin von der untersten Klasse an, ich hatte nichts an dir auszusetzen . . . und nun dieses unverzeihliche Vergehen!“ Und dann: „Weil es das erstemal ist und du offen bekannt hast, will ich von der verdienten Strafe absehen. Aber du wirst morgen Herrn Doktor Nadolmy vor der Klasse Abbitte leisten.“
„Nein,“ sagte Rose leise, aber sehr bestimmt.
„Nein?!“ Der Direktor glaubte nicht recht gehört zu haben.
„Strafen Sie mich, wie Sie wollen, Herr Direktor . . . abbitten werde ich nicht.“
„Du wirst nicht?! Weshalb nicht?“
Rose schwieg, es war kein Wort mehr aus ihr herauszubringen.
„Also hochmütig auch noch! Und das ist schlimmer als alles andere. Das ist der Anfang eines sittlichen Verfalles.“
Er setzte ihr eine Strafe an, die im Verhältnis zu ihrem Vergehen hart war. Rose wusste, dass sie mit einem abbittenden Wort auch jetzt noch alles gutmachen konnte, dass der ihr wohlgesinnte Direktor auf dieses Wort nur wartete.
Aber sie sprach es nicht. Schweigend und ohne eine Träne trat sie ihre Strafe an . . . Das Kollegium der Luisenschule, das an demselben Nachmittag von dem Direktor zur Konferenz zusammenberufen war, fällte ein einmütiges Urteil über Rose Zollbrügge: Man hatte sich in dem Kinde getäuscht. Seine Begabung und sein unleugbarer Fleiss hatte über den Kern seines Charakters eine schöne Hülle gebreitet. Die Hülle begann sich zu lüften, der Kern wurde sichtbar, und er war nicht gut. Zum ersten Male fehlte auf Roses Osterzensur im Betragen das Wort „löblich“, „Sie neigt zum Hochmut“ war da zu lesen, und das war die schlimmste Note, die das Kollegium ausstellen konnte.
„Ich habe es längst kommen sehen,“ sagte Frau Zollbrügge und weinte über ihre Tochter. Die Mitschülerinnen gingen ihr aus dem Wege, weil sie kalt und unnahbar war, die Lehrer und Lehrerinnen, die sie bis jetzt lieb gehabt, waren irre an ihr geworden, ihre Mutter zog sich mehr und mehr von ihr zurück und entschädigte sich an Paulinens sonniger Natur; diese verkehrte nur noch mit ihren Freundinnen — — Rose war einsam geworden.
2.
Nun kam das Jahr des Konfirmandenunterrichtes. Die Eltern hatten ihren Töchtern unter den drei Predigern der Gemeinde freie Wahl gelassen. Rose war des öfteren allein in die Kirche gegangen, die Predigten des ersten Pfarrers, eines ebenso würdigen wie milden Mannes mit vollem schneeweissem Haar und bartlosem, gütigem Gesicht, hatten auf ihr ernstes Gemüt tiefen Eindruck geübt, und da Paulinens Freundinnen gleichfalls den Konfirmandenunterricht dieses Geistlichen besuchten, war auch diese einverstanden.
So begab sich Frau Zollbrügge eines Tages zu Oberpfarrer Wacht, ihre Töchter ihm zum Unterrichte anzumelden.
„Ich möchte nun einiges über die beiden Kinder aus dem Munde der Mutter hören,“ sagte der alte Herr, nachdem die Formalitäten erledigt waren.
Auf einen Wink der Mutter verliessen Pauline und Rose das Amtszimmer.
„Die ältere ist ein sonniges Normalkind,“ begann Frau Zollbrügge, „ohne hervorstechende Eigenschaften, auch nicht von besonderer geistiger Begabung. Aber sie ist gutmütig, freundlich, zu jedermann, gefügig zu Hause und stets dienstbereit, vor allem ist sie dankbar und bescheiden.“
„Das sind liebenswerte Züge . . . hm . . ., so werde ich meine Freude an ihr haben. Und die Jüngere?“
„Sie hat auch ihre guten Eigenschaften,“ erwiderte Frau Zollbrügge, „sie ist ernst veranlagt und gewissenhaft, sie denkt trotz ihrer Jugend viel nach und ist Pauline an Fähigkeit zweifellos überlegen . . .“
„Aber? . . .“
Ein Schatten, der langsam wuchs, breitete sich über Frau Zollbrügges Antlitz.
„Ich weiss nicht recht, wie ich mich ausdrücken soll, Herr Oberpfarrer, ich möchte gerade Ihnen ein richtiges, in Licht und Dunkel getreues Bild der Kinder geben . . .“
Und Frau Zollbrügge erzählte genau, fast weitschweifig, den Vorgang aus der Schule, und welch ein schlechtes Zeugnis Rose ihr gebracht; auch von einigen häuslichen Geschehnissen berichtete sie, wie schwer Rose ihre Schuld einsähe, und . . .
„Ich glaube Sie zu verstehen,“ unterbrach der seelenkundige Geistliche, „Ihrer jüngeren Tochter fehlt es bei allen guten Eigenschaften an zweierlei: an der rechten Demut und Dankbarkeit.“ Und als Frau Zollbrügge traurig, aber zustimmend nickte:
„Das freilich sind zwei Tugenden, die für ein junges Mädchen, für eine Christin unentbehrlich sind. Aber seien Sie getrost, gnädige Frau, die Rose hat ein so treues, sinnendes Gesicht, es steht mancherlei darin geschrieben, was mir gefällt; wir haben alle unsere Fehler, ich will mich dieses Kindes mit besonderer Liebe annehmen, ich will an ihrer Seele arbeiten, Gott wird helfen. Der Konfirmandenunterricht hat an manchem jugendlichen Gemüt Wunder gewirkt.“
*
Der alte Pastor machte sein Versprechen wahr. Unter seinen vielen Konfirmanden beschäftigte er sich mit niemand so wie mit Rose Zollbrügge, nicht nur in den Stunden, auch in seinen Gedanken und Gebeten.
Aber je mehr der Unterricht seinem Ende entgegenging, um so deutlicher wurde es ihm, dass er mit all seiner Mühe und Arbeit nichts erreicht hatte. Rose war genau dieselbe geblieben, die sie am Anfang gewesen. Gerade so sinnend und teilnehmend sass sie auf ihrem Platze, mit denselben ernsten Augen folgte sie jedem seiner Worte, sie antwortete nicht viel, doch wenn sie es tat, so war es richtig und wohldurchdacht. Aber das, was er mit allem Eifer erstrebt hatte, ein Sicherschliessen der Persönlichkeit, eine wärmere Hingabe an die Sache, irgendein deutlicheres Zeichen von Wirkungen, die dieser Unterricht übte, alles das blieb aus.
Und nun geschah etwas, das Pfarrer Wacht vollends an seiner Schülerin irre machte.
Es war in einer der letzten Stunden. Mit allem Nachdruck hatte er auf die bevorstehende Einsegnung hingewiesen und hatte den Kindern klar gelegt, wie die Gnade Gottes; die ihnen hier zuteil werden sollte, vor allem ein empfängliches Herz suche, ein Herz, das seine Sünden erkenne und sie mit ganzer Inbrunst bereue. Seiner persönlich eindringenden Art entsprechend, fragte er diese oder jene unter seinen Konfirmandinnen, ob sie im Hinblick auf den grossen Festtag solchen aufrichtigen Schmerz über ihre Sünden empfände.
Zwei seiner besten Schülerinnen, unter ihnen Pauline, hatten eben mit tief zu Boden gesenktem Blick ihr leises „Ja“ geantwortet, da wandte er sich an Rose.
„Und du, meine liebe Tochter,“ sagte er mit milder Freundlichkeit, „fühlst du ebenso wie deine Schwester?“
Eine Sekunde schwieg Rose.
„Nein,“ erwiderte sie dann leise, fast traurig.
„Nein?“ Pfarrer Wacht war erschreckt.