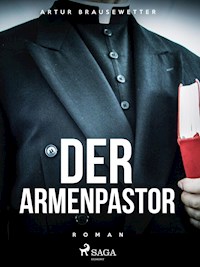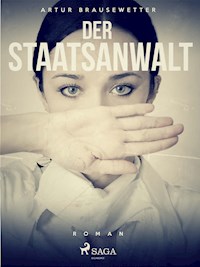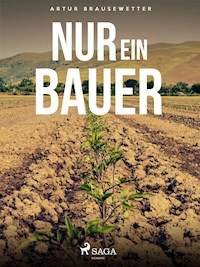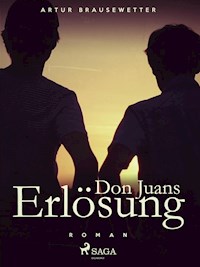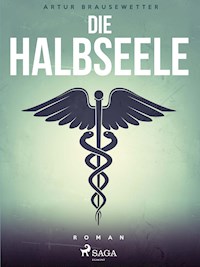
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Walter Merten, einziger Sohn des Landpastors, entscheidet sich gegen die Theologie und für die Medizin. Er wird Assistenzarzt im Städtischen Krankenhaus in Bernburg und gerät dort in eine persönliche Fehde zwischen seinem Vorgesetzten, Professor Westphal, einem Arzt von Weltruf, und dem Sanitätsrat Glasgow. Merten spürt schon bald, dass er sich vor Westphal besser in Acht nehmen sollte. Unerbittlich und rücksichtslos setzt dieser seinen Willen auch gegen jede medizinische Vernunft durch. Als er einen Patienten operiert, obwohl er selbst eine Handverletzung hat, stirbt dieser an einer Infektion. Merten hadert mit seiner Profession: Soll er sich gegen Westphal stellen? Wie bei allen großen Herausforderungen in seinem Leben spürt er seinen fehlenden Glauben als klaffendes Loch in sich …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Brausewetter
Die Halbseele
Roman
Saga
Ebook-Kolophon
Artur Brausewetter: Die Halbseele. © 1928 Artur Brausewetter. Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711487723
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
Erstes Buch.
I.
Halle, den ......
Sehr geehrter Herr Sanitätsrat!
Ich habe mich um die Stelle des ersten Assistenten am städtischen Krankenhaus in Bernburg, chirurgische Abteilung, beworben und höre, dass ich Aussicht habe, gewählt zu werden. Es liegt mir nun daran, ein sachkundiges Urteil über die Verhältnisse dieser Stelle zu erhalten. Ich wende mich deshalb an Sie, nicht nur als den erfahrenen Fachmann, sondern als den alten Freund unseres Hauses. Sie als der Leiter einer grossen Privatklinik werden mir zuverlässigen Bescheid geben können. Wie sind die Verhältnisse am städtischen Krankenhaus? Hat der erste Assistent eine gewisse Selbständigkeit? Darauf lege ich naturgemäss Wert, nachdem ich fast vier Jahre bei bedeutenden Vertretern der Chirurgie und Gynäkologie gearbeitet habe.
Und vor allem, wie ist der Chef? Ich bitte um Ihr unumwundenes Urteil. Von der Persönlichkeit des leitenden Arztes hängt für den ersten Assistenten viel ab. Dass Professor Westphal ein hervorragender Vertreter seines Faches ist, weiss ich. Seine letzten Veröffentlichungen: „Beiträge zur Antisepsis“ haben mir eine Fülle von Anregung geboten. Als Operateur hat er ja fast Weltruf. Aber wie steht es mit seiner Persönlichkeit? Er muss ein nicht leicht zu erkennender Charakter sein, denn die Urteile, die ich über ihn gehört habe, sind verschieden und widersprechend. Was für ein Mensch ist er? Was für ein Kollege? Das sind für mich wichtige und entscheidende Fragen. Ich harre Ihrer Antwort, auf die ich Gewicht lege, und bleibe mit Empfehlung an die verehrten Ihren Ihr Ihnen in aufrichtiger Hochachtung ergebener
Dr. Walter Merten,z. Z. Assistenzarztan der Universitätsklinik in Halle.
Bernburg, den ....
Lieber Herr Kollege!
Besten Dank für Ihren Brief. Eine so offenherzige Anfrage an einen Mann, den Sie persönlich gar nicht kennen, verdiente gewiss dieselbe Antwort. Wenn diese dennoch nicht so ausfällt, wie Sie sie wohl wünschten, so werden Sie die Gründe meiner Zurückhaltung als Kollege zu würdigen wissen.
Die Verhältnisse unseres städtischen Krankenhauses sind nicht besser und nicht schlechter, als man sie in grossen Städten gewöhnlich findet. Seitdem der Diakonieverein, von dem ich seit einigen Wochen auch vier Schwestern für meine Privatklinik habe, die Krankenpflege mit einer trefflichen Oberin an der Spitze übernommen hat, ist an der inneren Verwaltung des Hauses nichts auszusetzen. Sie haben also ein vorzüglich geschultes Personal und können in dieser Beziehung zufrieden sein. Ihr Arbeitsfeld wird weit sein, auch ihre Selbständigkeit grösser, als sie ein Assistenzarzt gewöhnlich besitzt und es Ihnen manchmal lieb sein wird. Die ganze Verantwortung wird auf Ihren Schultern ruhen, denn Ihr Herr Chef trägt sie nur dem Namen nach. Er kann kaum die Hälfte seiner Zeit dem Krankenhause widmen, da die andere seiner ausgedehnten Privatpraxis gehört, vor allem der Leitung seiner eigenen Klinik in der Hohenzollernstrasse, in der nur vornehme oder zahlungsfähige Patienten Aufnahme finden. Der Umstand nun, dass Professor Westphal durch seine Privatklinik mein Konkurrent geworden, wird es Ihnen begreiflich machen, dass ich mich nicht in irgendeiner Weise über ihn äussern möchte. Es genügte Ihnen, dass ich in seiner Würdigung als Chirurg und Gynäkologe mit Ihnen eins bin. Füge ich hinzu, dass ich in letzter Zeit auch in persönliche, recht schwere Meinungsverschiedenheiten mit ihm gekommen bin, so werden Sie mir um so lieber ein Urteil ersparen, als Sie dieses für parteiisch ansehen müssten.
Ich will und darf Sie nicht beeinflussen. Kommen Sie und urteilen Sie selber. Zur Annahme der Stelle rate ich Ihnen unter allen Umständen. Es gibt kein Feld, auf dem sich eine junge, tatenfrische Kraft besser entfalten könnte. Ich hoffe, Sie bald von Angesicht zu Angesicht kennen zu lernen. Mit den Meinigen erwidere ich Ihre Grüsse herzlich als
Ihr treu ergebenerGlasgow, Sanitätsrat
Nachschrift: Soeben war Stadtrat Vollmer bei mir; er ist Dezernent für das städtische Krankenhaus beim Magistrat und sagte mir, dass Ihre Wahl gesichert wäre. Herzlichen Glückwunsch, lieber Kollege! Sie sind uns willkommen.
Der IhreGlasgow
Eine Drahtnachricht, die am nächsten Morgen eintraf, bestätigte Glasgows Schreiben: Doktor Merten war einstimmig zum ersten Assistenzarzt am städtischen Krankenhaus in Bernburg gewählt.
Walter Merten war der einzige Sohn eines Landpastors. Sein Vater war eine stille, ernste Natur von einer innerlich kräftigen Frömmigkeit und rückhaltlosen Redlichkeit; sein Fleiss war gross, seine Begabung mässig. In dem Dienste einer ausgedehnten Landgemeinde auf der Nehrung verzehrten sich seine Kräfte schnell; die Tiefe seines Glaubens, die so viel überwunden hatte, trug sein langes, schleichendes Leiden mit einer Geduld, die ein überirdisches Gepräge trug; sein Sterben war friedlich und selig wie sein Leben.
Walter war noch ein Kind bei seinem Tode; seine Mutter zog ihn in der schlichten Stille einer kleinen Stadt auf. Den felsenfesten Glauben des Vaters dem aufwachsenden Sohn mitzugeben, war der leitende Gedanke ihrer Erziehung. Dass der einzige Sohn eines solchen Mannes nur Prediger werden konnte, stand ihr als etwas Selbstverständliches fest, und ihm nicht minder.
Er lebte sich in diesen Gedanken hinein, ohne ihm innerlich jemals nachzudenken; er sprach mit der Mutter sein Abendgebet, so lange er Kind war, und setzte es als Jüngling wie eine liebgewordene Gewohnheit fort. Er kannte keinen Kampf, kein Zweifel focht ihn an. Gott war dem zwanzigährigen jungen Mann dieselbe kindlich umgrenzte Märchengestalt geblieben, wie sie es dem sechsjährigen Knaben gejwesen war, der der Mutter sein Nachtgebet hersagte.
Sowie er als Theologe auf die Universität ging, die ersten Vorlesungen hörte, kam er zur Erkenntnis.
Nach kurzem, schwerem Kampfe konnte sich die verständnisvolle Mutter der Notwendigkeit seines Entschlusses nicht entziehen.
Er entsagte der Theologie und begann Medizin zu studieren. Alle schlummernden Gaben entfalteten sich rasch und reich, sowie sie das Feld ihrer richtigen Betätigung gefunden; er bestand seine Prüfungen glänzend, wurde früh der begehrte Assistent der ersten Ärzte. Eine Zukunft lachte ihm.
Aber nun vollzog sich ein wunderbarer Prozess in seinem Innenleben.
Sowie er als Arzt vor schweren Anforderungen seines Berufes stand, besonders vor Operationen auf Leben und Tod, fühlte er trotz aller Begabung und allen Fleisses die Ohnmacht seines Könnens. Eine unbestimmbare Sehnsucht erwachte dann in seinem Herzen nach einer höheren Kraft, als sie dem Menschen von der Natur vergönnt war, nach irgendeinem Halt, an den er sich mit seiner zagenden Seele klammern könnte. Das Bild seines Vaters stand vor seiner Seele, wie er es aus der Erinnerung, mehr aber aus den verklärenden Schilderungen der geliebten Mutter kannte, die inzwischen auch gestorben war ... friedlich und selig wie der Vater.
Wenn er glauben könnte wie der! Wie geborgen wäre er, wie glücklich! Aber das waren nur vorübergehende Empfindungen, bei denen es blieb. Ein wirklicher Glaube war ihm versagt. Das wusste er und machte deshalb keine Anstrengungen, ihn sich anzueignen.
Er liess den Geistlichen an die Krankenbetten rufen, er riet Patienten, die seine Kunst aufgeben musste, das heilige Abendmahl zu nehmen — persönlich stand er dem allen fern. Er besuchte keine Kirche, hörte keine Predigt. Er wusste, dass sie ihm nichts sagen und nichts geben konnten.
Zweierlei aber hatte er als Erbe seiner Eltern übernommen: von dem Vater eine strenge, unbestechliche Redlichkeit und Gewissenhaftigkeit, von der Mutter eine empfindsame Gemütsart. Dazu war er Idealist: er glaubte an die Menschen, an das Gute in der Welt.
„Der Herr Professor sind oben in seiner Klinik, er lässt sich jetzt von niemand sprechen.“
„Der Herr Professor hat mich zu dieser Stunde gebeten.“
„Ah — der Herr Oberarzt aus Halle, jawohl, Sie werden erwartet, ich bin unterrichtet. Der Herr Doktor können sogleich in das Laboratorim gehen, oben in der Klinik, es ist nur für Eingeweihte — ich werde vorangehen.“
Der Diener schritt die mit dicken Läufern belegten Treppen empor und trat, leise die hohen, an der Innenwand gepolsterten Türen öffnend, in den behaglich ausgestatteten Vorraum der Privatklinik des Professors Westphal.
„Hier bitte ich anzuklopfen, Meldung ist nicht nötig.“
„Herein!“ rief eine gebietende Stimme.
Als Merten öffnete, sah er eine kraftvolle Erscheinung im weissen Operationsmantel, die sich über ein hohes Pult beugte. Der gewaltige Kopf war in die Hände vergraben. Der kleine, nur von dämmerndem Licht erfüllte Raum, die willkürliche Anordnung von allerhand Seltenheiten und altertümlichen Kunstgegenständen, dazwischen einige Schädel und medizinische Instrumente, an den Wänden Kopien weiblicher Akte, anatomisch nüchtern aufgefasst, und in der Mitte von alledem die schweigende, weisse Gestalt, umhüllt von einem betäubenden Duftgemisch von Karbol, Jodoform und Äther ... das alles verwirrte für einen Augenblick den Eintretenden.
Mit einem Male, als hätte er sein Kommen gar nicht bemerkt, erhob der Professor den muskulösen Arm, liess ihn dann auf das Pult herabfallen, dass es wie eine Erschütterung durch das Zimmer ging, die Schädel klapperten, die Gläser und Instrumente klirrten.
„Heureka!“ rief die triumphierende Stimme. „So werde ich es machen, so muss es gelingen!“
Dann wandte er den Kopf, und das Erstaunen des jungen Arztes stieg.
Professor Westphal stand in der Mitte der Sechziger. Mehrere Kollegen hatten es ihm erzählt, das Lexikon hatte es bestätigt. Aber diese ungebeugte Erscheinung, das volle Kopfhaar, durch dessen tiefes Schwarz einige graue Stellen wie neckend schimmerten, straften Kollegen und Lexikon Lügen.
„Ah — Sie — Kollege Merten, nicht wahr? Willkommen!“
Eine Hand streckte sich ihm entgegen, klein und weich im Gegensatz zu dem markigen Arm und dem starkknochigen Körper.
„Ich dachte eben über ein Problem nach, ein verdammt schwieriges, von dem unsere Schulweisheit sich nichts träumt, aber von dem Leben und Tod abhängt für einen armen Teufel, der seine Millionen noch nicht lachenden Erben hinterlassen will und sich aus den Klauen des Todes gestern in meine rettenden Arme geflüchtet hat. Und ich werde ihn retten, damit er wenigstens noch ein paar Jahre mit seinem Mammon liebäugeln kann. Es stirbt sich verdammt schwer, wenn man ein Krösus ist.
Sie hängen am Leben wie die Vampire am Blut, an jeden Strohhalm klammern sie sich. Lieber mit zerschnittenem Leibe, ein Krüppel an Körper und Geist, die süsse Gewohnheit des entbehrungsreichsten Lebens fristen, als Erlösung im schnellen Tode. Es ist die alte Weisheit Hamlets, dass wir die Übel, die wir haben, lieber tragen, als zu unbekannten fliehen. Darum ist unser Beruf auch der grösste und schönste. Wir sind die einzigen, die den Kampf wagen mit dem Allbeherrscher Tod. Wie manches Mal hat er seine Sense streichen müssen vor meinem Seziermesser. Deshalb hat er auch einen Groll auf mich, und wenn er mir mal die Hüfte rühren könnte — —! Aber noch nicht — noch stehe ich meinen Mann — trotz meiner fünfundsechzig Jahre.“
„In der Tat, Herr Professor, ich wollte es nicht glauben.“
„Hm ... hat mir schon mancher gesagt. Das macht die Arbeit, dieser lustige, frische Kampf von morgens bis zum späten Abend. Das ist doch noch Leben und Atmen! Zwar für Schwächlinge ist unser Beruf nichts, der braucht kräftige Naturen mit feuergehärteten Nerven — und mit nicht zu engem Gewissen.“
Und als Merten ihn mit einigem Erstaunen anblickte:
„Natürlich! Sie verstehen mich nicht. Sie mit den Idealen Ihrer Jugend. Und doch ist es mein Ernst. So lange wir Ideale haben, sind wir weichlich und mehr oder minder kränklich. Aber hart muss der Chirurg sein und kalt! Sonst taugt er nicht. Und frisch zugreifen und sich nicht in allerlei Skrupeln und Zweifeln erschlaffen und um seine beste Kraft bringen lassen. ‚Der Chirurg soll das Herz eines Löwen und die Hand einer Lady haben,‘ sagt ein Engländer. Die Hand lasse ich auf sich beruhen — aber das Herz des Löwen, das unterschreibe ich!“
„Auch ich. Nur als Sie vorhin sagten, unser Beruf vertrüge kein enges Gewissen —“
„Sage ich noch einmal! Das Gewissen, wenn Sie es überhaupt brauchen, kann sprechen... vor der Entscheidung, vor der Tat. Aber nie nachher! Wenn mir ein Patient gebracht wird und der Fall ist mir zweifelhaft, dann schliesse ich mich hier in meine stille Klause ein, prüfe jedes Für und Wider und wäge es ernstlich ab. Und dann entscheide ich mich. Entweder übernehme ich die Operation, oder ich lehne ab. Meistens übernehme ich ... immer dann, wenn der Patient ohne sie einem sicheren Tode entgegengeht. Sowie ich aber übernommen habe, ist für mich die Sache innerlich abgetan, ein für allemal. Gelingt die Operation, dann bin ich um so glücklicher, je schwerer der Fall war. Misslingt sie, das heisst, sie misslingt mir niemals, geht jedoch der Patient an Schwäche oder Blutverlust zugrunde, so ist das eine Sache für sich. Aber mich dann in allerlei müssigen Fragen erschöpfen: ob ich früher oder später, ob ich am Ende hätte gar nicht eingreifen sollen, wie es Kollegen tun, die es entweder zu nichts bringen oder sich in ein paar Jahren aufreiben, das ist die Krankheit der weichlichen Gewissen, die unser Beruf nicht vertragen kann. Und wenn jemand von den Angehörigen kommt und will mir gar Vorwürfe machen, wie eben vor einer Stunde erst, dem weise ich die Tür — so!“
Er hob den markigen Arm, und unter den hochstehenden, dichten Brauen sprühten die grauen Augen.
Walter Merten konnte den Blick nicht losreissen von diesem Antlitz; es übte eine Gewalt auf ihn wie nie ein anderes. Dabei war es hässlich, sowie man es nach den Regeln der Ästhetik betrachtete. Was aber hiess hässlich — bei einem Manne, wie er es war? Diese Züge waren derb, ja plump wie die ganze Gestalt; die für gewöhnlich kupferne Farbe des grob geschnittenen Gesichts glänzte in diesem Augenblick in einem hellen Rot, und die stark sinnlichen Lippen, denen eine Bartbekleidung vorteilhaft gewesen wäre, waren fest und trotzig aufeinandergepresst. Aber nein — hässlich war er nicht!
Und während er noch ganz in dem Banne dieser Erscheinung stand, die sich jetzt vor ihm erhob wie der zürnende Gott, der aus einem Paradies vertreibt, schoss, ihm selber kaum bewusst, ein Gedanke durch den Kopf: Zum Freunde würde er diesen Mann nie haben, ihn zu lieben, würde ihm nicht möglich sein — aber ihn zum Feinde sich machen, das müsste furchtbar und gefährlich sein.
„Es war ein eigentümlicher Fall,“ fuhr der Professor fort, „eine Nephrotomie schwerster Art mit Komplikationen — Sie verstehen — wie sie selten vorkommen. Ich wagte die Operation — alles aufs beste — Einen Tag später stirbt die Patientin an Herzschwäche. Und da kommt ein Fant von Sohn und sagt mir, der Sanitätsrat Dingsda — Glasgow heisst er — hätte von vornherein die Operation für aussichtslos erklärt und hätte sich gewundert, dass ich sie übernommen hätte! Als wenn ich nicht zehnmal gemacht hätte, was dem Glasgow Alpdrücken bereitet, wenn er es träumt —“
„Der Sanitätsrat Glasgow, Herr Professor, ist ein treuer Freund unseres Hauses, den ich verehre —“
Ein zündender Blitz unter den zusammengekniffenen Brauen, misstrauisch und fragend zuckt er über den Sprecher. „Es ist gut, dass Sie mir das sofort gesagt haben, und mit solcher Bestimmtheit. Der Name dieses Mannes ist in dieser ersten Stunde zwischen uns erwähnt worden — von nun an wird er nicht mehr über meine Lippen kommen. Aber hören Sie wohl, was ich Ihnen jetzt sage: Glasgow ist mein Feind, der grösste, den ich in dieser Stadt habe — und der unversöhnlichste —“
„Ich glaube, Sie irren, Herr Professor.“
„Unterbrechen Sie mich nicht! Ich sagte Ihnen: es ist das einzige und das letzte Mal. Mein unversöhnlicher Feind! Aus den kleinlichsten, ärmlichsten Gründen. Wer Erfolge hat, der hat Neider. Mein grösster ist Glasgow. Ich halte den Mann dazu für untüchtig. Und nun verehren Sie, wen Sie wollen, tun Sie, was Ihnen beliebt, verkehren Sie in dem Hause Ihres Freundes jeden Tag. Aber eins vergessen Sie nie: Sie sind mein erster Assistent. Und für jedes amtliche Zusammenarbeiten gilt für mich ein Wort: Wer nicht für mich ist, der ist wider mich — lassen Sie .. ich musste mich in dieser Stunde klar und bestimmt mit Ihnen auseinandersetzen. Nun aber genug. Ich spüre einen Riesenhunger, wir wollen zusammen frühstücken. Ich habe zwei schwere Operationen hinter mir, das macht Appetit. Kommen Sie!“
Merten lehnte entschuldigend ab.
„Wie Sie wollen,“ erwiderte der Professor gleichmütig, legte den weissen Operationsmantel ab, warf ihn auf einen Stuhl, wusch sich einige Male die Hände und ging dann, dem anderen den Vortritt lassend, in Hemdsärmeln die Treppe hinunter in seine Privatwohnung.
Im Vorraum erwartete ihn der Diener, zog ihm eine leichte, helle Joppe an, öffnete die Tür.
„Also, Herr Kollege Merten,“ sagte der Professor jetzt im geschäftlichen Tone, „Sie treten mit dem morgigen Tage Ihr Amt an. Sie wohnen im Krankenhause. Sie haben alle Selbständigkeit. Ich kann mich nicht um jede Kleinigkeit kümmern, aber freilich — Sie tragen auch viel Verantwortung. Ich komme jeden Vormittag zu den Beratungen und Besuchen. Bei den Operationen bin ich zugegen, in schwierigen Fällen greife ich selber ein, die geringfügigen Sachen erledigen Sie allein mit den Assistenten. Wir besprechen uns jeden Tag von zehn bis elf Uhr.“
Das städtische Krankenhaus lag inmitten der Altstadt. Es bestand aus einem hochragenden Mittelbau, in rotem Backstein ausgeführt, der in früheren Zeiten einmal als Kloster gedient haben sollte, und zwei neu ausgebauten vorspringenden Seitenflügeln, die einen mit frischem Rasen besäten und mit einigen steifen Blumenbeeten eintönig geschmückten Vorgarten zwischen sich einschlossen. Dieser wurde durch ein hohes Gitter gegen die Strasse abgesperrt.
In dem linken Flügel befand sich die geräumige Wohnung für den leitenden Arzt, die auch bisher stets von diesem bezogen war. Professor Westphal jedoch hatte sie nur einige Jahre innegehabt. Als sein Ruf stieg, hatte er es, einem starken Widerspruch im Magistrat zum Trotz, mit der ihm eigenen Zähigkeit durchgesetzt, dass man ihm eine Privatwohnung in Verbindung mit seiner Klinik zugestand und die ihm vorbehaltenen Räume im Krankenhause dem Oberarzt überliess.
Walter Merten fühlte sich in seiner grossen Wohnung, von der er nur drei Zimmer, und auch diese meist notdürftig ausgestattet, hatte, wenig behaglich. Mehr Befriedigung gewährte ihm sein Amt. Die Arbeit mit den trefflich unterrichteten und aufopfernden Diakonieschwestern war eine Freude, zumal die Oberin durch Wort und Beispiel einen Einfluss auf diese übte, der ihm zunutze kam.
Professor Westphal liess ihm völlig freie Hand. Er war froh, wenn sein Oberarzt, von dessen Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit er sich bald überzeugt hatte, ihm die meisten Arbeiten abnahm. Nur selten griff er persönlich in dessen Pläne ein, und wenn er sie durchkreuzte, so hatte Merten stets den Eindruck, als ob dies mehr aus Eigenwillen geschah, als aus der Überzeugung von ihrer Unzulänglichkeit. Immer mehr fühlte er, dass dieser Mann einen selbständigen Willen neben dem seinen nur bis zu einer gewissen Grenze ertragen konnte. Sowie er an diese gelangt war, duldete er keinen Widerspruch; schon der geringste brachte ihn in Harnisch.
Die jungen Assistenten, die unter Merten arbeiteten, waren keine grossen Künstler, aber gute, natürliche Menschen. Etwas Wunderbares war ihm gleich in den ersten Tagen aufgefallen.
Sie sassen eines Abends im Ratsweinkeller. Die Stimmung war angeregt, das Gespräch zwanglos und heiter. Wie von ungefähr brachte er die Unterhaltung auf den Professor. Plötzlich verstummte das Gespräch. Die Kollegen sahen sich gegenseitig an, wichen jeder Frage mit einer nichtssagenden Antwort aus und wussten mit Geschick die Unterhaltung auf andere Dinge zu bringen.
„Sie lieben ihn nicht. Aber sie fürchten ihn und wagen nichts über ihn zu sagen.“ Das stand ihm von dieser Stunde an fest.
Und er irrte nicht.
Als er einige Tage später mit dem ältesten unter ihnen, Doktor Möller, eine Besprechung abhielt und ihm einige Wünsche in bezug auf die Besuche und Pflege der Patienten aussprach, erwiderte dieser mit einiger Befremdung: „Das alles hat der Herr Professor niemals für nötig befunden.“
„Ich aber halte es für nötig,“ sagte Merten sehr bestimmt. Da er aber fühlte, dass seine Worte schroffer herausgekommen waren, als er beabsichtigt, setzte er begütigend hinzu: „Sie müssen sich doch selber sagen, dass jetzt, wo ich im Hause wohne und alle Verantwortung trage, vieles anders werden muss. Ich fürchte, ich werde hier sowieso keinen leichten Stand haben.“
Doktor Müller verstand ihn.
„Ich werde dafür sorgen, dass alles geschieht, wie Sie es wünschen.“
„Der Herr Professor hat sich um die einzelnen Fälle doch beim besten Willen nicht immer kümmern können?“
„Er hat zuviel ausserhalb des Hauses zu tun. Aber ich bitte Sie, keine weiteren Fragen an mich zu stellen. Meine Kollegen und ich haben uns das Wort gegeben, über Dinge, die vor Ihrer Zeit geschehen oder unterlassen sind, niemals mit Ihnen zu sprechen — vor allem nicht, sowie die Person des Chefs in Frage kommt.“
„Ich will nicht weiter in Sie dringen, es ist gut, lieber Kollege.“ — —
„Sie fürchten ihn, das ist alles!“ sagte Merten noch einmal zu sich selber. „Ich aber werde ihn nicht fürchten, und mein ärztliche Gewissen, von dem er so aburteilend spricht, will ich enger halten denn je. —
Der Morgen eines warmen, regnerischen Tages im Anfang des Mai.
Merten hatte seine Sprechstunde beendet und wollte sich eben zu einigen Besuchen in das Haus begeben, als der Sanitätswagen durch das geöffnete Tor in den Vorgarten einfuhr. Er brachte einen Maurer, der von einem hohen Gerüst heruntergestürzt war.
Er schritt sofort zur Untersuchung, die sich schwierig gestaltete, da der Mann noch bewusstlos war. Er stellte bedeutende innere Verletzungen fest, vermochte diese aber noch nicht mit Genauigkeit örtlich zu bestimmen. Eine schnelle Operation schien jedenfalls geboten. Da er aber über den Befund nicht ganz klar war und der Fall recht verwickelt erschien, wagte er nicht allein die Verantwortung zu übernehmen.
Gott sei Dank! Es war nur noch eine Stunde bis zehn Uhr. Dann musste der Professor kommen. Mit dem konnte er den Fall besprechen.
Er begab sich in das Zimmer der Oberin, um persönlich über Unterbringung und Pflege des immer noch Bewusstlosen mit ihr zu verhandeln, liess die Operationsschwester rufen und erteilte ihr die genauesten Anordnungen. Als er eben noch im Gespräch mit der Oberin begriffen war, trat der Hausmeister ein und brachte ihm einen eiligen Brief vom Professor. Merten öffnete ihn schnell.
„Der Professor teilt mir mit,“ sagte er, nachdem er seinen Inhalt durchflogen, „er könne heute erst des Nachmittags kommen, da er eine nicht aufzuschiebende Unterredung mit einem auswärtigen Arzte in einem dringenden Falle habe. — Was soll ich tun?“
Die taktvolle Oberin mischte sich niemals in ärztliche Angelegenheiten. Obwohl Merten die Frage an sie gerichtet hatte, schwieg sie.
„Kommt es öfter vor, dass der Herr Professor aus solchen Gründen fernbleibt?“
„Herr Doktor Merten,“ erwiderte die Oberin, und ihre Sprache war so ruhig wie die klaren, klugen Augen, mit denen sie ihn ansah, „Herr Professor Westphal ist mein Vorgesetzter, als solchen werde ich ihn stets betrachten und ihm gehorchen. Aber einen Rat, Herr Oberarzt, will ich Ihnen in dieser Stunde geben. Es ist der erste und der letzte. Hüten Sie sich vor dem Manne; fürchten Sie seine Feindschaft!“
„Ich danke Ihnen, Frau Oberin,“ entgegnete Merten, „Sie meinen es gut. Und doch darf ich Ihrem Rate nicht folgen.“ Und dann nach einer kurzen Pause: „Ich weiss nicht, ob ich Ihnen schon einmal erzählte, dass mein verstorbener Vater Prediger war. Aber auch meine Mutter gehörte noch zu den altertümlichen Menschen. Sie war fromm und gottesfürchtig. So haben sie beide mich erzogen bis zu ihrem Tode. Und ich wollte oft, ich hätte ihrer Erziehung mehr Ehre gemacht. Aber eins habe ich mir aus dem Trümmerhaufen eines zusammengebrochenen Glaubens in meine neue Weltanschauung hineingerettet: die Auffassung meines Berufes als eines mir anvertrauten Pfundes. Der arme Verunglückte hier ist mir auf das Gewissen gebunden. Ich kann seine Operation allein nicht verantworten. Der Professor wird kommen, das ist seines Amtes Pflicht. Ich werde ihn zwingen, verlassen Sie sich darauf.“
Er war in sein Arbeitszimmer gegangen, schrieb einige Worte, zerriss das Geschriebene wieder, brachte die Worte von neuem auf das Papier. Dann läutete er dem Hausmeister.
„Diesen Brief zum Herrn Professor Westphal, und zwar sofort. Sie bringen ihn persönlich und warten auf Antwort!“ Der Hausmeister hatte sich entfernt. Merten trat an das Fenster.
Da draussen war eine Stimmung, schwül und drückend, wie sie der Frühling sonst nicht kennt. Der Wind, heiss und trocken wie im Hochsommer, fegte den Staub über die Strasse, trug ihn in einer dichten Wolke über das hohe Eisengitter, welches das Krankenhaus ängstlich von der Aussenwelt abschloss, verfing sich zwischen den beiden Flügeln des Hauses, grollte unwirsch durch den Vorgarten.
Er hatte das Fenster geschlossen. Drückend wie die frühzeitige Schwüle da draussen lastete die Ahnung eines bitteren Kampfes auf seiner Seele.
Und er wusste, dass er in diesem Kampfe allein stand — ganz allein.
Erst nach einer Stunde kehrte der Hausmeister zurück.
„Der Herr Professor wird gegen Mittag kommen. Es soll alles vorbereitet sein.“
Und der Professor kam. Merten las ihm den Unwillen von der Stirn.
„Führen Sie mich, bitte, gleich zu dem Kranken. Ich bin wie ein gehetztes Wild. Eine Konsultation heute nach der anderen. Und so eilig hier, dass Sie nicht eine Stunde länger warten konnten? Warum übernahmen Sie denn die Sache nicht allein?“
„Weil ich es nicht wagte.“
„Sie werden hier noch ganz andere Dinge wagen müssen.“
„Nur solche, die ich verantworten darf.“
„Ach — ja so ... das Gewissen, das enge ärztliche Gewisssen, das alles bedenkt und nichts wagt! Sie kennen ja meine Ansichten über den Gegenstand, und zu philosophischen Erörterungen ist jetzt auch nicht die Zeit. Im übrigen werde ich heute kaum operieren können, wenigstens nicht bei tieferen Eingriffen. Ich habe da eine Kleinigkeit am Finger, die mich nicht so geschickt macht wie sonst.“ Und er wies auf seine Hand.
„Es ist nicht der Rede wert, es ist ja auch nur die linke Hand. Aber es stört mich, weil es unter dem Gummihandschuh schmerzt.“
„Haben Sie in den letzten Tagen Operationen gehabt?“
„Nichts von Belang. Ich musste mich zurückhalten, die letzte vorgestern in meiner Privatklinik.“
„Könnte da nicht — verzeihen Sie, Herr Professor, ich meine ... wäre es nicht denkbar, dass eine Infektion vorläge?“
„Natürlich, Sie sehen immer das Schlimmste. Kein blasser Gedanke daran.“
„Und doch, ein Eingriff Ihrerseits bei einer so schweren Operation, wie sie zweifellos hier gemacht werden muss, wäre für den Kranken bedenklich. Die Gefahr der Übertragung wäre zu gross.“
„Wir werden alles sehen, beruhigen Sie sich nur, Herr Kollege. Ich sagte Ihnen ja bereits, dass ich einen tieferen Eingriff nicht vornehmen werde.“
Sie waren durch den Vorgarten in die Vorhalle des Mittelbaues eingetreten.
Plötzlich blieb der Professor stehen. „Aber sagen Sie mal — wenn nun Leben und Tod von meinem persönlichen Eingreifen abhinge — was täten Sie dann an meiner Stelle?“
„Ich griff nicht ein.“
„Auch nicht nach gründlichster Desinfektion?“
„Auch dann nicht. Zumal dieses Entweder Oder hier gar nicht vorliegt. Sie können mir ja Ihre Anordnungen geben und mich die Operation unter Ihrer Leitung ausführen lassen.“
„Sie mögen recht haben. Ich werde mich auf eine genaue Untersuchung beschränken und, wenn Sie es wünschen, bei Ihrer Operation zugegen sein.“
Sie waren in der Poliklinik angelangt. Der Kranke, der noch wenig zum Bewusstsein gekommen war, lag auf dem Untersuchungstisch. Der Professor betrachtete ihn eine Weile. Darauf begann er die Untersuchung .. erst mit gleichgültiger Miene, dann immer angespannter, zuletzt mit einer Hingebung, einem Eifer, der von seinem ganzen Antlitz leuchtete. Es war ein Vergnügen, ihn bei der Arbeit zu sehen.
„Ein seltener Fall .. und interessant, sehr interessant. Auch noch viel zu machen. Aber schleunigster Eingriff notwendig. Und lehrreich wie nie etwas vorher. Hier können Sie mehr lernen als aus hundert anderen Fällen ... Aber das muss ich selber machen! Es geht nicht anders. Seien Sie ohne Sorge, ich werde alle Vorsichtsmassregeln brauchen.“
Merten war sprachlos.
Eben erst hatte er ihm versichert, dass er an ein persönliches Eingreifen gar nicht denke. Und jetzt — —?
Jetzt wollte er, alle Regeln der gebotenen chirurgischen Zurückhaltung ausser acht lassend, hier selber operieren, wo seine Berührung dem Kranken den Tod bringen konnte! Und das nicht etwa aus Liebe zu dem armen Opfer, das hier vor ihm lag! Sondern aus heissblütigem Interesse für den seltenen Fall, der hier vorhanden war, aus selbstsüchtiger Lust an seiner Arbeit?!
Nein, er durfte, er wollte es nicht leiden! „Herr Professor,“ sagte er ruhig, aber mit sehr bestimmtem Tone, „ich möchte Sie bitten, sich mit mir über den Befund Ihrer Untersuchung die ich ja auch bereits genau vorgenommen, ins Einvernehmen zu setzen. Ich will gern jede Weisung von Ihnen annehmen und mich genau nach Ihren Vorschriften richten — aber die Operation selber, bitte, lassen Sie mich ausführen.“
Der Professor hörte ihn nicht.
„Das geht nicht — das muss ich allein machen!“, murmelte er vor sich hin, ging in das Nebenzimmer, entledigte sich hastig seines Rockes, krempelte die Hemdärmel hoch empor und begann nun langsam und sorgfältig zuerst die muskulösen Arme, dann die Hände zu desinfizieren, die er zuletzt in Alkohol tauchte.
Merten hatte ihn noch nie so eifrig mit der Bürste reiben sehen wie in diesem Augenblick. Aber er blieb trotz alledem fest bei seinem Vorhaben, diese Operation nicht zu dulden.
Der Professor läutete nach dem Wärter: „Den Patienten sofort ins Operationszimmer! Schwester Luise soll alles bereit machen, wir kommen gleich.“
Der Kranke wurde auf die Tragbahre gelegt. Die beiden Ärzte zogen sich die Operationsmäntel an.
Eben wollte Westphal die Tür öffnen, als Merten ihm zuvor kam, die Hand aus die Klinke legte und sich ihm gegenüberstellte.
„Herr Professor — ich bitte Sie jetzt zum letztenmal, von dieser Operation abzustehen und sie mich unter Ihrer Leitung ausführen zu lassen.“
Westphal, der solche Sprache noch nie vernommen hatte, wurde stutzig. Aber nur einen Augenblick.
„Sie wollen scherzen, Herr Kollege Merten,“ sagte er dann und bemühte sich, begütigenden Humor in den scharfen Klang der Stimme zu legen.
„Gott weiss es, dass ich nicht scherze, dass es mir heiliger Ernst um meine Bitte ist.“