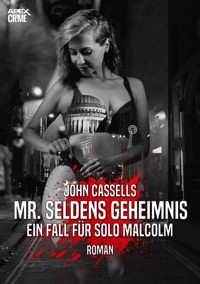5,99 €
Mehr erfahren.
Es war unerträglich heiß in Montreal. Über der Stadt lag eine drückende Schwüle, wie wir sie in England nicht kennen, eine Schwüle, die einen überfällt wie ein wildes Tier, wenn man ins Freie tritt. Ich vermied diese Hitze, wo ich nur konnte, aber ich hatte ja schließlich auch einige Dinge zu erledigen...
Der Roman Der Mann mit der roten Rose des schottischen Schriftstellers John Cassells (ein Pseudonym des Bestseller-Autors William Murdoch Duncan - * 18. November 1909; † 19. April 1975) erschien erstmals im Jahr 1960; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1961.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
JOHN CASSELLS
Der Mann
mit der roten Rose
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DER MANN MIT DER ROTEN ROSE
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Das Buch
Es war unerträglich heiß in Montreal. Über der Stadt lag eine drückende Schwüle, wie wir sie in England nicht kennen, eine Schwüle, die einen überfällt wie ein wildes Tier, wenn man ins Freie tritt. Ich vermied diese Hitze, wo ich nur konnte, aber ich hatte ja schließlich auch einige Dinge zu erledigen...
Der Roman Der Mann mit der roten Rose des schottischen Schriftstellers John Cassells (ein Pseudonym des Bestseller-Autors William Murdoch Duncan - * 18. November 1909; † 19. April 1975) erschien erstmals im Jahr 1960; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1961.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
DER MANN MIT DER ROTEN ROSE
Erstes Kapitel
Es war der sechsundzwanzigste Juni, der Tag, an dem Königin Elisabeth den St.-Lorenz-Seeweg einweihte. Die Empress legte am Morgen gegen acht Uhr an. Ich ging an Land und passierte den Zoll noch vor zehn Uhr. Alle Formalitäten verliefen schnell und reibungslos. Ich nahm ein Taxi zur Windsor Station, um mein Gepäck aufzugeben, zwei Koffer, die ich auf Grund meiner Fahrkarte gleich nach Toronto hätte weiterschicken können, wie mir der Zollbeamte geraten hatte, aber im Moment konnte ich mich nicht dazu entschließen - eigentlich nur wegen Arthur West und seiner Tochter. Es war das Schlimmste, was einem passieren konnte, wenn man im Ausland etwas für gute Freunde oder Bekannte erledigen musste, und, West war nicht einmal ein Freund von mir, lediglich der Freund eines Freundes. Trotzdem beschloss ich, seinetwegen erst den Nachmittagszug nach Toronto zu nehmen.
Es war unerträglich heiß in Montreal. Über der Stadt lag eine drückende Schwüle, wie wir sie in England nicht kennen, eine Schwüle, die einen überfällt wie ein wildes Tier, wenn man ins Freie tritt. Ich vermied diese Hitze, wo ich nur konnte, aber ich hatte ja schließlich auch einige Dinge zu erledigen.
Im Taxi war es heiß; auf dem Bahnhof noch schlimmer. Ich ging zur Gepäckaufbewahrung und ließ dort meine Koffer. Das war erledigt - ich trat wieder auf die Straße hinaus und schaute auf die Rasenflächen und Bäume des kleinen Parkes gegenüber der Station. Ich ging hinüber und setzte mich auf eine der Bänke. Neben mir saß ein alter, dicker Mann.
Ich zündete mir eine Pfeife an, lehnte mich zurück und ließ meine Gedanken schweifen. Die Sache mit Elsa West war schon sehr mühsam, noch dazu bei dieser Hitze. Aber es war vielleicht unrecht von mir, so zu denken, das Mädchen wusste nicht einmal von meiner Existenz und konnte ja auch nichts dafür, dass ich hier saß, in Tweedjacke und Flanellhemd. Ich hätte mir kurze Hosen und ein Sporthemd aus dem Koffer nehmen sollen. Aber andererseits brauchte man schließlich auch Taschen für Travellerschecks, Pass, Fahrkarte und all die Dinge, die man bei sich trägt.
Ich zog die dicke Plastikhülle, die mir das Reisebüro in Stratford gegeben hatte, aus der Tasche und breitete ihren Inhalt auf meinen Knien aus. Den Pass steckte ich zurück, auch die Travellerschecks, die in einen roten Umschlag geheftet waren, und blätterte die übrigen Zettel durch: Landekarte, Gepäckversicherung, Einschiffungspapiere, Kofferanhänger und hier, ein kleines Stück Papier, das Arthur West mir gegeben hatte. Ich glättete es ein wenig und las: Elsa West, Appartement 12, Manoir Marcoux, Dandurand Street, Montreal.
Einen. Moment lang schaute ich auf den Zettel. Arthur West hatte eine dünne, zittrige Handschrift; das könnte von einem alten Mann geschrieben worden sein. West war nicht alt. Ich schätzte ihn auf fünfzig vielleicht. Joe Tallis, der ihn mir vorgestellt hatte, hatte mir erzählt, dass West während des Krieges mehrmals operiert worden war und auch jetzt noch Granatsplitter im Körper hatte, die wunderten. Ich mochte Aufträge dieser Art sowieso nicht, und das erschwerte diesen nur noch.
Ich faltete den Zettel wieder zusammen und steckte ihn zu meinen Papieren. Dann lehnte ich mich zu meinem dicken Nachbarn hinüber.
»Können Sie mir sagen, wie ich zur Dandurand Street komme?«
Er blinzelte mich an. »Weiß nicht. Fragen Sie einen Polizisten.«
Der ist schlecht aufgelegt, dachte ich und ging durch den Park zurück auf die Straße. Ich sah einen Polizeibeamten, der auf einer Kreuzung den Verkehr regelte. Ich schaute ihm ein Weilchen zu, wie er mit seinen weißen Handschuhen so wild herumwedelte, dass man sich einbilden konnte, den feuchten Fleck auf seinem Hemdrücken wachsen zu sehen. Es schien nicht so, als würde er sich über eine Störung besonders freuen, außerdein war es geradezu lebensgefährlich in diesem Verkehr, sich zu ihm durchzuzwängen.
Ich ging also aufs Geratewohl los. Nach fünf Minuten kam ich an das erste Straßenschild. Ich las: Saint Catherine Street. Die eine Straßenseite lag in der Sonne, also ging ich hinüber auf die Schattenseite, aber selbst hier war es heiß. Nach ein paar hundert Metern kam ich zu einem Restaurant mit großen breiten Fenstern, hinter denen ich einige Männer sitzen und Bier trinken sah.
Ich ging hinein. Der Ober kam mit einem rotweiß karierten Küchentuch auf mich zu und wischte meinen Tisch ab.
»Was darf es sein?«
Ich nahm mir die Speisekarte, die auf dem Tisch lag. Es war reichlich teuer hier. Ich langte in meine Tasche und befühlte meine Travellerschecks. Sie waren, noch da. Beruhigt schaute ich mir die Karte nochmals an,
»Eine Portion Käse mit Schwarzbrot, Tomatensalat und Bier, bitte.«
Der Ober notierte meine Bestellung und ging. Ich lehnte mich zurück, um es mir bequem zu machen. Aber ich fühlte mich nicht wohl: Mein Hemd klebte mir am Rücken, auf meiner Stirn standen Schweißperlen, und meine Hände waren feucht. Ich schaute um mich. Die anderen Gäste saßen hemdsärmelig oder in leichten Anzügen da und sahen frisch und sauber aus.
Der Ober kam mit dem Bestellten, und ich begann zu essen und zu trinken. Das Bier war gut, auch verglichen mit unserem Bier in England,-viel besser, als ich erwartet hatte. Das tat gut! Nach zwei kräftigen Schlucken sah die Welt gleich ganz anders aus. Montreal war doch nicht so schlecht, und selbst die Hitze - na und, zum Teufel mit der Hitze!
Ich begann mich sogar mit Elsa West ein bisschen auszusöhnen. Nach dem Essen würde ich in die Dandurand Street gehen und ihr sagen, wer ich war. Sicherlich würde sie sich freuen, durch mich von ihrem Vater zu hören. Schließlich musste ich ihr ja nur sagen, sie solle ihm schreiben. Er war beunruhigt. Ein Brief in sieben Monaten war nicht viel.
Der Ober hatte am Nebentisch zu tun, und als er fertig war, winkte ich ihn zu mir herüber. Er machte die Rechnung fertig und legte sie verdeckt auf den Tisch.
Ich schaute sie nicht an, sondern fragte ihn stattdessen: »Wissen Sie zufällig, wo die Dandurand Street ist?«
Er dachte nach. »Dandurand Street, leider nein.«
Ich seufzte und nahm die Rechnung.
»Ich muss unbedingt dorthin, wie mache ich das nur?«
»Vielleicht mit einem Taxi? Aber es wird nicht leicht sein, heute eines zu finden.«
»Ja«, stimmte ich zu. »Sicherlich nicht.«
Ich zahlte und ging. Zwanzig Minuten, lang stand ich an der Straße und wartete auf ein Taxi - ohne Erfolg. Es fuhren wohl welche vorbei, aber voll mit Leuten, die zur Einweihung des Kanals festlich angezogen waren. Schließlich entschloss ich mich, einfach loszugehen, und nach ein paar Minuten hatte ich das Glück, einem Polizeibeamten über den Weg zu laufen. Er sah in seiner dicken Uniform nicht gerade glücklich aus. Ich sprach ihn an.
»Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir sagen, wie ich zur Dandurand Street komme?«
Er betrachtete mich genau. »Dandurand Street?«
»Sagen Sie nur nicht, Sie kennen sie nicht.«
»Doch, doch.« Er fuhr sich mit dem Finger zwischen Kragen und Hals hin und »her und sagte ärgerlich: »Das verfluchte Ding macht mich noch verrückt. Zur Dandurand Street wollen Sie? An einem anderen Tag würde ich Ihnen raten, mit einem Taxi oder dem Bus zu fahren. Heute müssen Sie schon zu Fuß gehen. Wissen Sie, wo die Dalhousie Street ist?«
»Nein, ich bin erst heute Morgen in Montreal angekommen.«
»Von woher?«
»Von England. Ich bin mit der Empress eingetroffen. Es scheint, als hätte ich mir keinen schlechteren Tag aussuchen können, aber ich wusste natürlich nichts von all diesen Festlichkeiten.«
»Ja. Sehen Sie das Zigarettengeschäft dort drüben? Gut, Sie gehen die Straße hinter dem Laden rechts hinunter. Nach drei Querstraßen biegen Sie links in die Dalhousie Street ein und gehen sie entlang, bis Sie auf die Dandurand Street stoßen. Es ist keine besonders elegante Straße, nicht einmal am Tage.«
»Wieso?«
Er tupfte sich mit einem zerknitterten Taschentuch den Schweiß von der Stirn.
»Nur so. Wenn es schon dunkel wäre, hätte ich Ihnen überhaupt nicht gesagt, wie Sie dorthin kommen. Wir haben genug Arbeit und keine Lust, uns noch mehr ans Bein zu binden.«
Er brummte und ging seines Weges.
Auch ich ging weiter, aber was er mir gesagt hatte, gab mir doch zu denken. Ich fragte mich, was er wohl gemeint haben mochte. Ich musste doch sogar für einen rauen Polizeibeamten aussehen wie ein Mann, der selbst auf sich aufpassen kann. Nach fünf oder sechs Minuten Weg kam Ich zur Dalhousie Street.
Ich war nun in der Nähe der Docks. Ich hatte den Eindruck, als sei ich heute Morgen im Taxi schon einmal hier durchgekommen, und auch da war mir schon aufgefallen, dass dies keine einladende
Gegend war: enge alte Straßen, Lädchen, die frisch gestrichen werden mussten, und Häuser, die man besser hätte abreißen sollen. Die meisten waren aus Holz, nur dazwischen standen einige schmutzige rote Backsteingebäude. Die Häuser hatten fast alle kleine Veranden mit Schaukelstühlen, und in fast allen Schaukelstühlen saßen Frauen einer gewissen Sorte.
Ich fragte mich, was ich heute wohl noch alles zu sehen bekäme, als ich auf die Dandurand Street stieß. Sie war ebenfalls klein und schmal, aber nicht so schmutzig wie die anliegenden Straßen. Auf der einen Seite stand ein Warenhaus, gegenüber ein verwahrlostes, offensichtlich leerstehendes Gebäude, aber als ich die Straße entlangblickte, fand ich, dass die Häuser sauberer und gepflegter aussahen. Rechts befand sich eine Reihe kleiner Geschäfte, an denen ich langsam vorbeiging. Ein Kolonialwarenhändler, ein Metzger, eine Wäscherei und ein Krämerladen, in dem Farbtöpfe, Schrauben, Bolzen, Handwerkszeug, Schokoladenschachteln und rosa Zellophan-Tüten mit Puffreis unordentlich durcheinanderlagen. Ich ging daran vorbei und hielt nach Manoir Marcoux Ausschau. Als ich etwa fünfzig bis sechzig Meter die Straße entlanggegangen war, hörte ich hastige Schritte und dann die schrille Stimme einer Frau.
»Komm zurück, Elsa! Komm zurück!«
Ich drehte mich um.
Auf der anderen Straßenseite lief einem großen, blonden Mädchen mit einem hellblauen Rock ein dunkelhaariges Mädchen nach, das etwas kleiner und voller war. Ich beobachtete, wie die Kleinere aufholte und die Blonde am Arm packte.
»Das kannst du doch nicht machen!«, rief sie völlig außer Atem. »Sei doch vernünftig! Bist du denn verrückt geworden? Das kannst du nicht tun.«
Das blonde Mädchen war stehengeblieben. Sie zerrte sich los.
»Du kannst mich nicht zurückhalten, Irma. Du wirst mich nicht daran hindern. Mir ist egal, was du tust.«
Das dunkle Mädchen hatte sich bei ihr eingehakt. Sie war blass, aber sah hübsch aus, trotz ihres billigen, ein wenig flitterhaften Kleides. Ich hörte sie auf die andere einreden. »Nun hör doch zu und nimm Vernunft an. Du kommst ja doch nicht los davon. Geh mit mir zurück und lass uns alles besprechen. Mir kann es gleich sein, wenn du...«
Sie senkte die Stimme, vielleicht wurde es ihr jetzt erst klar, dass jemand zuhören könnte. Sie sprach leise und hastig weiter, und ich konnte nichts mehr verstehen.
Das blonde Mädchen hatte angefangen zu weinen und ging mit zurück. Das Ganze hatte sich in weniger als einer Minute abgespielt, und ich glaube nicht, dass jemand außer mir die Szene beobachtet hatte. Ich ging weiter. Als ich mich nach ein paar Schritten noch einmal umsah, waren die beiden verschwunden.
Ich hatte das Haus immer noch nicht gefunden, als mir glücklicherweise ein Mann entgegenkam. Er sah schmuddelig aus in seinem graubraunen Hemd und dem weißen Strohhut auf seinem Kopf. Auf der Schulter trug er einen Sack aus Segeltuch und in einer Hand ein Bündel mit Briefen.
Ich hielt ihn an.
»Ich suche nach Manoir Marcoux.«
»Sie sind schon dran vorbei, auf der anderen Straßenseite ist das Saus.«
Er zeigte auf ein kastenartiges Mietshaus schräg gegenüber. Vielleicht waren die Badesteine früher einmal gelb gewesen, jedenfalls waren sie jetzt schmutzig grau. Ich bedankte mich und ging hinüber.
Tatsächlich, über der niedrigen Eingangstür hing ein altes Zementschild, und bei genauerem Hinsehen konnte ich in abgebröckelter Schrift lesen: Manoir Marcoux.
Zu beiden Seiten der Tür befanden sich Fenster, hinter deren Vorhängen ich Augen vermutete, die mich beobachteten. Das war kein angenehmes Gefühl. Ich nahm den Zettel, den mir West gegeben hatte, aus der Tasche, um mich zu vergewissern, dass ich mich nicht in der Adresse getäuscht hatte.
Aber es stimmte alles. Ich ging ins Haus und betrat einen schmutzigen Flur, von dem aus eine Treppe nach oben führte. Jemand musste hier Erdnüsse gegessen und eine Handvoll Schalen auf die Stufen geworfen haben. Ich trat darauf, als ich hinaufstieg, und hörte das scharfe Knacken unter meinen Sohlen.
Ich ging vier Stockwerke hinauf. Als ich oben ankam, klebte mir das Hemd am Rücken, und der Schweiß lief mir von der Stirn. Appartement 12 lag am Ende eines engen, schlecht beleuchteten Korridors. Ich ging ihn entlang und schaute im Vorbeigehen auf sie grau-weißen Schilder an den Türen. Ich las alle Namen und endlich den, den ich suchte.
Es standen zwei Namen an der Tür: Irma Rioux - Elsa West. Ich drückte den gelben Klingelknopf, und während ich läutete, erinnerte ich mich an die Szene auf der Straße. Ich hatte das Gefühl, hier in etwas Unangenehmes hineinzulaufen, und am liebsten hätte ich auf dem Absatz kehrtgemacht und wäre weggegangen. Aber ich blieb und wartete.
Auf einmal wurde die Tür ganz ruhig und ohne, dass ich jemand hatte kommen hören, geöffnet.
Zweites Kapitel
Das dunkle Mädchen stand vor mir. Ein Lichtstrahl vom Flurfenster her lag auf ihrem Haar. Sie war hübscher, als ich gedacht hatte. Sie hatte ein volles Gesicht und jene matte, blasse Haut, die man oft bei Frauen mit dunklem Haar und dunklen Augen findet. Sie schaute mich an und wartete, bis ich zu sprechen anfing.
»Guten Tag, Miss. Ich würde gern Miss West sprechen.«
Ein kleines Blitzen in ihren Augen erstarb ebenso schnell, wie es aufgeleuchtet hatte. Sie trat von einem Fuß auf den anderen.
»Das geht nicht.«
»Warum?«
Sie dachte kurz nach, dann antwortete sie: »Weil sie nicht zu Hause ist.«
»Wo ist sie?«
»Weggegangen.« Sie schaute einen Moment etwas hilflos aus. »Sie arbeitet. Hatten Sie etwa erwartet, sie tagsüber zu Hause vorzufinden? Sie muss ihren Lebensunterhalt verdienen.«
Ich lehnte mich an den Türrähmen. »Nehmen wir mal an, ich behaupte, dass ich Miss West vor weniger als zehn Minuten gesehen habe und dass ich es nicht mag, wenn man mich anschwindelt.« Ihr Gesicht wurde hart. »Ich verstehe nicht, was Sie meinen.«
»Versuchen Sie zu raten.«
»Ich kann nicht raten, außerdem habe ich anderes zu tun.«
Sie versuchte die Tür zu schließen, und ich stemmte meine Hand dagegen; nicht fest, lediglich um die Tür offenzuhalten.
»Einen Moment, Miss, bevor Sie zumachen, habe ich noch einiges zu sagen. Nicht etwa zu Ihnen, sondern zu Miss West. Gehen Sie und sagen Sie ihr das.«
Leichte Röte stieg ihr ins Gesicht, als sie entgegnete: »Sind Sie nicht ein bisschen unverschämt?«
»Mag sein.«
Sie zupfte mit ihren langen wohlgeformten Fingern an ihrem Haar und erwiderte ungeduldig: »Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass sie nicht da ist. Sie haben sich getäuscht. Sie können sie nicht gesehen haben.«
Hinter ihr in der Wohnung hörte ich ein Geräusch. Sie hatte es ebenso gut bemerkt und sprach daher lauter, um es zu übertönen.
»Gehen Sie jetzt, sonst rufe ich meinen Bruder.«
»Ist er zu Hause?«
»Ja.« Sie warf ihren Kopf in den Nacken. »Ich würde Ihnen raten, jetzt zu gehen.«
»Ich würde Ihren Bruder gern sehen. Schicken Sie ihn her, ich möchte mit ihm sprechen.« Ich wurde langsam ein wenig ärgerlich über all das. »Ich komme von weit her und möchte Elsa West sprechen. Ich habe keine Lust, mich hier abweisen zu lassen.«
Ihr Mund öffnete sich. Sie sagte nichts, aber in ihren Augen blitzte es wieder auf. Nach kurzem Nachdenken sagte sie: »Woher kommen Sie?«
»Von England. Ich kam heute Morgen mit der Empress in Montreal an. Ich möchte Elsa West etwas ausrichten.«
»Das glaube ich Ihnen nicht.«
Nun wurde ich ärgerlich. Ich fuhr mit der Hand in meine Tasche und zog den Umschlag mit meinem Pass und den Papieren heraus. Ich gab ihr alles.
»Bitte, meine Dame. Schauen Sie sich alles an. Glauben Sie mir jetzt?«
Sie blätterte in meinem Pass. »Michael Brandon... Größe: 1,83 m. Gewicht: 195 Pfund. Farbe der Haare: dunkel. Farbe der Augen: braun.« Sie las das alles laut vor und schaute dann auf das Passbild. »Stimmt. Sie sind es. Es tut mir leid, Mr. Brandon, ich konnte das aber nicht wissen, Elsa hat Ihren Namen nie erwähnt, er war mir neu.«
»Sie kennt mich nicht.«
»Aber Sie sagten doch...«
»Ich werde ihr alles erklären, wenn ich sie sehe. Ich bin mit ihrem Vater bekannt.
»Ach so.« Ihre Augen wurden plötzlich wachsam. »Dann werde ich Elsa das ausrichten. Sie müssen trotzdem noch einmal wiederkommen, sie ist nicht zu Hause, ich sagte Ihnen das ja schon mehrmals.«
Ich starrte sie an. Ich war mir nicht im Klaren, was das alles bedeuten sollte, und ob nicht Elsa West im Hintergrund stehen und alles mit anhören würde. Der beschwichtigende Einfluss, den das Bier auf mich ausgeübt hatte, verflog im Nu und mit ihm mein guter Wille. Ich runzelte die Stirn und sagte: »Nun gut, Miss. Sie sagen mir die Wahrheit, aber ich glaube Ihnen nicht. Sagen Sie Elsa West, dass ich dagewesen sei und dass ich wiederkommen werde, wenn es den Damen besser passt. Irgendwann heute Abend, welche Zeit würden Sie vorschlagen?«
Sie dachte einen Moment nach. »Nicht heute Abend«, sagte sie dann.
»Und warum nicht?«
»Weil ich zufällig weiß, dass Elsa heute Abend keine Zeit hat. Sie hat eine Verabredung. Sie können nicht von ihr erwarten, dass sie absagt, oder? Jedenfalls, ich sehe sie nicht vor Mitternacht. Also könnte sie gar nicht absagen, selbst wenn sie wollte, und...«
»Schon gut«, unterbrach ich sie, »also morgen, morgen Abend. Ich werde um sechs Uhr hier sein. Wird ihr das passen?«
»Ja, das müsste gehen. Ich werde es ihr sagen. Sie wird sich freuen, Sie kennenzulernen.«
»Darauf können Sie sich verlassen. Auch Sie werden sich freuen, mich wiederzusehen.«
»Nun seien Sie doch nicht böse. Ich meine das ja alles nicht so. Ich versuche Ihnen zu helfen. Sie müssen verstehen, dass zwei Mädchen, die allein leben, vorsichtig sein müssen. Woher soll ich wissen, ob Elsa Sie sehen will? Wie kann ich wissen, wer Sie sind?«
»Das ist richtig«, stimmte ich ihr zu. »Also bitte, richten Sie ihr aus, ich käme morgen um sechs Uhr. Und falls ich nicht kommen sollte, habe ich es mir eben anders überlegt.«
»Was soll das heißen?« Sie kam einen Schritt auf mich zu und schaute mich fragend an.
Gelangweilt antwortete ich: »Ich bin hier nur auf der Durchreise.
Morgen müsste ich eigentlich schon in Toronto sein. Ich weiß nicht, warum ich mich hier aufhalten lassen soll, nur um jemand einen Gefallen zu tun. Auf Wiedersehn.«
Sie schloss die Tür. Ich ging den langen Korridor zurück, verärgert und gleichzeitig reichlich verwirrt. Einen solchen Empfang hatte ich wirklich nicht erwartet, obwohl mir von Anfang an die ganze Sache etwas verdächtig vorgekommen war. Jungen Damen nachzuspüren, die von zu Hause fortgegangen waren, war nicht so recht mein Fall, und einen Augenblick spielte ich mit dem Gedanken, die ganze Angelegenheit einfach fallenzulassen. Es war noch Zeit genug, zur Windsor Station zu gehen, mein Gepäck abzuholen und den Nachtzug nach Toronto zu erreichen. Ich hätte das auch fast getan, wenn ich mich nicht an die müden, traurigen Augen von Arthur West erinnert hätte. Schließlich kam es auf einen Tag mehr oder weniger nicht an.
Ich war im Hausflur angekommen und ging hinaus auf die Straße. Die Hitze schlug mir entgegen, und ich verfluchte ganz Montreal. Ich ging langsam wieder die Straße zurück, vorbei an den Geschäften auf der anderen Seite. Die Metzgerei, die Wäscherei, der Krämerladen, an dessen Ladentisch ich einen Mann stehen und etwas aus einer Flasche trinken sah.
Ich ging hinüber und betrat den Laden. Der Besitzer war ein dünner, sehniger Franzose, mit einem langen, farblosen Gesicht und den schwärzesten Augen, die man sich denken kann. Er hatte eine Fliegenklappe in der Hand und schlug gerade auf eine Mücke los, die auf einem Stoß von Zeitschriften saß. Ohne mich auch nur anzuschauen, murmelte er:
»Was darf’s sein, Kamerad?«
»Etwas zu trinken.«
»Cola oder Ginger Ale?«
»Ginger Ale.«
Ich legte, fünfundzwanzig Cent auf den Ladentisch. Der andere trank den letzten Tropfen aus und verschwand mit einem lässigen Gruß.
Der Franzose stellte eine eisgekühlte Flasche Ginger Ale vor mich hin, ich wischte mit der Hand über die Öffnung, setzte an und leerte die Hälfte des Getränks auf einen Zug. Dann atmete ich ein paarmal tief und zündete mir eine Pfeife an. Der Ladenbesitzer saß auf einer Holzbank und schaute mir in aller Ruhe zu.
Nach ein paar Minuten begann ich ein Gespräch: »Ganz schön warm heute, was?«
Er nickte. »Ja, eine Teufelshitze. Noch ein Ginger Ale?«
»Nein, haben Sie Bier?«
Er schaute mir gerade ins Gesicht. »Was glauben Sie wohl, was das hier ist?«
»Das ist mir egal. Mir ist es heiß, und ich habe Durst. Der kleine Dicke hat Bier getrunken.«
Er senkte die Stimme. »Sie könnten ja von der Polizei sein.«
»Könnte ich. Bin ich aber nicht. Ich kam heute Morgen erst aus England an.«
Er rieb an seiner Nase.
»Es könnte noch eine Flasche im Kühlschrank sein. Aber nicht zum Verkauf, verstehen Sie? Ich habe keine Lizenz, Alkohol auszuschenken. Aber wenn natürlich einem Kunden ein halber Dollar in der Tasche hüpft, bin ich auch nicht kleinlich.«
»Das ist viel Geld für eine Flasche Bier.«
»Ja, das finde ich auch, dann lohnt es sich wenigstens.«
Ich legte fünfzig Cent auf einen Reklamebecher. Er nahm das Geld.
»Kommen Sie mit nach hinten. Das ist besser, falls einer mit besonders guten Augen vorbeigeht.«
Ich ging durch den Laden in ein dunkles, kleines Hinterzimmer, in dem drei Stühle, ein Tisch und zwei Regale voller Ramsch standen. In der Ecke war ein alter, abgenutzter Kühlschrank. Er machte ihn auf und holte zwei Flaschen heraus.
»Ich trink’ eine mit.«
Er schob mir eine Flasche über den Tisch zu. Er wischte mit der Hand über den Flaschenhals und tat einen kräftigen Zug.
Ich folgte seinem Beispiel. Es war wohl teuer, aber auch sehr gut. Ich trank die halbe Flasche aus, dann kam mir eine Idee.
»Kennen Sie die beiden Mädchen, die dort drüben wohnen?«, fragte ich.
»Wo drüben?«
Ich deutete auf das Haus. »Eine Engländerin, die West heißt und ein anderes Mädchen. Ihr Name ist Rioux.«
»Ja, die kenne ich. Manchmal kaufen sie Konserven bei mir, Lachs, Bohnen, Kompott und so was.«
»Kundinnen also. Wie sieht die Engländerin aus?«
»Warum?«
»Ich möchte es eben gern wissen.«
»Sie sind Kunden von mir. Sie könnten ihnen Unannehmlichkeiten bereiten. Was wollen Sie von den Mädchen? Sie sind doch heute erst hier angekommen.«
»Ich bilde mir ein, die eine zu kennen, und das möchte ich herausbringen.«
Er trank an seinem Bier. »Das geht mich nichts an, Kamerad. Ich kümmere mich nicht um andere Leute. Ich will keinen Ärger bekommen.«
Ich zog einen Fünf-Dollar-Schein aus meiner Tasche. Vielleicht war das hinausgeworfenes Geld, aber ich wollte es darauf ankommen lassen. »Leicht zu verdienen. Wie ist die Engländerin?«
Er zögerte. »Das ist mir zu wenig, um vielleicht dadurch Ärger an den Hals zu kriegen.«
»Mehr gibt es aber nicht.«
Er antwortete nicht. Ich wollte gerade das Geld wieder einstecken und war mit meiner Hand noch nicht halb in der Tasche, als er seine langen gelben Finger danach ausstreckte. »Ein großes, blondes Fräulein mit blauen Augen. Gute Figur. Ist sehr nett.«
Ich brachte das Geld wieder zum Vorschein. »Wo arbeitet sie?«
»Im Club Andrade. In einer Seitenstraße der Sainte Catherine Street.«
»Was ist das für ein Club?«
Er nahm die Zigarette aus dem Mund und hielt sie zwischen den Fingerspitzen.
»Eben ein... ein Club. Man kann dort auch essen.«
»Und als was arbeitet sie dort?«
»Sie ist im Büro, glaube ich. Oder vielleicht auch in der Garderobe. Fragen Sie mich nicht, mein Gedächtnis ist schwach. Jedenfalls ist das alles, was ich weiß. Das ist auch genug für fünf Dollar.«
»Danke.« Ich leerte meine Flasche und stellte sie neben mich auf den Fußboden. Es bestand kein Zweifel, dass das Mädchen, das. ich auf der Straße gesehen hatte, Elsa West gewesen war, und dass sie irgendwelche Unannehmlichkeiten hatte. Aber Mädchen kommen ja leicht in die seltsamsten Arten von Schwierigkeiten. Es sah fast so aus, als würde Mike Brandon sich hier nicht allzu beliebt machen. Na ja, so interessiert war er nun wieder auch nicht an der Sache.
Ich stand auf und ging hinaus.
Die Straße war noch ebenso verlassen wie vorher. Vor der Eingangstür von Manoir Marcoux stand ein großer, helllackierter Wagen. Ich war mir über die Marke nicht klar, da hierzulande alle Autos gleich aussahen für mich: riesig, grell und auffallend, über und über verchromt, mit Flossen, Schwänzen und dergleichen mehr. Am Steuer saß ein Mann, Er zündete sich gerade eine Zigarette an, als ich aus dem Laden kam. Er schaute zu mir herüber.
Er war jung, auf seinem dichten, dunklen Haar saß ein weißer Strohhut. Durch das offene Wagenfenster warf er das abgebrannte Streichholz auf die Straße und schaute dabei unentwegt auf mich. Ich drehte mich um, ging zur Dalhousie Street zurück und dann weiter in Richtung Sainte Catherine Street. Nach einer Viertelstunde war ich dort angelangt und nach weiteren zehn Minuten wieder auf dem Bahnhof.
Der Nachtzug war ausverkauft, also ging ich erst einmal ins Bahnhofsrestaurant, trank eine Tasse Kaffee und versuchte, die Lage zu überdenken. Es war schon spät am Nachmittag, ich würde nun doch wohl noch ein oder zwei Tage in Montreal bleiben, also musste ich mir als erstes ein Hotelzimmer beschaffen. Dann musste ich mein Gepäck aus der Aufbewahrung holen und die Kleider wechseln, denn das war allmählich höchste Zeit bei der Temperatur. Ich trank meinen Kaffee aus.
Neben dem Haupteingang in der Bahnhofshalle war eine Zimmervermittlung. Ich ging hin, um mich nach einem Hotel zu erkundigen, und die Sekretärin gab mir eine ganze Liste von Namen. »Rufen Sie am besten von hier aus an«, riet sie mir. »Die Telefonzellen sind gleich dort drüben.«
Das war eine gute Idee. Ich ging in eine der Boxen und wählte die erste Nummer auf meiner Liste. Das Hotel gehörte einem Mann, der den guten alten angelsächsischen Namen Higgins hatte, und ich freute mich über seinen Akzent, sobald ich ihn sprechen hörte.
»Sie sind also heute erst angekommen«, sagte er. »Dann werden Sie unter der Hitze besonders leiden. Sie haben ja meine Adresse. Ich muss in zehn Minuten weggehen und werde nicht vor sieben Uhr zurück sein. Kommen Sie doch dann, wir werden ein Zimmer für Sie gerichtet haben. Um sechs Uhr reist ein Gast ab.«
»Danke.« Ich legte auf und stürzte, nach Luft schnappend, aus der stickigen Telefonzelle. Es war ganz angenehm zu wissen, wo ich heute Abend schlafen konnte, noch dazu, wo Montreal von Touristen überschwemmt war. Ich holte meine Koffer, trug sie zu den Waschräumen und bezahlte bei einem alten farbigen Wärter den Preis für ein Wannenbad.
Ich ließ eine Handbreit heißes Wasser in die Wanne fließen, füllte sie dann bis oben mit kaltem Wasser und zog mich währenddessen aus. Dann stieg ich hinein, blieb eine halbe Stunde liegen, genoss das kalte Wasser und rauchte meine Pfeife. Danach stieg ich wieder hinaus, trocknete mich ab und zog mir frische Wäsche an. Ich nahm in aller Ruhe eine leichte Mahlzeit ein und trank gemütlich eine Flasche Bier. Dann war es auch schon sieben Uhr.
Ich zog die Hoteladresse aus der Tasche, die ich von der Vermittlung bekommen hatte: Harrogate House, Livernois Avenue 77, Besitzer J. Higgins.
Ich nahm ein Taxi und fuhr hin. Es war eine kurze Fahrt, und Harrogate House gefiel mir auf den ersten Blick. Es war ein großes, altmodisches Backsteingebäude mit einer Veranda, die uni drei Seiten des Hauses lief. Vor dem Hotel war ein schmaler Rasenstreifen, auf dem ein Sprenger stand, der einen feinen Sprühregen auf das Gras verteilte. Ich nahm meine Koffer und ging auf den Eingang zu, wo mir von einem kleinen gedrungenen Mann die Tür aufgemacht wurde. Er war in Hemdsärmeln, hatte ein rötliches Gesicht und ganz wasserblaue Augen. Er streckte mir seine Hand entgegen.
»Mein Name ist Higgins.«
Wir begrüßten uns. Er nahm mir meine beiden Koffer ab und führte mich. eine breite Treppe hinauf. »So, Mr. Brandon, ich habe ein hübsches Zimmer für Sie. Sie hatten Glück, das muss ich selbst sagen, der Herr, der hier gewohnt hat, musste abreisen, weil seine Frau erkrankte. Heute Abend ein Zimmer in Montreal zu bekommen ist nicht einfach.«
Er öffnete die Tür. Es war Zimmer Nummer dreizehn. Er sah, wie ich auf die Zahl schaute, und lachte: »Sie sind hoffentlich nicht abergläubisch.«
»Nicht im geringsten.«
»Das ist gut.« Er stellte die Koffer ab und schaute sich im Zimmer um. »Zwei oder drei Tage sagten Sie, nicht wahr? Sie werden sich hier wohl fühlen. Es kostet sieben Dollar pro Tag. Das Frühstück ist inbegriffen. Orangensaft, Cornflakes, Rühreier mit Schinken und natürlich Kaffee - oder möchten Sie lieber Tee?«
»Nein, nicht am Morgen.«
»Das ist gut, dann gibt es kein Durcheinander in der Küche. Sie sind eben erst angekommen? War die Überfahrt angenehm?«
»Sehr. Sie hätte nicht besser sein können.«
»Während des Krieges war ich drei Monate lang in Ottawa, dann wurde ich nach London im Staat Ontario versetzt. Danach war ich in New York und Washington.«
»Dann sind Sie ja auch weit herumgekommen.«
»Ja, ein wenig schon.« Ich legte meinen. Mantel aufs Bett. Es war kühler hier, als ich zu hoffen gewagt hatte, obwohl kein Ventilator im Zimmer stand. Higgins sah, wie ich umherschaute, und ein Strahlen machte sich auf seinem rosa Gesicht breit.
»Hübsch und bequem hier, was? Und angenehm kühl. Wir lassen die Klimaanlage Tag und Nacht laufen. Sie ist im Keller.« Er ging zur Tür. »Das wäre alles, der Schlüssel steckt im Schloss. Sperren Sie ab, wenn Sie weggehen. Mit dem Frühstück beginnen wir um sieben Uhr, aber Sie können es bis zehn bekommen. Passt Ihnen das?«
»Ausgezeichnet. Ich stehe nie spät auf.«
»Gehen Sie heute Abend noch aus?« Er schaute mich neugierig an. »Am Ende dieser Straße ist ein Vergnügungslokal, auch mit Klimaanlage.«
»Ich weiß noch nicht. Ist es mit Programm? Darauf bin ich nämlich nicht sehr versessen. Vielleicht laufe ich noch ein bisschen herum und trinke eine Kleinigkeit in einem Restaurant oder einer Bar. Ein Freund sagte mir, ich solle in den Club Andrade gehen. Kennen Sie den?«