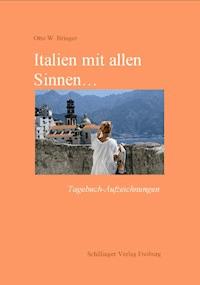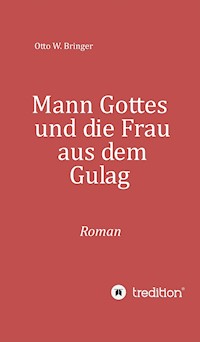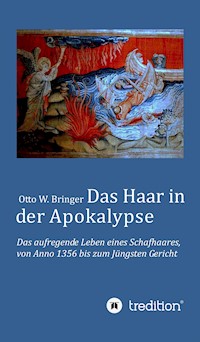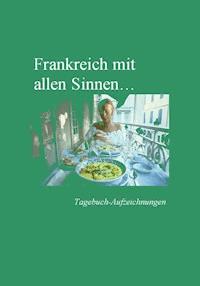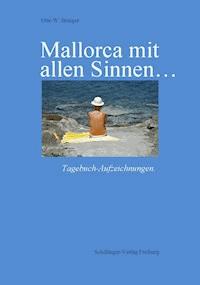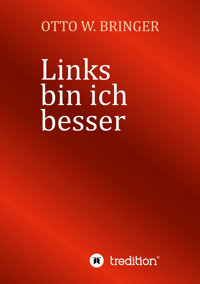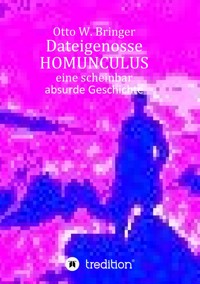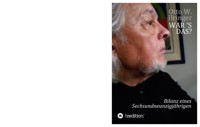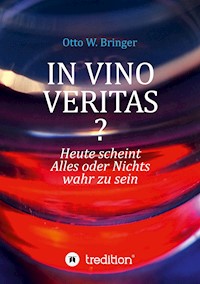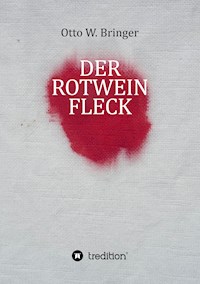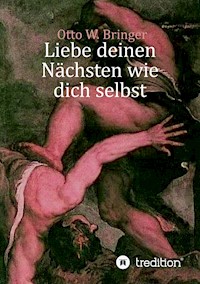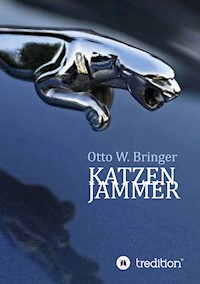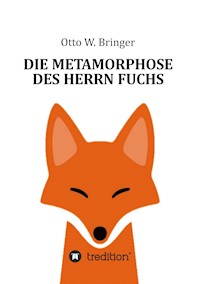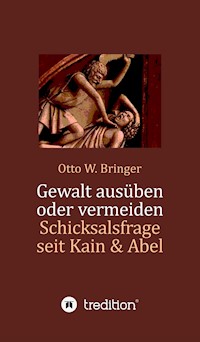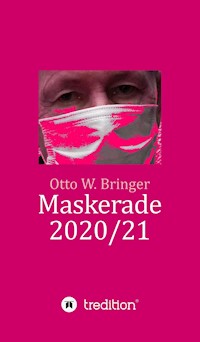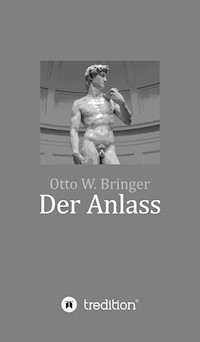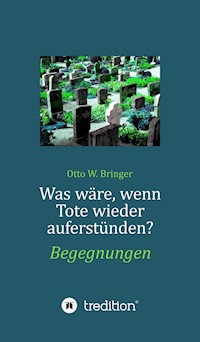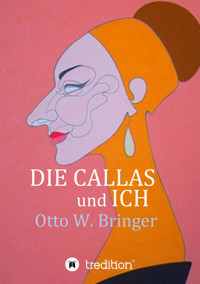
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Jeder hat eine mehr oder weniger intensive Beziehung zu einem anderen Menschen. Frau liebt Mann und umgekehrt. Manch einer seinen Beruf, um Ziele zu erreichen. Andere ihre Freizeit, sich zu entspannen, ein Hobby pflegen. Fußball, Schach oder Mensch ärgere dich nicht spielen. Aber auch in der Vergangenheit suchen und finden, was ihn begeistert. Römische Bauten z. B. oder der ägyptische Glaube an ein Weiterleben der Seele nach dem Tod. Der Autor dieses Buches liebt eine Frau, die 1977 gestorben, als lebte sie noch. Es ist ihre einmalige Stimme. Ihr erfolgreiches Leben als Primadonna Assoluta und ihre sieben Tode auf der Bühne. Ihren eigenen ersehnt, weil niemand sie wirklich geliebt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Otto W. Bringer
DIE CALLAS und ICH
© 2024 Otto W. Bringer, Weierweg 10 /3503
79111 Freiburg
Umschlaggestaltung: Otto W. Bringer
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Softcover
978-3-384-52027-2
Hardcover
978-3-384-52028-9
E-Book
978-3-384-52029-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Kapitel 1
Über den Autor
Weitere Bücher von Otto W. Bringer
Die Callas und ich
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Kapitel 1
Weitere Bücher von Otto W. Bringer
Die Callas und ich
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
„Du siehst so glücklich aus, als Du die Stimme der Callas von der Schallplatte gehört. Dieses innere Leuchten in Deinen Augen auch, als wir uns zum ersten Mal trafen. Bei der Callas ist es bestimmt ihre phänomenale Stimme, die Dich beeindruckt. Ich kam Dir damals sicher ganz anders vor als Marga, Deine verstorbene Frau. Und Dich, wie ich merkte, sofort in mich verliebt. Denn sechs Wochen lang schicktest Du mir jeden Tag ein neues Liebesgedicht per Post, bis wir uns wiedersahen.“
Diese Situation, auch diese Worte etwa habe ich behalten, als wäre es gestern erst gewesen. Rosel rief sie ihre Mutter, ich nannte sie Rose, die schönste, edelste aller Blumen und Symbol für die Liebe. Auch sie verstarb nach achtundzwanzig Jahren gemeinsamen Glücks, zu früh an einem unheilbaren Lungen-Emphysem. Sie konnte kaum noch atmen, „Ich liebe dich“ ihre letzten Worte.
Kaum zuhause, die mir von Rose geschenkte DVD mit der Callas aufgelegt. Als könnte sie mich trösten, Wollte jemand bei mir haben, der auf der Bühne oftmals den Tod singend erlebt. So überzeugend ihr Sopran, ihre Schauspielkunst, dass ich den Eindruck gewann, sie stirbt jetzt wirklich.
Vielleicht lag es an meiner musikalischen Begabung. Für mich braucht Musik keine Worte, um alles zu sagen.
Erst als ich viel später Bücher zwei zeitgenössischer Philosophen gelesen, begann ich, das Phänomen Maria Callas zu verstehen. Beide beschäftigen sich seit langem mit Ursachen und Wirkungen von Kunst und allem, was schön ist. Beim Franzosen MICHEL HENRY geht es um Kunst. In seinem Buch «Die Barbarei» weist er nach, wahre Kunst kommt nur aus dem Bauch. Nicht das Resultat eines Gedankens. Was nachweislich meist im Chaos endet, barbarisch geradezu. Anders sei das sogenannte Bauchgefühl. Wenn man etwas fühlt, nicht überlegt. Kunst entsteht auf gleiche Weise, wirkt auch ohne Worte. Werden sie gesungen, ist der Klang eines Instruments oder einer Stimme der entscheidende Faktor, nicht Worte. Die im Barock des 17. Jahrhunderts formulierten Opern-Texte sind uns fremd, kitschig oder missverständlich. Musik auf einem Instrument oder von Menschen gesungen bewegt das Gefühl derer, die sie hören.
Beim Engländer ROGER SCROUTON ist Schönheit das Thema. Auch Schönes begreife man nicht mit dem Intellekt, sondern mit dem Gefühl. Schönes sehen oder hören weckt beim Hörer oder Betrachter das Gefühl, hier bin ich zuhause. Fühle mich wohl, entspannt und aufnahmebereit für alles, was meine Emotionen auslöst. In welche Gefühle auch immer: hören, sehen oder schmecken.
Schon bin ich bei MARIA CALLAS. Die man auf ihren Höhepunkt PRIMADONNA ASSOLUTA nannte. Doch was ist die Callas ohne Bach? Beide verwandeln uns auf ähnliche Weise. Erinnere sein Oster-Oratorium, in dem der Tenor Peter Pears als Evangelist erzählte, Petrus habe seinen Herrn Jesus von Nazareth geleugnet, mit schluchzender Stimme gesungen: „und er ging und wei-ei-ei-ei-ente bitter lich.“ Nie werde ich diese Stimme vergessen.
BACH aber habe ich früher als die Callas kennengelernt. Und schon gedacht, was ist das für eine mitreißende Musik. Im Schulchor mit meiner Altstimme sein WEIHACHTS-ORATORIUM gesungen. Schon als Vierzehnjähriger gespürt, diese Musik ist ewig. Kaum zu Ende gesungen das Gefühl gehabt, es müsste doch weitergehen. Ewig wie das Perpetuum-Mobile. Nicht anders die Stimme der Callas wieder und immer wieder hören und mit ihr glücklich oder verzweifelt sein. Sofort hingerissen, als ich sie zum ersten Mal gehört. Was Bach auf Instrumenten und Orgel, bewirkte ihr einmaliger Sopran.
Beginne mit den Fakten aus Callas Lebenslauf, die ich recherchierte und überrascht, dass ihr Leben, privat und auf der Bühne mit meinem prinzipiell ähnlich, teilweise sogar identisch schien.
MARIA CALLAS kam am 2. Dezember 1923 in New York Manhattan auf die Welt. Ihr Name Maria Anna Sofia Kallegropoulos. Ihre Eltern eingewanderte Griechen. Der Vater änderte seinen Familiennamen in Callas. Sich und seine Familie schneller als sonst assimilieren zu können. Eröffnete eine Apotheke. Die Kinder lernten amerikanisches Englisch, Schule und Ausbildungsstelle besuchen und erfolgreich abschließen zu können. Ihren griechischen Namen hätte niemand richtig aussprechen können. Was aber hat alles das mit mir zu tun?
1923, dem Geburtsjahr der Callas, verliebte sich mein Vater Karl Otto Bringer in seine Kollegin Elli Kuhlenberg. Vier Jahre später geheiratet, und drei Kinder gezeugt. Ich der Erstgeborene einer Mama, die musikalisch begabt. Gut Geige gespielt und im Kirchenchor Sopran gesungen. Besuchte auch, wie ich erfuhr, die Oper. Ganz sicher die Callas hören wollen, wenn sie länger gelebt. Leider starb sie 1933 an Magenkrebs. Viel zu früh für uns Kinder, die ohne Mama aufwachsen mussten.
Mir, dem ersten von drei Kindern, vererbte sie ihre musikalische Ader. Gespeichert, wie man heute weiß, in meinem Genom. Denn schon kurz nach ihrem Tod auf Mamas Geige einfache Lieder gespielt. Später dann auf einem Tasteninstrument, einem Spinett geübt, weil es mich an Bach auf dem Cembalo erinnerte. Auf einem Klavier, das mir ein Bauer geschenkt, weil er in seiner Scheune mehr Platz für Strohballen brauchte. Dasselbe Stück ge spielt, den lauten, lang anhaltenden Klang genossen. Dann geerbt und einen Bösendorfer Flügel kaufen können. Besser geworden auch ohne Klavierunterricht. Sogar auf einer alten Orgel, deren Klänge erst zu hören waren, als Rose, meine zweite Frau den Blasebalg getreten. Luft in die Pfeifen zu blasen und so Töne hörbar gemacht.
Mein Talent wohl auch meiner zweiten Tochter Dorothee weitervererbt. Caluzza, Organist in unserer Kirche gab ihr auf meine Bitte Klavier-Unterricht. Sein Prinzip: Ein Instrument spielen muss Freude bereiten. Übte nicht, wie üblich, zuerst den Fingersatz, sondern lehrte sie verschiedene Tasten zu drücken und jeweils einen anderen Ton hören. Bald schon hellauf begeistert, spielte sie die Inventionen von Johann Sebastian Bach, besser als ich. Auch ich bin glücklich, auch wenn es nicht optimal klingt. Spiele ich auf weißen und schwarzen Tasten Bachs Toccata und Fuge in D-Moll. Oder den ersten Satz in Mozarts Sonate in A-Dur.
1933, im Todesjahr meiner Mama. war Maria Callas zehn Jahre. Ein Kind noch, das ohne Vater aufwachsen musste. Ihre Eltern ließen sich scheiden. Der Vater blieb in New York. Ihre Mutter Evangelia zog mit Maria und der älteren Schwester Sacinthy nach Griechenland. Sie blieben in Athen, der Stadt ihrer Familie seit drei Generationen. Schon bald erkannte ihre Mutter Marias große Begabung, sobald sie sang. Ließ sie am Konservatorium von der berühmten Sopranistin MARIA TREVELLE in deren Fach ausbilden. Auch sie erkannte schon beim ersten Vorsingen ihre einmalige Begabung.
Ließ sie gleich die Rolle der SANTUZA in Pietro Mascagnis Oper «Cavalleria Rusticana» üben. Bei deren bevorstehender Aufführung auf der Studentenbühne sie sich beweisen könne. Trevelle empfahl die Callas dem Leiter des Konservatoriums in Athen und fand offene Türen. Wenn diese Künstlerin eine Sopranistin empfiehlt, dann ist sie tat sächlich Spitzenklasse. Er engagierte die Callas für die Rolle der SANTUZA, die mit langanhaltendem Beifall bestätigt wurde. Überwies die Callas an die Meisterklasse des Konservatoriums, wo sie von Elvira de Hidalgo den letzten Schliff bekam.
Im selben Jahr 1938 betrat ich die Bühne wie die Callas. Nur war es die des Düsseldorfer Opernhauses. Im Chor meines Gymnasiums die Altstimme ge sungen. Nicht Sopran, wie Schüler mit hohen, hell klingenden Stimmen. Unser Musiklehrer Wolff, Gründer und Dirigent des Schulchores ein ehrgeiziger Mann. Klein von Gestalt, aber Feuer in den Augen unter buschigen Brauen. Ein Schüler-Orchester bereits vor unserer Zeit gegründet und an vielen Orten schon gespielt. Auch der Chor sollte nicht nur in der Aula unseres Gymnasiums singen, sondern der beste Schülerchor Deutschlands werden. Auch an anderen Orten auftreten und hoch gelobt werden von Besuchern und Presse.
Als erstes sang ich im Weihnachts-Oratorium von Johann Sebastian Bach. In der Aula für Schüler und deren Eltern aufgeführt. In der FAZ gelobt, sodass uns Kölner und Münchener Schuldirektoren im folgenden Jahr vor Weihnachten eingeladen.
Drei Wochen vor der Premiere von Bizets Oper CARMEN in Düsseldorf, übte Musiklehrer Wolff mit uns den Chor der Gassenjungen ein. Marschierten zur Premiere auf Kommando bunt kostümiert und dunkel geschminkt auf die Bühne und sangen mit stolz geschwellter Brust:
„Schnell herbei, so schnell wie ´s Wetter, s kommen die Soldaten da. Hört der Trompeten Geschmetter: Tättereta – tättereta!“
Auf dem Weg zur Garderobe begegnete ich Elisabeth Höngen, die die Rolle der Carmen spielte. Sah auf mich, den kleinen Gassenjungen, unter langen schwarzen Wimpern herab, als wollte sie herausfinden, ob ich ihr gefalle. Als sich dann ihre blutrot geschminkten Lippen öffneten, dachte ich, jetzt, jetzt werde ich ihre berühmte Stimme hören: „Na, mein Kleiner, dir geht es gut, alles hinter dir. Hat ‘s Spaß gemacht.“
Wolff war offensichtlich auf dem Laufenden, was den Spielplan des Opernhauses betraf. Als Wagners PARSIFAL geplant, studierten wir zwölfjährige Knäblein sofort den Chor der Engel ein. Im ersten Akt nicht auf der Bühne gesungen, sondern hoch oben unter der Kuppel des neoklassizistischen Opernhauses, quasi im Himmel. Drei gewendelte Eisentreppen aufwärts geklettert und gewartet. Nichts gesehen, nur entfernt das Orchester gehört. Bis Regieassistent Rudolf Adametz, der mit uns gekommen, das Zeichen zum Einsatz gab. Den Text vergessen, auch sonst nichts Bemerkenswertes erinnert. Anders jedoch nach der ersten CARMEN-Vorstellung. Mich nicht wie alle anderen abschminken lassen. Sondern auf der Heimfahrt mit der Straßenbahn Fahrgästen, die mich fragten, stolz geantwortet: „Komme gerade vom Theater, in der Oper Carmen auf der Bühne gespielt und gesungen.“
Rückblickend betrachtet, hat mich das Singen im Theater geradezu wie ein Virus infiziert. Mein ganzes Leben quasi ein musikalisches geworden. Mir zu Weihnachten die Schallplatte mit dem Oratorium Bachs gewünscht. Auf Papas Grammophon abspielen lassen und allen, auch Besuchern gesagt, das habe ich gesungen. Als ich ächzend und krächzend den Stimmbruch hinter mir und ein Bariton geworden, sang ich Arien, die ich in der Oper kennenund lieben gelernt.
Als Chorknaben und Mitglieder des Ensambles bekamen hin und wieder Freikarten. Mit Vierzehn die Oper «UNDINE» von Albert Lortzing gesehen und vom Schicksal des Ritters Hugo von Ringstetten als Hauptdarsteller tief beeindruckt. Kurz danach fuhren wir Kinder mit der Eisenbahn in die Sommerferien nach Österreich. Im Heim angekommen und bald schon langweilig gefunden. Beschlossen, die kürzlich gesehene Oper UNDINE mit den Kindern aufzuführen. Geeignet erscheinende Mädchen und Jungen gefragt, ob sie Schauspieler sein wollten und sofort meldeten sich fast alle. Suchte aus, die mir am besten gefielen. Die blonde Eva aus Amstetten, in die ich mich verknallt, sollte BERTALDA, die Tochter Herzogs Heinrich spielen. Ihre Rolle und die der vier anderen ein paar Tage eingeübt, so wie ich es erinnerte. Regie geführt und in der Aufführung selber die Arie des Ritters Hugo gesungen. Gerade auf dem Weg zum Schloss, Bertalda zu heiraten, als mich KÜHLEBORN, der König des Meeres hinterrücks erwischte. Mit grober Gewalt unter Wasser zog und gezwungen, seine Tochter UNDINE zu heiraten. Halb Fisch und halb Mensch. Mich graut ‘s heute noch, wenn ich daran denke, mit einem solchen Wesen zu schlafen. Auch wenn ich zehn Jahre später im ersten Semester an der Kunstakademie mit Trude, meiner Cousine den ersten echten Karneval gefeiert. Ich als Käpten in blauweiß quergestreiftem Hemd und Schiffermütze. Sie als Seejungfrau. Mit ihn die gan-ze Nacht durchgetanzt und sie vergeblich zu küssen versucht: „Lass das“, ihrer Mama, meiner Tante Maria Mahnung im Kopf: „Nun seid schön brav“.
Jahre später im Opernhaus ROSSINIS Oper «Der Barbier von Sevilla» wie eine Wiedergeburt erlebt. Ein anderer geworden. Die Arie des Baritons DON BASILIO faszinierte mich sofort und sah mich selber als Bariton und Schauspieler herausgefordert. Diese Arie auswendig viele Jahre vor Gästen gespielt und gesungen. Immer besser geworden, wie es schien. Noch als ich bereits verheiratet, meiner Frau und drei hellauf begeisterten Töchtern, Anggéla, Dorothee und Ulrike bewiesen, dass ich‘ s kann. Ein Stuhl die Bühne, auf den ich sprang, bevor ich losgelegt. Auch in Nacht-Bars und Restaurants, für alle sichtbar, auf einen Stuhl, dann auf einem ungedeckten Tisch gesprungen, gesungen, geschmettert und geflüstert.
„Die Verleumdung, sie ist ein Lüftchen – kaum vernehmbar in dem Entstehen – still und leise sein Entstehen – horch, nun fängt es an zu säuseln – immer näher, immer näher kommt es her – sachte, sachte - nah zur Erde, kriechend, schleichend – dumpfes Rauschen wie sie lauschen – und das zischende Geflüster dehnt sich freundlich aus und düster – und der Arme muss verzagen, denn Verleumdung hat geschlagen. Schuldlos geht er dann verachtet wie ein Ehrenmann zu Grund.“
Auf dem Weg zur Schule und wieder nachhause etliche Male einen Umweg gemacht. Weil er unter einer Eisenbahnbrücke führte, die wie ein rund gewölbter Tunnel aus Ziegelsteinen gebaut. Hohlraum also, wie ich aus dem Physik-Unterricht wusste, der Echo erzeugt. Als ich zum ersten Mal diese Arie sang und meine Stimme hörte, sofort begeistert. Ab da unter jeder geeigneten Brücke gesungen. Meine Stimme klang lauter, volumiger als in geschlossenen Räumen. Vom Echo um mich herum verstärkt, wie die röhrende Stimme des allseits bekannten Baritons DIETRICH FISCHERDIESKAU.
In Mimik, Gestik und Gesang muss ich überzeugend gewirkt haben. Unter der Eisenbahnbrücke nicht anders. Auch wenn keiner mir applaudiert. Einmal nur eine Oma im Rollstuhl hinter mir stehen geblieben und zugehört. Nicht geklatscht, sondern gesagt: „