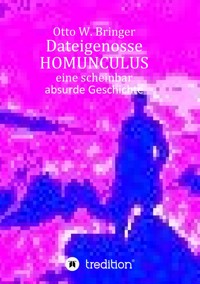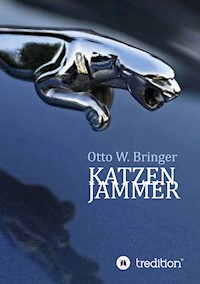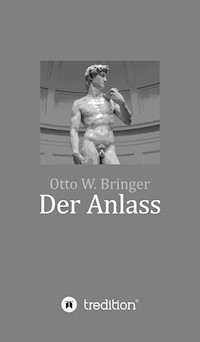3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Goethe lässt seinen Faust bekennen: "Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust." Alle Religionen basieren auf der Tatsache, dass der Mensch gut und böse sein kann. Zurzeit scheint das Gebot der Nächstenliebe nicht mehr zu gelten. Nicht einmal akzeptiert, wer anders ist. Missachtung, Hass oder Gleichgültigkeit dominieren Denken und Handeln der Menschen. Digitalisiert, sekundenschnell rund um den Globus verbreitet. Und der Eindruck entsteht, jeder ist der Feind des anderen. In diesem Buch erinnert der Autor erneut eigene Erlebnisse in der Nazizeit. Schont sich selber nicht. Nimmt aktuelle Ereignisse zum Anlass, in der Geschichte der Menschheit nach Motiven zu suchen, die Menschen bis heute veranlassen, gut oder böse zu sein. Das Böse scheint zu dominieren. Obwohl in jedem ein guter Kern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Otto W. Bringer
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst
Otto W. Bringer
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst
Das Gegenteilerlebt und recherchiertzwei Seelen auchin meiner Brust
Copyright: © 2022 Otto W. Bringer
Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Umschlaggestaltung, Fotos und deren Bearbeitung von
Otto W. Bringer.
Titelseite: Ausschnitt aus Tizians Gemälde: Kain erschlägt seinen Bruder Adam, Santa Maria della Salute, Venedig 1570 Foto Innenseite: Explosion einer amerikanischen Atombombe in Nagasaki, Japan 1945.
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
Softcover
978-3-347-68487-4
Hardcover
978-3-347-68491-1
E-Book
978-3-347-68307-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Erste prägende Erlebnisse von Gut und Böse
Das schillernde Bild der Nazizeit
Die Nachkriegszeit mit ihren Nöten und Chancen
Zum ersten Mal gespürt, ich bin ein Mann
Eingekerkert und freier denn je
Erinnert, warum Männer gewalttätig sind
Was aber macht Männer zu Despoten?
Begriffen, wie Bewusstsein entsteht
Russland überfällt die Ukraine
Spuren der Evolution in der Höhle von Lascaux
Eine Schülerin fragte mich: „Warum?“
«Rottet die Bestien aus» – eine Doku auf «arte»
Der Nürnberger Prozess gegen Nazi-Verbrecher nur einer
Bringen Waffen und technisches Gerät wirklich Frieden und Fortschritt?
Pest, Cholera und jetzt noch Corona, das Ende von allem
Was wäre – wenn?
Erste prägende Erlebnisse von Gut und Böse
Erinnere mich an einen Novembermorgen auf der Königs-Allee, Düsseldorfs Prachtstraße. Auf dem Weg zum Hohenzollern-Gymnasium, die Quinta geschafft. Kühl war es, aber nach einer halben Stunde Fußweg, den Ranzen auf dem Rücken, fühlte ich mich fit. Punkt Acht spätestens musste ich im Klassenzimmer sein. Auf die angekündigte Klassenarbeit in Latein gut vorbereitet. Schon von der Sexta an lernten wir die Sprache der alten Römer. Nicht leicht und doch schnell zu lernen. Wusste schon, Bonus heißt gut. Nicht lange danach die Idee, mich «Bonus», der Gute zu nennen. Ein guter Mensch wollte ich sein. Lernen, um nicht nachsitzen zu müssen. Lieb zu allen, um nicht verprügelt zu werden. Nach meinem Tod im Himmel meine Mama wiedersehen, sowieso. Die meisten meiner Klasse hatten einfach nur ihren deutschen Namen ins Lateinische übersetzt. Alle aber stolz, ein Gymnasiast zu sein. Karl Oswald Bauer nannte sich «Agricola». Kurt Vogel «Avis», Wilhelm Kleinebley «Parvum Plumbum» und Franz Müller «Molerus».
Ein zutreffendes lateinisches Wort für Bringer zu suchen, hatte sich erledigt. Dachte, nenne ich mich Bonus, andere mich auch Bonus rufen, werde ich von selber ein guter Mensch. Die Zwillinge Vorspel blieben bei Vorspel. Keine Ahnung warum. Wir Lateiner redeten und spielten mit ihnen, als wären sie entfernte römische Verwandte.
An diesem 8. November im Jahre 1938 brach mein kindliches Weltbild zusammen. Plötzlich Brandgeruch in der Nase. Klirren zerbrechenden Glases. Was ist da los? Männer in brauner Uniform stürzten in Häuser auf der anderen Straßenseite. Nicht lange danach fielen Möbel, sogar ein Klavier aus den Fenstern, schlugen krachend auf den Bürgersteig und zerbrachen. Schreie ertönten und Schüsse. Von der Synagoge auf der Kasernenstraße wehte beißender Geruch. Flammen schlugen gen Himmel.
Es kam mir vor wie der Weltuntergang. Erinnert den Tag zuvor, als uns Religionslehrer Cleven Bilder vom Jüngsten Gericht des Apostel Johannes gezeigt, Apokalypse heißt es. Auf Fotos von gewebten riesenlangen Wandteppichen in einem französischen Schloss. Glückliche Menschen im Himmel mit Engeln tanzen gesehen. Weil sie auf Erden Gutes getan. Unglücklich die Gesichter derer, die böse gewesen. Von Teufeln im Feuer der Hölle hin- und hergeschubst. Belohnt die einen, bestraft die anderen bis in alle Ewigkeit.
Diese Bilder im Kopf, als auf der gegenüber liegenden Seite der Kö der Teufel los. Frauen und Männer mit Koffern und Taschen. Ein alter Mann, dem einer die Krücken entriss, sodass er stürzte. Auch Kinder in meinem Alter. Alle aus den Häusern geholt, mit Schlägen in Lastwagen getrieben. Kommen die jetzt in den Himmel oder in die Hölle? Fragte ich mich. Keine Ahnung, warum die einen ängstlich und weinten. Andere redeten laut und lachten. Polizisten vor Haustüren postiert wie Erzengel. Festgenagelt, als ginge es sie nicht an. Neugierig ging ich über die Brücke auf die bewohnte Seite der «Kö», zu sehen, was genau dort passierte. Kaum drüben, sprang einer der Uniformierten auf mich zu, packte mich am Arm und schrie: „Du nicht in Uniform, kannst nur das Kind eines Juden sein!“ Bevor er mich in den schon prallvollen Lastwagen verfrachten konnte, hinter mir eine nur zu gut bekannte Stimme:
„Lassen Sie sofort den Jungen frei. Sonst werde ich Minister Göring melden, dass Sie einen unschuldigen deutschen Jungen, einen meiner Schüler verhaftet und ins Gefängnis stecken wollten.“
Gottseidank Dr. Battes, unser Klassenlehrer. In der Uniform eines Majors im ersten Weltkrieg. Die er anzog, um Nazis zu beeindruken, einen von uns zu schützen. Wie mich an diesem Morgen. Mit Orden, die er uns einmal ausführlich erklärte. Am Kragen die höchste aller Auszeichnungen: Pour le Mérite. Auf seiner Brust das Eiserne Kreuz erster und zweiter Klasse. Beide hatten eine Jahrhunderte lange Tradition. Gestiftet von Preußen-Königen für Engagement und Tapferkeit. Nicht nur in Kriegen, auch im privaten Leben als Bürger. Dr. Battes mochten wir sehr. Weil er sich für die Schwächeren einsetzte. Im Unterricht und auf dem Pausenhof.
Erinnere die Zeit als Luftwaffenhelfer. Mit Sechzehn mussten wir das Vaterland verteidigen. In Flakstellungen helfen, feindliche Bomber abzuschießen. Ein Leutnant, stellvertretender Chef, behandelte uns Schüler wie Rekruten. Begegneten wir ihm, mussten wir stramm stehen und Heil Hitler grüßen. Wehe, taten wir es nicht oder nur lässig wie nebenbei. Ließ uns zur Strafe dreißig Liegestütze machen. Eines Tages waren wir es leid und erzählten es Dr. Battes, der uns neben anderen weiter unterrichtete. Sollten das Abitur machen können. Am nächsten Tag erschien er in Uniform wie damals auf der Kö. Der Leutnant, nichts ahnend, stürmte in unsere Baracke. Überrascht, einen höheren Rang zu sehen. Riss die Hacken zusammen, dass es knallte: „Heil Hitler, Herr Major.“ „Guten Morgen, Herr Leutnant.“ Ab da bestrafte er uns nie mehr. Dr. Battes hätte es seinem Chef, Major Oebel, melden können. Und der ein überzeugter Katholik.
Andere Lehrer schwiegen zu allem, was geschah, seit Nazis an der Macht. Auch nicht über die Kristallnacht vom 7. auf den 8. November, als sie begannen, Juden zu verfolgen und systematisch zu töten. Ich selber beschloss an diesem Vormittag, mich fortan nur noch «Bonus» zu nennen. Nicht nur der Gute heißen, sondern auch Gutes tun. Wie dieser Dr. Battes. Gott möge mir beistehen.
1927, im Jahr meiner Geburt, waren die Zeiten turbulent. Der erste Weltkrieg mit Millionen Gefallenen gerade überstanden. Inflation und sechs Millionen arbeitslos. Hitler und seine Kohorten im Anmarsch. 1933 riss er die Macht an sich und erstickte von Anfang an jede Art von Opposition. 98 % der Deutschen jubelten ihm zu. Als ich nach dem Krieg von den Verbrechen der Nazis erfuhr, fragte ich mich: Haben Millionen es nicht gewusst? Und ahnungslos gejubelt?
Doch wer sich erinnert, kann es erklären. Im Wahlkampf hatte Hitler ihnen Gutes versprochen. Millionen wieder in Arbeit zu bringen. Die Ehre des deutschen Volkes nach verlorenem Krieg, der Blamage in Versailles und endlosen Wortgefechten im Weimarer Parlament wieder herzustellen. Bis 1939 erlebten die Menschen am eigenen Leibe, Hitler hatte in diesen sechs Jahren seine Versprechen eingelöst. Das Volk dankbar, wie es schien.
Sogar noch während des zweiten Weltkriegs jubelte es ihm bei jedem Sieg zu. Bis dem ein oder anderen nach der Niederlage im russischen Stalingrad die Augen aufgegangen sein könnten.
Vor Hitlers Machübernahme hatte ich die Welt um mich herum nicht wahrgenommen. In den ersten sechs Jahren nur meine Mama gespürt. Immer anwesend, kam mir vor. Auch wenn sie abwesend, einzukaufen. In der Küche kochte, im Keller Wäsche wusch. Hin und wieder hörte ich, wenn sie auf der Geige spielte. Jede freie Viertelstunde schien sie zu nutzen, ihrer Sehnsucht Töne zu verleihen. Jeden Abend, erinnere es genau, spielte sie an meinem Bettchen und sang mich in den Schlaf: „Guten Abend, gut Nacht, von Englein bewacht, die zeigen im Traum, wo Christkindels Baum, schlaf nun selig und süß, schau im Traum ’s Paradies.“
Nur «Guten Abend, gut Nacht» erinnert, nicht den ganzen Text. Süße Geigentöne und sicher bald auch eingeschlafen. Das bekannte und beliebte Lied komponiert von Johannes Brahms. Sofort an Mama denken müssen, als uns in einem Urlaub an der Loire Mischa Maisky, ein berühmter russischer Cellist und Karl Richter nach einem Brahms-Konzert mit diesem Lied als Zugabe zurück ins Hotelbett schickte.
Mit sechs Jahren kam ich in die Grundschule, Freute mich, eine riesengroße Schultüte zu bekommen. Nur Mama plötzlich nicht mehr da. Keine Geige gehört. Das Rascheln ihres Kleides, wenn die Tür zu meinem Zimmer aufging. Statt Mama führte Großmama, Papas Mutter, den Haushalt. Sagte nicht, warum. Niemand sagte mir warum. Auch ich scheute mich, warum zu fragen. Es schien etwas Schlimmes passiert zu sein.
Ab da war „Warum“ für mich das wichtigste aller Worte. Bis heute frage ich: Warum sind die einen gut und andere böse? Warum bringt niemand diesen Putin um? Weil Töten eine schwere Sünde ist? Komisch die Religion, komisch die ganze Welt. Ausreden und Widersprüche, nie eine alles erklärende Antwort auf die einfache Frage: WARUM?
Heute vermute ich, damals wollten Papa und seine Mutter mir nichts sagen. Mich und die kleineren Geschwister nicht erschrecken. Waren selber noch schockiert. Das Wort Tod damals vermieden, wie heute wieder. Nur Tante Aloysia, Mamas Schwester, erzählte mir viel später, als ich sie besuchte: „Deine Mama war sehr krank. Gott hat sie zu sich in den Himmel gerufen. Um ihr lebenslange Schmerzen zu ersparen.“
Ab da besuchte ich mit Karl, meinem zwei Jahre jüngeren Bruder, die Tante und ihre Mutter, die wir Schützen-Oma nannten. Weil sie damals auf der Schützenstraße wohnten. Sonntags hin und zurück mit der Straßenbahn. Auf dem Hinweg Grießknödel im Kopf und das wohlige Gefühl im Bauch, sie lieben uns. Wir liebten sie auch, endlich zuhause. Fast wie früher bei Mama. Auch wenn dieses Zuhause nur zwei oder drei Stunden währte. Völlig entspannt und frei, unsere kleine Welt wieder in Ordnung.
Damals fand ich ihre Wohnung schöner als unsere. Möbel aus dem Biedermeier, bequeme Sessel und ein frei stehendes Möbel mit einem Grammophon. Der Tisch gedeckt mit feinem Porzellan. Später erfuhr ich, es stammte aus Meißen, das echt silberne Besteck von Christofle in Paris.
Jeder Besuch gipfelte in einem Mittagessen. Oma kochte, seit wir einmal bei ihr zu Mittag gegessen und es sehr lecker fanden. Ab da bei jedem Besuch für uns ausgehungerte Buben dasselbe: Grießknödel mit Gulasch oder Aprikosenkompott. Zum Nachtisch Grießpudding mit Schokoladensoße oder frischem Obst. In ihrer Vorratskammer mussten Säcke mit Grieß gelagert haben. Wir stopften alles in uns hinein, bis wir nicht mehr Papp sagen konnten. Satt bis zum nächsten Morgen. Lange noch die Stimme Beniamino Giglis im Ohr. Während des Essens immer nur «O sole mio» gehört. Die Platte muss einen Riss gehabt haben, die Nadel in derselben Rille gekreist. Nichts verstanden, aber alle am Tisch glücklich gemacht.
Einmal ging ich hin, den Deckel zu heben. Wollte wissen, ob in so einem kleinen Möbel wirklich ein erwachsener Mann sitzt. Die Tante fürchtete Schaden und befahl mir, den Deckel wieder zu schließen. Ich sei noch zu klein, um es zu verstehen. Später einmal würde ich mir selber ein Grammophon kaufen. Wissen, wie es funktioniert.
Weihnachten «Stille Nacht, heilige Nacht» gehört, laut Tante Ali vom Thomanerchor in Leipzig gesungen. Eines Tages kaufte auch mein Papa ein Grammophon. Kleiner als das der Tante. Auf einem Tischchen neben seinem Ohrensessel. Zeigte mir, wie man es macht. Erst mit einem Schwengel aufziehen, damit es sich drinnen dreht. Die Schallplatte auf den Teller legen, einschalten, auf die schon laufende Platte die Nadel des Tonkopfes setzen, und dann erst erklang Musik. Sehe ihn noch vor mir. Jeden Tag nach Feierabend in seinem Ohrensessel mehr liegen als sitzen. Robert Schumanns «Rheinische Symphonie» mit geschlossenen Augen genießen.
Zurück zum Weihnachts-Besuch bei Oma und Tante Ali. Kerzen auf dem Tisch, eine Christrose in grüner Keramik-Schale. Neben unseren Tellern ein Geschenk, gewickelt in Weihnachtspapier. Immer ein Buch, das wir uns gewünscht. An normalen Sonntagen im Jahr glücklich über das blinkende Markstück, das sie jedem von uns zum Abschied schenkten. Heute denke ich: Es ist doch so einfach, lieb zu anderen zu sein. Warum, ja warum scheinen nur so wenige bereit zu sein, Gutes zu tun? Lächeln wenigstens, wenn sie jemandem vorgestellt werden, auch wenn sie ihn nicht gerade sympathisch finden.
Wissen erworben in neun Jahrzehnten und zurück erinnert: so einfach war es damals nicht. Nach Mamas Tod stellte Papa eines Tages seine neue Frau vor: „Sagt Mutti zu ihr.“ Und alles, wirklich alles, war plötzlich anders als früher. Von Liebe und wohligen Klängen verwöhnt, hörte ich jetzt zum ersten Mal das Wort Böse. Warum, fragte ich mich, wer oder was ist denn böse in unserer Familie? Sind wir Kinder die bösen? Oder Papa, der nach Heimkehr aus dem Büro mich zuerst ohrfeigte, bevor er ins Bad ging, die Hände zu waschen. Sie muss ihm an der Tür schon gesagt haben, ich hätte in der Nase gebohrt, also böse gewesen. Nasebohren gehöre sich nicht, auch wenn es keiner sieht.
Ein andermal Kirschen vom Baum in unserem Gärtchen gepflückt und gegessen. Zweier übers Ohr gehängt. Ich also böse gewesen? Meine Stiefmutter: „Kirschen gehören ins Einmachglas, merk dir das.“ Befahl mir, die Hose runterzulassen und verprügelte mich mit einem Rietstock. Stets griffbereit, zwischen Schrank und Wand. Es schmerzte sehr und machte mich wütend. Froh, als mir ein Klassenkamerad den Tipp gab, den Stock mit einer Zwiebel einzureiben. Er zersprang gleich beim ersten Schlag in einzelne Faser. Zur Strafe bekam ich drei Abende nichts zu essen.
War sie jetzt böse, weil sie mich hungern ließ? Oder ich, weil ich sie ärgern wollte? Kirschen aus unserem Garten gehören doch der ganzen Familie. Also auch mir. Oder? Sie muss alles anders verstanden haben als ich. Mich auch gezwungen, Vorbild für die jüngeren Geschwister zu sein. Als Ältester sei ich dazu verpflichtet. In allem, was ich tat oder lassen musste. Z. B. vom Backblech ein Plätzchen naschen. Aber nach dem Mittagessen das ganze Geschirr spülen, den Herd blank wienern, zuletzt den Linoleumteppich in der Küche bohnern. Erst etwa ab Vier Zeit, Hausaufgaben zu erledigen. Nicht selten bis zum Abendessen geschrieben oder auswendig gelernt. Keine Zeit zu spielen oder ein neues Lied auf der Mundharmonika zu üben. Nahm es hin, wenn ich daran dachte, dass ich Bonus heiße. Fragte mich aber, bin ich auch gut, wenn mich die Stiefmutter dazu zwingt? Ich ihr den Gefallen tue, aus Angst bestraft zu werden? Andere werden es so verstehen, wie sie es beobachten. Ich aber machte mir meine Gedanken.
Mit Zehn durfte ich als Messdiener Priestern am Altar assistieren. In knöchellangem Rock und weißem Chorhemd in der Messe vor Publikum eine Rolle spielen. Tolles Gefühl, fünf Stufen höher als die Gemeinde zu agieren und bewundert zu werden. Wein und Wasser reichen, das Messbuch samt Ständer von der rechten auf die linke Seite des Altars tragen. So schwer es auch war. In Hochämtern das Weihrauchfass schwenken, sodass es sich fast überschlug. Dampfte wie eine Lokomotive.
Den typischen Geruch von Weihrauch nicht mehr vergessen. Jahrzehnte später in Palma de Mallorca wieder in der Nase. An einem der beiden Weihnachtsabende lockte uns klassische Musik in eine barocke Stadtvilla. Beschlossen, dort diesen Abend zu feiern. Kaum in der hohen Halle, den typischen Odeur von Weihrauch in der Nase. Vom offenen Kamin herübergeweht. Dahinter auf einem Postament vor aprikosenfarbenem Fond ein marmorweißer Apoll. Der Gott der Künste hieß uns mit erhobenem Arm willkommen. In den Ohren Händels Halleluja. So herzbewegend wie nie zuvor. Sogleich fühlten wir uns beschenkt und blieben bis nach Mitternacht. Verwöhnt mit Wein der Insel und Selbstgebackenem. Frisch gepflückten Orangen und Aprikosen mitten im Winter. Gerade geerntet und geröstete Mandeln geknabbert Bei angenehmen 18 °C frühlingshafter Temperatur.
Langweilig damals die Andachten am Nachmittag. Als Messdiener gezwungen, eine volle Stunde am Altar zu knien. Erst beim Kommiss wieder meine Knie gespürt wie damals. Der Gottesmutter Maria zuliebe zweimal vier Wochen im Jahr, in Mai und Oktober. Jeden Nachmittag nichts anderes tun müssen als eine Stunde lang knien. Vor dem Altar mit dem Rücken zur Gemeinde. Keine Lust, diese nie enden wollende Stunde mit Nichtstun oder Beten auszuhalten. Tante Alis Bücher lösten das Problem. Nahm «Die Abenteuer Huckleberry Finn» mit. Versteckte das Buch, bevor die Andacht begann, im weiten Ärmel des Chorhemdes. In einer Woche hatte ich es ausgelesen. Traurig, als wäre es mir selber passiert. Huck und sein Freund Tom haben sich nie wiedergesehen.
Niemand hatte gemerkt, dass ich getan, was sich nicht gehörte. Ob ich böse war? Im Sinne der Kirche gesündigt? Auch in der Fastenzeit, unbemerkt von der Stiefmutter, auf dem Spielplatz ein, zwei oder auch mehr Bonbons gelutscht. Am liebsten Lakritz und Karamell. Vom Taschengeld gekauft. Ebenso einen Pons, winzig kleines Wörterbuch. Während der Klassenarbeit konnte ich, unbemerkt vom Lehrer, unter dem Pult das gesuchte lateinische Wort finden. Fragte mich einmal, muss einer mich beim Fuschen oder Nasebohren erst erwischen, damit es eine Sünde ist? Hätte es keiner gesehen, wäre es keine? Muss ich alle Verbote kennen, um Böses zu vermeiden? Die zehn wichtigsten Gebote der Kirche auswendig lernen? Wer eines von ihnen missachtete, sündigte und musste es beichten. Damals gemeint, sie gelten nur für Erwachsene, bis auf Lügen und Stehlen. Fühlte mich als Pubertärer nur meinem selbst gegebenen Versprechen verpflichtet. Den meisten Geboten meiner Stiefmutter folgte ich, Strafen zu vermeiden. Fragte mich damals aber, warum es zehn Gebote und nicht Verbote heißt. Du sollst nicht stehlen deines Nächsten Hab und Gut. Wer stiehlt, sündigt und muss es beichten.
Mich auch gefragt, warum ist sie so streng? Bemerkte immer mal wieder ungefragt, sie befolge Gottes Willen und den seiner Kirche. Woher wollte sie es wissen? Pastor und Kaplan hatten sich nie in familiäre Angelegenheiten gemischt. Gott selber ein Geist, niemals gesehen, außer auf Bildern. Nie seine Stimme gehört. Außer der seines Stellvertreters auf Erden. Dem Papst, der in Rom Weihnachten und Ostern alle Leute auf dem Peterplatz und in der Welt segnet. Beide Hände erhoben und so was wie «urbi et orbi» sagt. Auch meine Stiefmutter äußerte sich ähnlich unverständlich. Gesagt aber nie, woran man erkenne, dass Gott es so gewollt. Für sie, dachte ich Jahrzehnte später, war alles Sünde, was nicht in ihr Weltbild passte. Und das ihrer Eltern, die sie erzogen. Kirche und patriarchalisches Gehabe der Männer prägten die Gesellschaft bis in die 1960er Jahre. Auch heute noch, dass Gott erbarm.
Eines Samstags ging ich, zu beichten. Schweren Herzens meine Sünden einem fremden Mann zu bekennen. Denn im Beichtstuhl ein neuer Kaplan, Namen vergessen. Aber nicht, was er mir sagte. Meine gebeichteten Sünden seien, wenn überhaupt, nur lässliche Sünden. Zehn Vaterunser als Buße kein Anreiz, sie zu vermeiden. Besser sollte ich mir vornehmen, anderen dafür einen Gefallen zu tun. Meine Stiefmutter entlasten, den schweren Wäschekorb aus dem Keller bis zur Wohnung auf der ersten Etage tragen. Oder meinem jüngeren Bruder Karl in Mathe helfen, Schwesterchen Elisabeth im Kinderwagen spazieren fahren. Auch wenn ich keine Lust darauf hätte.
Er schien sich gut informiert zu haben, bevor er mit Mitgliedern seiner Gemeinde redete. Sein Vorgänger nuschelte nur vor sich hin. Musste immer zehn Vaterunser und zehn Avemaria als Buße beten. Dann seien mir meine Sünden vergeben. Selten alle zehn gebetet, und wenn, heruntergerattert. Ob der liebe Gott mir deshalb meine Sünden trotzdem verziehen? Wenn ich mich erleichtert gefühlt, wie nach bestandener Prüfung, hätte ich es gemerkt. So aber dachte ich: Ach was, ein Gott kann doch nicht böse sein, sonst wäre er kein Gott.
Später hörte ich von Klassenkameraden, Marin Luther löste sich von Rom und gründete eine eigene Kirche. Predigte: Gott ist ein gnädiger Gott. Er weiß, wir Menschen sind schwach und verzeiht uns, wenn wir fehlen. Die Beichte der Katholiken sei überflüssig. Von Mord oder Krieg als Sünde hat er nie gepredigt oder geschrieben, soviel ich weiß. Obwohl zu seiner Zeit der Dominikanermönch Savonarola verbrannt wurde, weil er wie Luther Rom heftig kritisierte.
Noch aber ging ich beichten. Von der Stiefmutter daran erinnert. Gehorchte, weil ich geschworen, ein guter Junge zu sein. Doch bald schon gemerkt, es gab Schlimmeres als Nasebohren, Kirschen klauen. Einer der Mieter in unserem Haus ein SA-Mann in Uniform. Jeden mit erhobenem Arm mit „Heil Hitler.“ gegrüßt. Verriet einen Witwer, der mit einer Jüdin verheiratet war, an die Geheime-Staats-Polizei. Soll ins KZ geschleppt und zu Tode geprügelt worden sein. Nicht lange nach dem Krieg wusste ich, Hitler hat in seinem Größenwahn nicht nur Abermillione Menschen ermorden lassen. In den Gehirnen leider allzu Vieler unermesslichen Schaden angerichtet haben. Rechtsnational scheint heute wieder salonfähig zu sein. Das Böse, wie lange nicht, allgegenwärtig. Sodass ich den Eindruck gewann, das Böse regiert die Welt. Doch nochmal
zurück ins Jahr 1937.
Gerade Zehn geworden, musste ich ins Büro der Hitlerjugend auf der Friedrichstraße. Sollte eine Uniform bekommen. Das komische Gefühl im Bauch, jetzt wird es ernst. Ab Zehn mussten alle Jungens lernen, es gibt Größeres, Wichtigeres als Schule und Spielplatz. Mit Zehn im Jungvolk ein Pimpf, mit Vierzehn ein Hitlerjunge, Führer und Vaterland zu dienen. Überrascht, als ich in dem Büro zuerst alles bis auf die Unterhose ausziehen musste. Quasi nackt zwischen Uniformierten, ihren neugierigen Blicken ausgesetzt. Anprobiert und solange gewechselt, bis alles einigermaßen passte.
Braun das Hemd mit roter Armbinde am rechten Ärmel. Schwarz das Hakenkreuz im weißen Kreis. Kurz die Hose aus schwarzem Cord. Mit einem breitem Lederkoppel um die Taille geschnallt. Ein schmaler Lederriemen noch, schräg von links nach rechts über die Schulter vorne und hinten ans Koppel gehakt. Zum Schluss setzte mir der Leiter des Büros ein Käppi schräg auf den Kopf. Schob mich vor den Spiegel und sagte:
„Sieh dich an, schnell wie ein Windhund, zäh wie Leder und stark wie Kruppstahl. Unser Führer wird stolz auf dich sein, bist Du so, wie er es erwartet.“ Lange nach dem Krieg sah ich eine TV-Doku über den Auftritt Hitlers auf einer Veranstaltung der Hitlerjugend. Brüllte diese Worte ins Mikrophon, Schaum vor dem Mund. Es klang wie ein Befehl. Und alle einverstanden im Chor: Heil! Heil! Heil!
Damals im HJ-Büro kam ich mir vor wie kostümiert an Karneval. Oder einer der Leute im Zirkus. Eine Woche vorher im Zirkus-Krone gewesen. Ein Clown in braunem Hemd und Hose, schwarzen Stiefeln auf einem Esel. Das Langohr weigerte sich, einen Schritt voran zu gehen. Der Clown stieg ab, streichelte seinen Rücken von Kopf bis Schwanz. Hob ein Ohr und redete ihm gut zu. Kaum wieder oben, bockte der Esel zuerst, trabte dann aber im Galopp davon. Der Clown erschrocken, versuchte sich festzuhalten. Purzelte aber alle Nase lang herunter. Mal links, mal rechts. Sprang immer wieder auf, lachte und schrie: „Heil … heil … heiliger Geist hilf mir.“ Lieber wäre ich ein Clown gewesen als ein Hitlerjunge, Dann hätte ich die Leute zum Lachen gebracht. Und damit Gutes getan. Ahnte aber Schlimmes.
Schon als Pimpf drei Stunden wöchentlich quasi militärisch gedrillt. Jedes Mal hatte ich Angst, musste ich mich auf den Boden werfen. Auf felsigem Gelände könnte ich mich verletzen. Die Kniescheibe kaputt und kein Messdiener mehr sein. Dann auf Befehl wieder aufstehen, weiter laufen und erneut auf den Boden werfen. Und das bis zu zehn Mal, mindestens. Auf Bäume klettern, von ca. zwei Meter hohen Ästen herunterspringen. Durch reißende Bäche waten. Abhärten die Parole. Immer nur sportlich, nie den Geist trainiert. Außer NS-Parolen.
Eines Tages war ich es leid, klagte der Frau meines Papa mein Leid. Und plötzlich war sie nicht mehr die böse Stiefmutter. Fragte mich nach meinem Vorgesetzten und telefonierte mit ihm. Karl-Heinz Vitten damals mein Fähnlein-Führer. Ich sei an Grippe erkrankt und müsste mindestens drei Wochen das Bett hüten.
Nach dem Krieg traf ich Vitten zufällig. Er Redakteur bei den «Düsseldorfer Nachrichten», ich studierte noch im letzten Semester. Erkannte mich sofort und sagte: „Ich hab ’s nicht geglaubt damals, aber verstanden. Alle mussten schwindeln, wollten sie glimpflich davonkommen. Wie geht es Deiner Mutter?“
Damals konnte ich es nicht fassen, glücklich wie schon lange nicht. Als ich sie umarmen wollte, distanzierte sie sich von mir und sagte: „Hab nur meine Pflicht getan. Geh und mach deine Hausaufgaben.“ Ob sie doch mütterliche Gefühle hatte? Zum ersten Mal nach vier Jahren entschloss ich mich, der zweiten Frau meines Papa eine Freude zu bereiten. Weil sie Gustel hieß, zum nächsten Namenstag ein Bild des Heiligen Augustinus zu schenken. Er war ihr Namenspatron. Postkarten von Heiligen gab es in der Buchhandlung Bierbaum. Sah sie im Schaufenster auf dem Weg zur Schule und zurück.
Klebte die Karte auf goldenem Karton und rahmte es ein. Mit Profilleisten aus dem Bastelladen. Sie bedankte sich wie immer. Deutete eine Umarmung an, indem sie mit der Hand meine Schulter berührte. Ernst ihr Gesicht: „Dank dir Otto.“ Keine Ahnung, dass ich mich Bonus nannte. Ob ich es ihr einmal sage? Sie bitte, mich Bonus zu rufen?
Ab Vierzehn nicht mehr ein Pimpf, sondern ein Hitlerjunge und angehender Mann. In HJ-Uniform so wie vorher, aber bewaffnet mit einem Dolch am Koppel. Interessant, dachte ich, auf tagelangen Fahrten in wilder Natur sicher praktisch. Schnitt probehalber mit der scharfen Klinge Zweige von Ästen. Schnitzte aus einem vom Holzhändler geschenkten Holzklotz eine Art Portrait meines Papas.