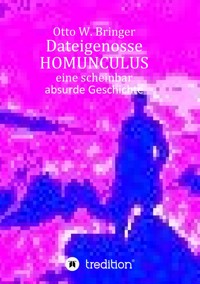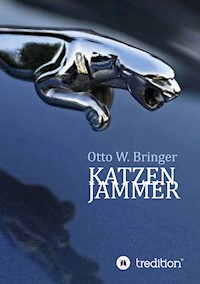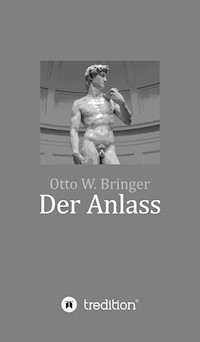3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ferdi Fuchs ist ein junger Mann, der in einem Waisenhaus aufwuchs. Elterliche Zuwendung und Liebe hat er nie erfahren, nur beten müssen und gehorchen. Nichts zu Ende gelernt. Sein erster Job ist als Hilfsarbeiter in einer Baufirma. Er wird von den Kollegen gehänselt und nicht für voll genommen, ist aber fasziniert von der Villa, an der sie arbeiten, möchte selber darin wohnen. Er verliebt sich in die hübsche Tochter des Hausbesitzers und ist besessen von der Idee, sie für sich zu gewinnen. Dafür schlüpft er in Rollen, die er in Groschenromanen gelesen hat, und stellt sich als Baron Fernando von Fuchs vor. Er scheitert, als er glaubt, mit Geld Liebe kaufen zu können. Die Frau aber, die er liebt, ist auf seltsame Art auch ihm verfallen. Als es ihr bewusst wird, ist es zu spät ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Otto W. Bringer
Die Metamorphosedes Herrn Fuchs
Copyright: © 2022 Otto W. BringerSatz: Erik Kinting – www.buchlektorat.netUmschlaggestaltung u. Fotobearbeitung: Otto W. Bringer
Verlag und Druck:tredition GmbHHalenreie 40-4422359 Hamburg
Softcover
978-3-347-60312-7
Hardcover
978-3-347-60313-4
E-Book
978-3-347-60314-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
26. März 1956
Was macht ein junger Mann, der Kindheit und Jugend in einem Waisenhaus verbracht? Gehorchen musste, ohne zu wissen warum. Glauben musste, was man ihm eingeprügelt. Liebe nie erfahren, nur Zwänge. Keinen Beruf erlernt, mit dem er genug verdient, sich einiges zu leisten und eine Familie zu unterhalten. Ferdi Fuchs heißt dieser junge Mann. Mit Zwanzig schlecht bezahlter Handlanger in einer Baufirma. Auch da gehänselt und ausgenutzt. Kaufte sich vom ersten Lohn einen Groschenroman und verschlang ihn. Bald wusste er, es gibt ein anderes Leben. Eines, in dem ein Baron viel Geld besitzt, ein Schloss bewohnt und Weltreisen unternimmt. Respekt genießt und gesiezt von jedermann. Mit einer Prinzessin glücklich verheiratet. Nicht verwunderlich, dass Ferdi auch so einer sein will, eine Art Doppelleben führen. In dem er respektiert wird. Überzeugt, auch Liebe kaufen zu können. Nicht ahnend, dass Geld schon bald seinen Traum von Liebe und Glück zerstört.
Aber erst mal wird an diesem Montagmorgen aus dem schüchternen, ängstlichen Waisenkind einer, der weiß. was er will. Ferdi Fuchs, Hilfsarbeiter für lächerliche 150 Mark die Woche, im Lotto immer auf dieselbe Zahl gesetzt, jetzt 3000 Mark gewonnen. Sogleich sich geschworen, jetzt ist Schluss mit der Duzerei. Endlich habe ich die Chance, ein besseres Leben zu führen. Besitze jetzt das Zwanzigfache des Wochenlohns. Und Geld ist Macht, irgendwo gelesen. Wer Geld hat, muss sich nichts mehr gefallen lassen.
„Alle mal herhören, ich habe im Lotto 3000 Mark gewonnen!“ In den Gesichtern der anderen ungläubiges Staunen. Oder ist es Neid?
„Als ich Samstagabend meinen Zettel im Lotto-Geschäft abgab, sagte die Frau zu mir: Guten Tag Herr Fuchs, ich gratuliere Ihnen, Sie haben 3000 Mark gewonnen.“
„Was soll sie denn sonst sagen? Kennt Dich ja nicht wie wir Dich kennen.“
Das war das letzte Mal, dass Sie mich geduzt haben. Jetzt ist endgültig Schluss damit. Ab heute bin ich Herr Fuchs. Nicht mehr Ferdi, den Sie Handlanger nennen. Steine schleppen lassen, sauber machen, für das Sie sich zu fein sind. Ab heute bin ich Herr Fuchs und reich. Kann mir sogar eine Weltreise leisten. Jeder, der mich jetzt nicht mit Herr Fuchs anredet, der kann seine Steine selber schleppen.“ Der Ton bei Leuten vom Bau rau, nicht ernst genommen, Diesmal aber ist es anders.
Dieselstotternd, Auspuffdampfend aus vier Rohren rollt ein Autokran in Richtung Villa. Letztes Gebäude an der Straße nach Kaiserswerth. Drei Bauarbeiter mit dem Anbau eines Wintergartens an eine Villa beschäftigt. Zwei erfahren in Mauerbau und Verputz. Meister Albert der Chef des Teams. Ferdi Fuchs will nicht mehr als Handlanger behandelt werden, seine Vergangenheit vergessen.
Jetzt ist er ein reicher Mann und wird eine Weltreise machen. Zuerst in ein Reisebüro gehen und fragen, wie weit man mit 3000 Mark kommt. Sein Lieblingsziel Ägypten. In einer Buchhandlung gelesen, dass der kleine Sohn eines Königs schon mit acht Jahren sein Nachfolger wurde. Pharao Tutench oder so ähnlich nannte man ihn. Verheiratet mit seiner Schwester, damit alles in der Familie blieb. Vielleicht bleibe ich dort und Deutschland kann mir gestohlen bleiben.
Chef Albert weiß, wie Ferdi tickt: „Herr Fuchs, der Kranwagen kommt näher und näher. Überprüfen Sie noch mal die Schutzfolie vor dem Wohnraum. Eventuell mit Tesa-Power wieder fest an den Boden kleben. Nichts darf sich lösen und Baudreck in den Wohnraum gelangen.
Plötzlich Geschrei von Hühnern, Enten und Gänsen vom Bauernhof gegenüber. Der Kranwagen hatte sie aus ihrer ländlichen Ruhe gescheucht. Alles Geflügelte macht sich auf, rast auf Zehenspitzen bis zum Zaun an der Straße. Zu protestieren. Mit ihrem Geschnatter den fremden Bully auf sechs dickbereiften Rädern davonzujagen. Auch der Gockel auf dem Misthaufen schreit: Kikeriki! Dreimal hintereinander. Vier schwarzweiße Kühe langsam den Kopf gedreht. Mit heraus hängender Zunge das Neue zu schmecken am Stacheldraht des Zauns. Malmen mit Kiefer und Zähnen das Gras zum aberhundertsten Mal. Muhen gelassen, wie immer.
Laut quietshend hebt der Autokran den acht Meter langen Doppel T-Träger vom Wagenboden. Kaum in der Luft, schwenkt er in Richtung Villa. Mit einem Schwung, den nichts und niemand aufhalten kann. So sieht es aus. Der Kranführer in der Kabine kann machen, was er will. Die Schwungkraft zu groß, die Richtung zu ändern, das Tempo zu stoppen. Bauleute wissen, wenn die Speisback einmal vom Dach herunterfällt, hält nichts und niemand sie mehr auf.
Die drei auf der Baustelle starren wie gebannt auf den acht Meter langen Doppel-T-Träger am weit ausgestreckten Arm des Autokrans. Meister Albert, Jupp, der Studierte und Hilfsarbeiter Ferdi Fuchs sehen ihn kommen. Unausweichlich wie Schicksale zu kommen pflegen. Schnell, schneller, schwankt wie betrunken. Wird doch wohl nicht die Regenrinne vom Dach reißen. Wie ein Fallbeil unsere Köpfe abschlagen. Alle vier ducken sich instinktiv. Könnte am frisch gemauerten Gesims Steine ausschlagen, Beulen und Blutergüsse das Wenigste, was ihnen passieren könnte.
Oh je, jetzt nur noch einen knappen halben Meter entfernt vom Ausbruch in der Außenmauer, den ein Dreifachglas-Schiebefenster-Vorbau schließen soll.
Ferdi Fuchs, sogar Albert aufgeregt. Zum ersten Mal so einen Träger auf sich zukommen gesehen. Jupp erfasst die Situation. Springt auf die Werkzeugkiste. Fuchtelt heftig mit beiden Händen, dem Kranführer zu signalisieren: „Langsam, Kumpel da oben! Langsam han isch jesaht, nimm de verdammte Ohrschutz runger, damit De mich verstehst: Näher jetzt, noch en bissken.“ Verfällt in Düsseldorfer Platt. Immer, wenn ihn etwas nervös macht. Hält ihm beide Hände entgegen, verringert den Abstand zueinander. „Näher, noch, noch, noch, haaaalt!“ Wischt sich den Schweiß von der Stirn.
So, jetzt einpassen. „Auf die Mauerpfeiler rechts und links aufsetzen.“ Ein paar Kommandos noch zum Schluss. Man glaubt nicht, wie lange ein so ein Tonnen schwerer Stahlträger hin und her pendelt, bis er zur Ruhe kommt. Auch Jupp konnte ihn nicht bändigen. Immer wieder schlägt er zur anderen Seite aus. Die letzten Zentimeter vor und zurück, beigedreht und endlich, endlich abgesetzt. „Gott sei ’s getrommelt und gepfiffen!“
Ferdi total vergessen, dass er eine Weltreise machen wollte. Nachdem er durch die Klarsichtfolie in den Wohnraum der Villa gesehen. Marmorboden, die Möbel ausgeräumt. Eine ganze Zimmerflucht, Wände mit Durchgängen, dahinter folgende Räume geahnt. Er kann nichts anderes mehr denken, als in dieser Villa zu wohnen. Sein Wunsch mächtig und immer mächtiger geworden, seit er hier arbeitet. Fast drei Tage schon. Den Bauplan gleich am ersten Tag genau angesehen. Als sie die Hauswand zum Garten aufgebrochen. 7,00 m breit und 2,50 m hoch für den Wintergarten. Ferdis Fantasie angeregt. Einer, der bisher nur tun musste, was andere ihm befahlen, hat plötzlich Visionen.
Mit 3000 Mark kann er für sich selbst ein Haus bauen. Jupp ihm dabei helfen. Nicht ganz so groß wie die Villa, an der sie arbeiten. Ihm würden zweieinhalb Zimmer genügen. Am Rande der Stadt auf einer grünen Wiese. Dann wieder lockt ihn eine Reise nach Ägypten. Hin- und hergerissen zwischen Bleiben und Unterwegs sein. Reisen scheint mehr Gelegenheiten zu bieten, Töchter von reichen Vätern kennenzulernen. In einem Groschen-Roman gelesen, dass ein wandernder Geselle aus Belgien die einzige Tochter eines Clan-Chefs in Afrika kennengelernt und sofort geheiratet hat. Nach dessen Tod ein großes Vermögen geerbt. Wenn ich die Tochter eines reichen Mannes heirate, werde ich nie mehr arbeiten müssen. Ertragen, dass andere mich hänseln und ausnutzen. Was also soll ich tun? Wer soll ich sein: Hausbesitzer oder Reisender?
Hier ein Haus bauen oder 5000 km weiter bis Ägypten reisen? Wenn Ferdi Shakespeares Drama «Hamlet» gekannt, hätte er sich statt «Sein oder Nichtsein?» gefragt: «Bin ich Herr Fuchs oder Ferdi?» Wo habe ich größere Chancen als Herr Fuchs geachtet und angesprochen zu werden? Nicht Ferdi, mach mal, wie bisher. Denkt, auf einer Ferienreise werde ich respektiert wie jeder andere. Denn keiner weiß, dass ich ein Waisenkind bin. Als Hilfsarbeiter wenig Geld verdiene. Auch, wenn ich ein Haus baue, respektieren mich alle. Weil ich ein Haus besitze. Geschafft, was nur wenige schaffen, keine Miete mehr zahlen müssen.
Ferdi, der bisher nur gelesen, dass es schöne Häuser und Villen gibt, kann plötzlich selber eines besitzen. Ein Haus mit Garten. Goldfische im Teich beobachten sommers. Winters bequem im Warmem sitzen, nach draußen blicken. Wenn unterm Schnee die frisch gepflanzten kleinen Tannen wie Zuckerhüte aussehen. Eine Flasche Kognak und Becher griffbereit neben sich, auf einem Tischchen mit einer Platte aus echt belgischem Marmor. Schwarz-weiß geädert. Auf Hochglanz poliert. Marmor kennt er vom Bauhof. In Gestellen senkrecht stehende Tafeln.
Noch in der Traumwelt fragt er sich, wer ist hier der Besitzer? Ein reicher Kaufmann? Einer, der sein Vermögen selbst verdiente? Oder geerbt? Warum bloß lässt er sich nie sehen? Schon eine halbe Woche hier und keine Ahnung, wer der Bauherr ist. Welchen Beruf er ausübt. Oder schon in Rente? Spazieren am nahen Rhein? An diesen langweiligen Vorort verbannt von seinen Kindern? Aber nicht hier, wie ich sehe. Ob er sich tröstet mit Frauen im angesehensten Bordell Düsseldorfs? «Rethelstraße 26A». Die Nummer genügt und alle wissen Bescheid. Für mich unerreichbar. Auch heute unbezahlbar für Männer vom Bau. Wäre ich verheiratet, brauchte ich solche Frauen nicht. Vielleicht finde ich in Ägypten eine, die mir gefällt. Ihr Vater ein vermögender Mann.
12:00 bis 12:30 Uhr Mittagspause. Anna, so hatte sich die Haushälterin des Villenbesitzers am ersten Tag vorgestellt, bringt für jeden einen Big-Hamburger und eine Dose «Düssel-Alt». Spezialbier aus dem «Ürigen», einer Kneipe in Düsseldorfs Altstadt. „Prost Anna“ im Chor die Männer. Mögen die dralle Endfünfzigerin, weil sie ihnen jeden Tag Leckeres, am Wochenende Bares in die Hand drückt. Wo sie die Villa verlässt, bleibt ein Geheimnis. Schon ist sie da. Schon ist sie weg. Ob sie rein geht, wo sie raus kam, keiner sieht es. Weiß es folglich nicht.
„Die Villa könnte vier Eingänge haben“, meint Jupp. „Wie die von Palladio, dem berühmten italienischen Architekten.“ Arbeiter dürfen sich nur auf der Seite aufhalten, wo sie beruflich zu tun haben. So eine blöde Anweisung, geht Ferdi Fuchs durch den Kopf.
Wie im Waisenhaus. Keiner sagt uns, warum. Immer nur gehorchen.
Nach Feierabend schenkt Anna jedem einen Zehn-Mark-Schein: „Vielen, herzlichen Dank, auch im Namen meines Hausherrn.“ Weil sie es so lieb sagt und ihnen dabei tief in die Augen blickt, traut sich niemand, nach Namen und Beruf ihres Herrn zu fragen. Jupp meint, er könnte ein Mafiosi sein. Die sollen ja Millionen verdienen. Aber auch mit einem Fuß im Gefängnis stehen.
So also raten sie weiter, spielen alle Möglichkeiten durch, wer dieser große Unbekannte sein könnte. „Ob er verheiratet ist? Kinder hat? Enkel? Ein Schloss an der Loire? Noch eines am Gardasee?“ „Eine Ranch in Minnesota? Eine Indianerin als Geliebte?“ „Sonntags regelmäßig die Messe besucht?“ „Ebenso regelmäßig seine Steuern bezahlt? Oder sein Geld auf Schweizer Banken versteckt?“
Ferdi Fuchs, sich wichtig vorkommend: „Habe in diesen Tagen kein Auto der Finanzpolizei gesehen. Mich wird sie sowieso nicht erwischen. Werde für meine 3000 Mark eine Reise kaufen und nie mehr dahin zurückfahren, wo ein Finanzamt ist.“
Jupp fährt auf, das Sie vergessend: „Ferdi du bis bekloppt, die komme doch nit mit nem Schild am Auto:
Achtung, Achtung, Finanzpolizei! Fahren janz normale Autos. Überrasche dich, wenn de noch pennst, in der Früh um Sechs. Übrigens is de Besitzer jarnich zehus. Dat aber hilft ihm nit. Selbst im Ausland finde se ihn mit Hilfe von Spionen.“
Albert grinst: „Jupp, Du scheinst ja genau Bescheid zu wissen, hat Dich die Finanzpolizei schon mal erwischt?“ Zahlt auch Jupps Wochenlohn aus, von dem die Steuer bereits abgezogen ist. Ködert ihn weiter:
„Hast noch ein Geheimkonto in der Schweiz, was? Gib ’s zu und lass uns daran teilhaben. Wir könnten gemeinsam eine Spielbank in der Nähe von Paderborn eröffnen. Im katholischen Westfalen vermutet niemand einen so sündigen Ort. Aber alle kommen, stellen ihre Autos im dunklen Wald ab. Und wir verdienen zehnmal so viel wie heute. Was sage ich, hundert, tausend Mal mehr.“ Lacht.
Alle lachen, und schon Visionen im Kopf. Sich leisten können, was sie immer schon wollten. Porsche, Urlaub auf den Malediven, ein eigenes Haus mit Schwimmbad. Eine Stereo-Anlage im großen Wohnraum. Ferdi Fuchs’ Zwischenhirn unruhig. Zu vieles hat er vermisst, zu wenig besessen. Nichts, das nur ihm gehörte. Jetzt hat er 3000 Mark. Nach Feierabend gehe ich in ein Reisebüro. Dann entscheidet sich, ob ich bleibe und ein Haus baue. Oder nach Ägypten reise.
Ferdi mit dem Rad rasch in der Stadt. Das Reisebüro kennt er vom Vorbeifahren. Unübersehbar auf der Schaufensterscheibe ein Plakat. Vor azurblauem Himmel ein Beduine in wehendem Gewand am Ruder eines Segelbootes. Hinter ihm am Ufer des Nil ein uralter Tempel. Quer darüber ein gelber Streifen: Sonderangebot: 14 Tage Kairo. Inkl. Besuch von Bazar, Moschee und berühmten Tempelanlagen. Segeltour in einem Felachenboot den Nil hinauf bis an die Grenze zum Sudan: Nur 2900,00 Mark.
Drinnen näselnde, fremde Musik, nicht Catarina Valente oder Peter Alexander, die ich kenne. Duftkerzen verströmen fremde Gerüche. Lassen mich schweben wie auf Wolke Sieben. Direkt auf die Frau an der Theke zu: „Das Segelboot auf dem Plakat am Schaufenster verlockt mich, dass ich nicht in der Lage bin, meine Reiselust zu bremsen. Hoffe, Menschen kennenzulernen, die anders sind als da, wo ich lebe. In jeder Situation höflich und hilfsbereit. Haben Sie noch einen Platz für mich frei?“
„Sie meinen die Reise nach Kairo, oder?“
„Ja, ja, wie kommt man denn dahin? Auf einem Kamel dauerte es mir zu lange, hab anderes zu tun.“
Die etwas ältere Frau lacht: „Sie haben wohl zu viel Karl May gelesen, nein. Die Reise dauert vierzehn Tage. Zuerst geht es mit dem Zug bis Marseille. Von dort per Schiff nach Alexandria in Ägypten. Von dort mit dem Bus bis Kairo und Umgebung. Zum Abschluss eine Fahrt auf einem original Fellachen-Boot mit nur einem Segel am kurzen Mast. Ein erfahrener Segler steuert es auch gegen die Strömung. Den Nil aufwärts, vorbei an Felsen und viertausend Jahre alten Tempeln. Gewendet wird an der Grenze zum Sudan. Dem früheren Nubien, im alten Ägypten bekannt und begehrt für seine riesigen Goldvorräte. Zurück wie hin mit Bus, Schiff und Eisenbahn.“
„Das klingt ja spannend, wo aber werden wir die Nacht verbringen? Wo frühstücken, zu Mittag und zu Abend essen? Bin gewohnt, drei Malzeiten am Tag einzunehmen. Und trotzdem nicht größer geworden als einhundertvierundfünfzig Zentimeter. Müsste eigentlich Rabatt bekommen, weil ich leichter bin als andere und weniger Platz benötige.“ Grinse, „sollte ein Scherz sein.“
Die Frau aber lacht nicht: „Sie belieben zu scherzen, Herr …“ „Baron Fernando von Fuchs.“ Gelesen von einem Baron von Wolf, dem man mit Hochachtung begegnete, obwohl er arm wie eine Kirchenmaus.
„Oh Pardon, Herr Baron, ich wusste nicht …“
„Lassen wir es dabei. Wie sieht es während der Reise mit Schlafen und Essen aus? Ist es ratsam, ein zusammenfaltbares Zelt mitzunehmen und eine Art Notverpflegung?“
„Aber nein, im Zug können Sie im Speisewagen essen und trinken, auf was Sie Lust haben. Bordverpflegung auch auf dem Schiff nach Alexandria. Übernachten, Frühstücken und Abendessen werden Sie in Ägyptens Touristik-Hotels, nahe der Route. Es bleibt Ihnen überlassen, da und dort typisch Ägyptische Gerichte kennenzulernen. Frisch gebackenes duftendes Fladenbrot, das man dort von morgens bis abends stets frisch aus dem Ofen kaufen kann. Ebenso ein soeben geschlachtetes Huhn, im Erdofen gebraten, gesäuerte schwarze Bohnen als Beilage. Habe ich Ihnen jetzt Appetit gemacht? Wir würden Sie gerne als Gast auf dieser Reise begrüßen. Die zweite von zehn in diesem Jahr beginnt nächste Woche Montag. Passt es Ihnen.“
Überlege einen Moment: Ja, es klappt.“ Albert wird nicht meckern, lange steht das Urlaubsdatum fest. „Vergessen Sie nicht, sich einen Pass ausstellen zu lassen, wenn Sie noch keinen besitzen. Sonst müssen Sie bei der Passkontrolle im Zug schon in Aachen wieder aussteigen.“
„Chef, denken Sie daran, ab nächsten Montag beginnt mein Jahres-Urlaub. Bin dann zwei Wochen weg. Vorsichtshalber drei. Weiß noch nicht, ob ich nach vierzehn Tagen in Ägypten noch kräftig genug, Steine zu schleppen. Sie werden sicher eine Vertretung finden oder Ihre Leute schneller arbeiten lassen.“
Mich hatte der Teufel geritten, ohne dass ich es wollte. Zu was Geld alles motiviert. Als es raus, war ich stolz. Gesagt, was ich immer schon sagen wollte, aber nicht wagte. Stimmt doch, würden die nicht alle Nase lang eine Pause machen, um eine Zigarette zu rauchen, hätten sie mehr geschafft. Albert reagiert nicht, lächelt und reicht mir seine rechte Hand:
„Na dann schon jetzt schönen Urlaub. Grüßen Sie die Königin Kleopatra von mir, wenn Sie sie treffen. Denke, Sie werden bestimmt mit ihr spazieren gehen.“
Kleopatra? Wer soll das sein? Gab es da nicht mal einen Film, der so hieß? Von einer ägyptischen Königin. Egal, nur noch fünf Arbeitstage und dann kein Handlanger mehr. Weg, weit weg von Düsseldorf. Zwei Wochen mein eigener Herr und nicht mehr müssen. Sondern tun dürfen, was mir Spaß macht.
27. März 1956
Sankt Petersburg. In der «Großen Kathedral-Synagoge» nur ein einziger Mensch. Inmitten unzähliger Säulen, die Gewölbe stützen mit schwingenden Rippen. Klein die Fenster, lassen nur wenig vom Tageslicht herein. Damit die sieben Lichter der Menora umso heller leuchten den Frommen. Der Mensch entpuppt sich als Mann. Den weiten Mantel aufgeschlagen, die Arme ausgebreitet, das Haupt bedeckt mit einer Kippa.
Liegt auf dem marmornen Boden wie tot. Bluttat im heiligen Raum? Eine junge Frau nähert sich ihm: „Steh auf Vater, Deine Gedanken müssen sich wieder dem Heute zuwenden. Und Du in Dein Haus zurückkehren. Die schöne Villa, die Du am Rande von Düsseldorf bauen ließest. Ich werde Dich begleiten und so lange bei Dir bleiben, wie Du willst. Gemeinsam ein neues Leben beginnen, auch ohne Aviva, Deine Frau.
Konnte nicht glauben, als Du mir schriebst, sie sei auf der Baustelle dieser Villa von der Leiter gestürzt und kurz danach gestorben. Du musst sie sehr geliebt haben, wie auch ich sie liebte. Mamas lockere Art, Probleme aus der Welt zu schaffen. Sie verstand und tröstete mich, hatte ich eine Klassenarbeit verpatzt. Lobte mich, weil ich runde Deckchen häkeln konnte, sie völlig unbegabt in Handarbeit. Zum ersten Mal verliebt und todtraurig, als Rudi mich einer anderen wegen verließ. Mama mit mir Ins Kino, Dick und Doof gesehen und herzhaft gelacht. Zuletzt mir noch 500 Mark geschickt für ein neues Kleid. Mit dem ich meinen neuen Freund Fernando beeindrucken wollte.“
Reicht die Hand, ihrem Vater aufzuhelfen, da steht er schon. Knöpft seinen Mantel zu, richtet Krawatte, die Kippa: „Du hast Recht, der Ärzte-Kongress war ein Erfolg. Das Leben wartet, nach so viel rückwärts gewendeten Jahren. Wir nehmen den nächsten Flug nach Düsseldorf. Ein letzter Blick auf die Synagoge noch.“
Vor ihnen das breit hingelagerte Bauwerk. „Zar Alexander II. gab sie in Auftrag, weil immer mehr Juden in Sankt Petersburg leben wollten. Hier fühlte sich auch der Adel Europas zuhause, Künstler und Gelehrte. Damals hieß die Stadt noch wie bei der Gründung durch Zar «Peter der Große». Die Synagoge überstand alle Zeiten, auch die Zwangsherrschaft des Genossen Stalin. 1880 im damals beliebten maurischen Stil erbaut.
„Sie scheint den letzten Krieg gut überstanden zu haben.“
»Ein Wunder ist es, wahrlich, blieb während der deutschen Belagerung 1941-1944 bis auf ein paar Kratzer heil. Dreiviertel aller Gebäude der Stadt aber von Deutscher Artillerie und Sturzkampfbombern zerstört. Du kamst im letzten Jahr auf die Welt. Es gab praktisch nichts zu essen. Hunde geschlachtet, Katzen und das letzte Pferd. Wohin auch sollten wir fahren, alles zerstört. Einige sollen auch Leichen gegessen, sich Finger der linken Hand abgeschnitten haben. So groß der Hunger. Mehl von Tag zu Tag knapper, die letzten Reserven verbraucht. Liegen gebliebene Ähren mit Körnern auf Feldern aufgesammelt. Mit Knüppeln Gedroschen, zwischen Steinen gemahlen. Mehl für winzig kleine Küchlein oder einen Brei für Dich.
Immer mussten wir mit diesen Angst und Schrecken verbreitenden Sturzkampfbombern der Nazis rechnen. Die in der Luft schon heulten, Unheil ankündigend. Bevor ihre Bomben Häuser und Verkehrswege in der Stadt zerstörten. Hunderte Menschen bei jedem Angriff verwundeten oder töteten.“
Der Vater der jungen Frau ein Professor. Gewohnt, ein Thema zu Ende zu bringen, auch im Gespräch mit seiner Tochter nicht zu bremsen. Der Gedanke an Petersburg muss ihn sehr beschäftigen:
„Über eine Million Menschen verhungerten, weil sie nichts zu essen hatten. Eingeschlossen in den Trümmern ihrer Häuser. Nicht wenige klammerten sich mit knöchernen Fingern an eine Ikone. Aber kein Heiliger, keine Madonna half. Gott selbst schien uns verlassen zu haben. Wir fanden in einem unbeschädigten Keller Unterkunft. Geschützt vor Granaten und herumfliegenden Trümmern. Zum Glück kam eine Hebamme bei Deiner Geburt. Mama nährte Dich, solange es ging. Presste ihre Brüste, bis ein wenig Milch kam, Dich kleinen Schreihals zu beruhigen.“
„Wie Du siehst, ist trotzdem aus dem kleinen Schreihals eine gut proportionierte Frau geworden.“ „Aber immer noch nicht kann ich mit Enkeln spielen. Ihnen beibringen, bis sieben zu zählen. Die Tora zu verstehen. Du hast seit Jahren einen Freund. Wollt Ihr nicht heiraten, wie sich ’s gehört?“
„Da kommt ein Taxi, wir müssen, Papa.“
Der Flug verläuft schweigend. Jeder in Gedanken, mit sich selbst beschäftigt. Vater Joshua David Johanson, Professor für Psychiatrie im Ruhestand. Erinnert sich an Einzelheiten des überraschenderweise positiv verlaufenen internationalen Ärzte-Kongresses. Trotz Überwachung durch den K.G.B. Denkt an sein Versprechen im Jahr 1944, der Befreiung Petersburgs. Nach Kriegsende als Teilhaber einer Kerzenfabrik jedem eine Kerze zu schenken, der anderen in diesen schweren Jahren geholfen. Symbol des ewigen Lichts, Jahwe. Dank seiner Gnade einer Frau begegnet, eine Tochter bekommen. Sie gaben ihr den Namen ihrer Mutter, Aviva, Frühling. In Zeiten des Krieges ein Zeichen der Hoffnung zu setzen.
Kein halbes Jahr später endlich vorbei das jahrelange Morden und Hungern. Die ersten Hilfsgüter auf Zügen herbeigeschafft. Brot gab es wieder, Eier und Mehl, Brot und Kuchen zu backen. Sauberes Wasser in Flaschen. Die Kerzenfabrik arbeitete wieder. Sonne schien wie vorher über gute und böse Menschen. Wie jetzt durchs ovale Fenster der russischen Aeroflot neben ihren Sitzen.
Aviva nippt Kaffee aus dem Plastikbecher, denkt an Fernando, ihren Freund. Papa hat Recht, ich möchte schon heiraten. Er aber schiebt immer wieder dasselbe Argument vor: Will erst promovieren, sich an einer Klinik bewerben. Später dann genug verdient, als Urologe eine eigene Praxis eröffnen. Läuft die gut, hat er nichts dagegen, einen Sohn zu zeugen. Bisher hat sie klein beigegeben. Als Jüdin dem Manne gefolgt. Vor Schwangerschaft geschützt. Jetzt aber entschlossen, ihn zur Rede zu stellen. Entweder oder.
Zwischen-Stopp in Berlin-Tempelhof. „Ob es im Restaurant «Der Berliner» noch die berühmten Pfannkuchen gibt? «Berliner» oder «Berliner Ballen» genannt. Hätte große Lust, einen oder zwei zu verdrücken. Dazu ein Kännchen frisch gebrühten Kaffees.“ Joshua schließt die Augen, mit der Zunge Erinnertes auf den Lippen zu schmecken. Alle Geschmackspapillen im Mund aktiv.
„Schade, nur eine halbe Stunde Zeit bis zum Weiterflug mit der Lufthansa nach Düsseldorf. Zu knapp, mich in aller Ruhe einem luftigen Berliner zu widmen. Hineinbeißen, bis Himbeermus im Innern das Glück vollkommen macht. Den heißen Kaffee, wie gewohnt, unter der Sahnehaube schlürfen. Schluck für Schluck. Den typischen Berlin-Geschmack im Mund, alles um mich herum vergessen.“
„Berliner gibt es auch bei uns in Konditoreien, kenne sie und mag sie wie Du.“
„Hier in Berlin schmecken sie aber besser. Wo sie erfunden, zum ersten Mal gebacken wurden. Original wie alles, was am Ursprungsort entsteht. Vielleicht ist es die Berliner Luft, die sie im Laden einatmen.“
„Mag sein, Du empfindest es so, weil Berlin Dich an damals erinnert. Mir schmecken sie so gut, weil sie in Düsseldorf gebacken. Einer Stadt, in der ich immer schon leben wollte. Bis ich Paris kennenlernte.“
In der Halle nur Bänke mit Wartenden. Lediglich ein mobiler Eiswagen, Grün, Weiß, Rot lackiert. Eine gut geölte Tenor-Stimme singt: «Gelato Italiano – meglio d’el mondo». Italienisches Eis, bestes der Welt. Drängt Vorbeieilenden einen Becher mit drei Kugeln auf: Minze, Vanille und Erdbeere. Grün, Weiß, Rot, die Farben der Fahne des geeinten Italien seit 1861.
Joshua mit seinen Gedanken beim Pessachfest. An dem erinnern Juden das Ende ihres Exils in Babylon 539 v. Chr. Auch 1933, als Nazis die Macht an sich gerissen, drohten Haft und Enteignung. Er und seine Frau flohen freiwillig, um der Gefahr einer Verschleppung oder dem Tod zu entkommen. Die Nürnberger Rassengesetze gerade erlassen. „Aviva, setzen wir uns und plaudern ein bisschen.
Muss unausgesetzt an das letzte Pessachfest hier in Berlin denken. Dort hatten Deine Mutter und ich uns 1934 in einem Café kennengelernt. Wollten nach Russland auswandern, den Nazis entfliehen. Nachdem mir die Leningrader Universität eine Professur angeboten. Leningrad hieß früher Sankt Petersburg. Ich kannte die Stadt, bevor Stalin sie in Leningrad umbenennen ließ. Stadt des kommunistischen Politikers Wladimir Iljitsch Lenin. 1917 aus der Schweiz angereist, verkündete in allen Großstädten Russlands die kommunistische Idee. Die vom Adel zur Leibeigenschaft gezwungenen Menschen folgten ihm. Wählten Lenin zum ersten Premier der UDSSR.“ Schweigt eine Zeit, von Erinnerungen bewegt.
„Erinnere das Menue in Berlin, als wäre es gestern gewesen. Familie und Freunde um einen großen Tisch versammelt. Ein junger Mann kochte damals für uns, was wir noch nie gegessen. Am Pessachfest übliche Lebensmittel gab es nicht, außer Lamm, Salat und Nüssen, die an bestimmte Ereignisse nach der Babylonischen Gefangenschaft erinnern. Trotzdem kam es mir vor wie vom Himmel gefallenes Manna. So anders, animierend geradezu. Schmeckte, wie es dem Volk der Juden bei ihrem Auszug aus Babylon geschmeckt haben muss. Als Manna vom Himmel regnete. Sie in der heißen, menschenfeindlichen Wüste vor dem Verhungern bewahrte. Rettung in höchster Not.
Orthodoxe Juden glauben immer noch, Manna fiel vom Himmel. Obwohl Wissenschaftler entdeckten, dass Schildläuse auf Tamarisken-Bäumen herbsüßen Saft absondern. Der an der Luft fest wird wie das Fruchtfleisch von Datteln. Lässt sich leicht abpflücken und schmeckt fast wie Honig. Wäre der Boden in Sankt Petersburg trocken und nicht moorig, könnten auch dort Tamarisken wachsen. Während der Hunger-Jahre abertausende Menschen am Leben geblieben.
Jetzt zum Menue. Eine ungewöhnliche Mischung von Fleisch, Gemüse, Früchten und Nüssen. Regelrechter Schmaus für Augen und Gaumen, den ich mein Lebtag nicht vergessen werde. Mag sein, dass es Erinnerung ist, die mich heute noch begeistert:
Als Vorspeise in Öl gebratene Rotebete mit Äpfeln, Frisée-Salat, Pekan-Nüssen, Salatherzen und knusprig gebratene Schwarzwurzeln.
Der Hauptgang bestand aus zwei gebratenen Lammkoteletts mit frischen Feigen und Chiccorée, dazu Pfeffersoße mit Mandeln. Zum Nachtisch Honigsorbet mit grünen Äpfeln. Alles koscher, wie in der Tora vorgeschrieben.“
Aviva beeindruckt: „Ungewöhnlich finde ich wie Du. Aber ist diese seltsame Mixtur typisch für die jüdische Küche? Kann mich nicht erinnern, bei Euch so etwas gegessen zu haben. Nur an Deine Äußerung, das Essen vor Eurer Flucht wäre ein Abschiedsessen gewesen. Jetzt weiß ich, es war das, was Du mir jetzt so begeistert beschrieben hast. Warum aber war es ein Abschiedsessen?“
»Du musst wissen, das Essen an Pessach ist seit Jahrtausenden Tradition. Jedes einzelne Teil des Menues erinnert an einen psychischen Zustand der Juden oder ein Ereignis, damals beim Aufbruch aus Babylon in Richtung Jerusalem. Alle Juden glaubten damals, Jahwe habe sie gerettet. Nun zu Deiner Frage:
Wir waren damals einige Tage in Berlin, bevor wir nach Sankt-Petersburg weiter reisen durften. Das Pessachfest am letzten Tag. Der Koch ein Jude, der sich damals schon verstecken musste. Der Rasengesetze wegen und der daraus folgenden antijüdischen Stimmung. Ließ sich liefern, was in der Umgebung wächst. Notgedrungen zauberte er daraus, was nicht in allen Teilen der Tradition entsprach. Zubereitet aber mit dem Einfallsreichtum jüdischer Kochkünstler. Schöpfen Ideen aus überlieferten Rezeptbüchern, wie Rabbiner Glaubenswahrheiten aus der Tora. Vermute, Fleisch und Gemüse von judenfreundlichen Landwirten bekommen. Feigen, Mandeln und Pekan-Nüsse bei einem der wenigen noch existierenden Hinterhof-Importeure. Wie mir ein Freund schrieb, haben die Nazis ihn bald danach erwischt und ins KZ Oranienburg gesteckt. Da wurde mir klar, wir sind noch mal davon gekommen. Ein Essen, bei dem wir Abschied genommen. Von Berlin und einem Leben, das wir nun hinter uns lassen mussten.“
„Das kann ich gut verstehen. Aber während des Krieges und danach haben auch Millionen Deutsche von ihrem gewohnten Leben Abschied nehmen müssen. Tote beweint, gehungert, bald aber durch Fleiß wieder nachgeholt, was sie lange vermisst. Bist Du sicher, die Zutaten Deines Menues gibt es auch bei uns? In einem Land, in dem kaum noch Juden leben. Ganz andere Essgewohnheiten gepflegt werden. Gerade jetzt, als alles wieder zu kaufen ist.“
„Ich weiß es nicht, aber die Feinkostläden sind voll mit Früchten aus wärmeren Ländern.“
„Glaubst Du, Anna, Deine Haushälterin, kann es auch so lecker zubereiten, gäbe es alles? Dann würde ich es Dir zum achtzigsten Geburtstag schenken. Einem der zahllosen Nachfahren Abrahams, der das Glück hatte, zwei Diktaturen zu überleben.“
„Keine Ahnung, ob sie überhaupt jüdische Gerichte kennt und kochen kann. Nie daran gedacht, sie zu fragen. Es hat uns immer geschmeckt, was sie kochte.
Du weißt, wir halten uns nicht streng an jüdische Gebräuche. Zutaten für das Berliner Gericht aber hatte ich dort sofort aufgeschrieben. Für den Fall, dass wir nach dem Krieg wieder nach Deutschland kommen. Ich werde ihr meine Notizen geben und wir erleben, ob sie alles beschaffen kann, um es am 12. Mai, meinem Achtzigsten zuzubereiten. Übrigens: bevor wir uns trafen, um gemeinsam nach Sankt Petersburg zu reisen, bat ich Anna, in der Villa zu bleiben, während Arbeiter den Wintergarten bauen. Gespannt, ob alles gut gegangen ist.“
1. April 1956
Ferdis zweiwöchige Ägyptenreise im Flug vergangen, eins nach dem anderen passiert, sodass es unmöglich ist, die Tage auseinander zu halten. Kein Aprilscherz, liebe Leserinnen und Leser. Sie werden auf nichts verzichten müssen. Reisepass, mit Foto gestempelt, in Ferdis Hosentasche. Als Beruf Handwerker angegeben. Was bei einer Überprüfung der Tatsache entsprochen hätte. Arbeitet er doch mit Händen, womit sonst? Kein Kontrolleur muss wissen, dass er nur ein ungelernter Gehilfe ist. Er würde ihn nie so respektvoll wie einen Uniformierten oder einen Pfarrer um seinen Pass bitten.
Von Düsseldorf erst nach Köln, umgestiegen in den Zug nach Marseille. Auf dem Bahnsteig drängen sich Menschen. Gruppen von jüngeren, Pfadfinder erkannt an bunten Halstüchern, die ein Ring mit einem Symbol zusammenbindet. Spielen Gitarre, singen laut und ausgelassen, winken mir zu. Winke zurück und fühle mich wie einer von ihnen. Froh, die neue Cordhose, das weiße Hemd angezogen zu haben. Einen guten Eindruck zu machen. Wer weiß, wem ich unterwegs oder in Ägypten begegne.
Unsere Reisegruppe kommandiert ein sogenannter Reiseleiter. Erinnert mich an die Zeit im Waisenhaus. Der hier sorgt dafür, dass die zwölf beisammen bleiben, niemand in den falschen Zug steigt. Ruft alle Nase lang: „Nicht weggehen, stehen bleiben. Unser Zug wird schon kommen.“ Als er verspätet einläuft, kaum die Türen geöffnet, dränge ich mich als erster ins erstbeste, freie Abteil.
Koffer brauche ich keinen zu verstauen. Zuletzt noch im Kaufhof einen Handbeutel günstig gekauft. Für Waschlappen, Seife, Kamm, Zahnpasta und Bürste. Cordhose mit Portemonnaie, Reisepass und das Hemd am Leib. Sandalen an den Füßen. Alles wird die zwei Wochen überstehen. Außerdem soll es so heiß sein, dass man nackt baden kann. Wäsche, Hemd, Hose und Sandalen, nur zum Essen im Restaurant angezogen, bleiben sauber. Hier allein im Abteil mit einer jungen Frau. Ihr Gesicht von einem Kopftuch halb verdeckt.
„Wollen Sie auch nach Ägypten? In diesem Zug nach Marseille? Dann auf dem Schiff weiter bis Alexandria, mit dem Bus nach Kairo? Zwei Wochen Ferien wie ich? Es würde mich freuen, wenn wir uns unterhalten, Meinungen austauschen könnten.“
Das Kopftuch beiseitegeschoben, zwei schwarze Augen sehen mich an, blutrot geschminkt die Lippen: „Ai kahnt änderständ ju, Ssör. Du ju spiek Inglisch?“ Es hört sich Englisch an. Bevor ich sorry sagen kann, wird die Abteiltür aufgerissen: „Herr Baron, Sie sind im falschen Abteil. Bitte folgen Sie mir.“
Die Frau sieht mich an, doch leider muss ich weg. Einem anderen folgen, wie immer in meinem bisherigen Leben. Stottere: „Sorry“, das einzige englische Wort, das ich behalten. Ob es hier richtig ist? Aber in ihrem Gesicht geht die Sonne auf. Lächelt und nickt, als wollte sie mich wiedersehen.
Die Fahrt dauert und dauert. Zähle die Stunden nicht mehr. Schon elf Stunden unterwegs. Vom vielen Lesen schläfrig geworden, und dem monotonen Geräusch der Räder auf dem Gleis. Taktet unentwegt, wenn Schienenstöße überfahren. Gerüttelt, geschüttelt auf Weichen, in Kurven. Über schwindelerregend hohe Brücken gefahren, in den Abgrund unter mir geschaut und gedacht: Was, wenn sie jetzt einstürzt? Vorbei an Straßen und Flüssen. Sonne blendet, in Tunneln schwarz wie die Nacht, bis Lampen im Zug aufglimmen. Das Fahrgeräusch lauter als vorher und nachher.
Die Landschaft interessiert mich nicht mehr, zu schnell vorbei. Aber groß das Bedürfnis, in frischer Luft die Beine zu vertreten. Leider nur den Gang zur Toilette hin- und zurückgegangen. Vorbei an Menschen mit Gepäck, die keinen Platz gefunden. Oder lieber im zugigen Gang mit anderen überfüllte Züge beklagen als im Abteil sitzen und sich stundenlang anschweigen.
Erneut unterwegs zum WC. Jeder Bahnfahrer weiß, wie das ist, sich durch Massen von Menschen und Koffern zu schlängeln. Halt suchen an was auch immer. Um nicht in einer Kurve an eine fremde Frau geworfen, sich an ihr festhalten müssen. Schaffe es trotzdem, heil im Speisewagen anzukommen. Appetit auf eine Suppe. Mit letztem Lohn und den hundert übrig geblieben Mark des Gewinns mehr als genug für zehn Pfadfinder.
Zum ersten Mal in meinem Leben werde ich an einem Tisch essen und gleichzeitig weiterkommen. Die Tür zum Speisewagen geöffnet, wen sehe ich? Die Frau aus dem ersten Abteil. Eile auf sie zu, da bremst der Zug. Mich schleudert es direkt an den festgeschraubten Tisch. Der verhindert, dass ich ihr um den Hals falle, um nicht zu stürzen. Die Frau, deren Gesicht ich im Abteil nur zur Hälfte wahrgenommen, hatte das Kopftuch abgelegt, lächelt mich an. „Sorry“ bringe ich heraus, nur sorry. „Nicht ich wissen, wie soll sagen, Sie mich verstehen, verstehen Sie?“
Da steht sie auf wie eine gut erzogene Tochter, ihre Hand deutet auf den Platz ihr gegenüber, lächelt: „Bitte.“
Jetzt sehe ich, sie ist klein. Nicht größer als ich. Aber sicher doppelt so dick. Ein richtiges Pummelchen, zum Schmusen ideal, denke ich. Setze mich und schau sie an. Rosige Bäckchen, die Lippen rot, kastanienrot ihr Haar. Bubischnitt die Mode von gestern. Ob sie auch von gestern ist, oder von heute? Mich lieben könnte, einen, der von morgen sein möchte. Ein Herr, der eine Dame bittet, die seine zu werden.
Frage mich jetzt, ob sie auf Deutsch nur bitte sagen kann wie ich auf Englisch nur sorry? Es wird sich zeigen. Zeit genug noch bis Marseille. Sicher auch Anlässe, es auszuprobieren. Ein Glück, dass Kellner in diesem Zug auch Deutsch sprechen: „Bringen Sie mir bitte die Suppe, die hier auf der Karte als Mittagessen angeboten wird.“
„Leider, leider ist sie ausverkauft, drei Reisegruppen wollten sie haben. Biete Ihnen stattdessen Haferbrei an, original Ägyptisches Rezept, gewürzt mit Kurkuma. Kostprobe eines Landes, in dem seit kurzem dieses aus Indien stammende Gewürz angebaut wird. Weil es Touristen beim Verzehr heimischer, also ungewohnter Speisen, vor Magenschmerzen schützt.“
Mein Gegenüber rasch: „Ei nau Kurkuma, wont it.“ Sieht mich an und lächelt. Nickt, als forderte sie mich auf, auch Kurkuma zu essen. Nichts lieber als das: „Bringen Sie uns eine doppelte Portion von diesem Kurkumabrei in einer Schüssel. Einen Schopflöffel dazu und zwei tiefe Teller.“ „Ganz wie Sie wünschen, mein Herr.“ „Baron.“ „Wie Sie wünschen, Herr Baron.“
Fünf Minuten später die dampfende Terrine auf dem Tisch. Teller, Löffel und Servietten schon bereit auf allen Plätzen. Bevor einer von uns zugreift, hatte der Kellner den Deckel bereits abgehoben. Die Kelle in der Rechten, den Teller vor der Frau bis zur Hälfte gefüllt: „Okay, Madame? Sie nickt, winkt ab. Sieht mich erstaunt an, als ihn nicht daran hindere, meinen Teller bis oben an den Rand zu füllen.
„Oh, ju ar hangri, gutt äppetait, Baron!“
Könnte guten Appetit heißen, nicke ihr zu: „Gutt Äppetait auch Ihnen.“ Was soll ich sonst sagen? Seit heute früh nichts mehr gegessen? Sie würde es nicht verstehen, spräche ich Deutsch. Wir beide sitzen an einem Tisch. Löffeln den Brei, der nicht nur gelb aussieht, auch gelb schmeckt. Mein Inneres färbt, so fühlt es sich an. Denken an Gott weiß was und sagen kein einziges Wort. Versuche es nochmal: „Sorry“ und sehe sie an. Und wieder nur blutrotes Lächeln. Lächelt und sagt: „Bitte.“
In ihrem Abteil ein Platz frei, setze mich ihr wieder gegenüber, wie im Speisewagen. Sie anzuschauen. Vom Schauen, nichts sagen und nichts tun können müde geworden. In der Ecke des Abteils am Fenster eingenickt und die ganze Zeit kein Wort gesprochen. Immer mal wieder aufgewacht, Pummelchen vor mir angesehen. So gerne mit ihr geschmust. Sie scheint zu schlafen. Sehe ihren Busen und denke an Mama. Nie erlebt und erfahren, wie sich eine Mama anfühlt. Warm muss sie sein wie die Sonne. Mich aufgehoben fühlen und beschützt vor allem Bösen in der Welt. Wie Mütter ihre Kinder erziehen, habe ich in Romanen gelesen, aber selbst nie so erlebt. Einmal nur, ein einziges Mal, möchte ich mich am Busen einer Mama kuscheln. Zugleich beruhigt und unternehmungslustig. Erinnere mich an einen Gast, der im «Ürigen», Düsseldorfs bekanntester Altstadtkneipe, viel Beifall bekam. Als er nach fünf Bier und sechs Schnäpsen eine Opern-Arie sang:
«Als Büblein klein an der Mutter Brust, hopp heißa bei Regen und Wind».
Durchsage Gottseidank auch in Deutsch. Ich wäre vielleicht sitzengeblieben, wenn Pummelchen nicht ausgestiegen: „Marseille, Hauptbahnhof in wenigen Minuten.“ Muss also aufstehen und auszusteigen. Springe auf, das Abteil zu verlassen. Im selben Moment erhebt sich auch mein Gegenüber ebenso schwungvoll. Wir prallen aufeinander. Für ein oder zwei Sekunden am Busen des Pummelchens. Vereint wie ein Paar. Halte inne, dieses Gefühl bewusst zu genießen. Ihre Wärme durchs Hemd auf der Haut zu spüren:
„Sorry, Mama.“ „Bitte, mai beibi.“ Sie scheint auch nur das Wort Bitte zu kennen und nicht wissen, was es auf Deutsch bedeutet. Erinnere während der Besatzungszeit riefen englische Soldaten: Hällo Beibi. Begegneten sie jungen Mädchen. Frage mich, ob Pummelchen auch mich mit Beibi angeredet, weil ich wie ein Mädchen noch unrasiert und schüchtern bin. Egal, ich habe so etwas wie Mama gespürt. Schöner kann ein Urlaub nicht beginnen.
Im Bus bis an den Kai, an dem ein Dampfer dampft. Was soll er anders tun? Sonst käme niemand mehr über seinen Tellerrand hinaus. Jedes Land, jede Stadt, jedes Dorf, ja selbst jeder Mensch bliebe allein. Müsste verkümmern, ohne den Horizont zu erreichen, der hoffen lässt auf Besseres, Schöneres. Jenseits der erfahrbaren Welt auf alle wartet, die ihren Gefühlen folgen. Nicht nur ihrem Verstand.
Man mag nicht glauben, dass einem Waisenkind solche Gedanken kommen. Aber Jupps Ratschlag im Kopf, seinen Gefühlen zu folgen nicht nur dem Verstand. Wissen könne man eh nicht alles. Was er nicht wusste: Aloysia Kuhlenberg, Rektorin einer Schule für geistig behinderte Kinders schrieb in ihrem Buch mit dem Titel «Erziehen heißt lassen»: In jedem Kind steckt mehr als man ihm ansieht. Als er den Titel in einer Buchhandlung sah, wollte Ferdi es kaufen. Neugierig zu erfahren, was sie unter lassen versteht. Gehen, springen lassen, werden lassen, was ein Kind möchte? Nicht zu allem gezwungen wie ein Kind in einem Waisenhaus. Leider war das Buch ausverkauft.
Die Überfahrt nach Alexandria, Ägyptens größtem Überseehafen, verschlafen. Müde und abgespannt. Den Roman vom unbekannten Vater zu Ende gelesen und den Rest der Zeit mehr oder weniger gedöst, an nichts Bestimmtes gedacht. Vielleicht lag es an der höheren Temperatur. Auch nachts 30 °C. Dazu zwei Wochen vor mir, auf die ich innerlich nicht genug vorbereitet bin. Hoffe sehr, es wird so, wie ich es mir gewünscht. Freundlichen Menschen begegne, auch wenn ich ihre Sprache nicht verstehe.
Pummelchen aus den Augen verloren. Schade. Hätte sie gerne in meiner Kabine begrüßt. In der zweiten Koje ein alter Mann, einen dicken Wälzer in der Hand. In dem er während der ganzen Überfahrt blättert und liest. Den Kopf nicht hebt, kein Wort mit mir spricht. Auch nicht beim Essen, bei dem er weiter liest. Kenne das, weil auch ich unbedingt wissen will, ob zwei. die sich lieben, auch heiraten. Aber dieser Mann scheint, je mehr Papier er umblättert, umso glücklicher zu werden.
Ich aber werde dank Lotto-Gewinn zum ersten Mal wissen, was es heißt, wirklich glücklich zu sein. In den Tag hinein zu leben. Zwei Wochen nicht arbeiten, keinem Befehl folgen zu müssen. Genießen, was mir begegnet, wie Pummelchen im Zug. Hier auf dem Schiff das Frühstück serviert bekommen. Danach auf allen Decks spazieren gehen. Treppen rauf und runter. Leute begrüßen, die mich wieder grüßen. So könnte es weiter gehen ein Leben lang. Kann mir leisten, von oben hinunter aufs tiefblaue Wasser zu schauen und nichts zu tun. Nur beobachten, wie Fische sich raufen, aufbäumen und wieder untertauchen. Als spielten sie Räuber und Gendarm, wie wir als Kinder. Rund um das Schiff jede Menge Möwen, die die Route zu kennen scheinen. Wo Köche und Gäste ihnen Essensreste zuwerfen. Wäre ich eine Möwe, brauchte ich nie mehr zu hungern. Nie mehr Geld verdienen, um Brot, Wurst und Gemüse zu kaufen. Begleitete jedes Schiff.
Jetzt aber bin ich ein reicher Mann: Baron Fernando von Fuchs. Vergessen die arbeitsfreien Ferien im Grafenberger Wald bei Düsseldorf. Mir vom Gesparten das billigste Gericht im Restaurant gegönnt oder einen Kinobesuch extra. Jetzt leiste ich mir eine Reise für 2900 Mark.
Nach Ankunft in Alexandria im Bus vier Stunden bis Kairo in einen Sitz gepresst, ohne mich frei bewegen zu können. Nicht umhergehen wie im Zug, einer schönen Frau Komplimente machen. Vorausgesetzt, sie versteht Deutsch. Sie nach ihren Plänen fragen und meine danach richten, wenn ’s im Reisepreis enthalten. Sehne mich nach einem Freund, dem ich vertrauen kann. Zulange gehänselt, das dumme Waisenkind gewesen. Es kann auch eine Frau sein. Freundin werden, Geliebte oder Ehefrau.
Wir wohnen im «Arabian Night Hotel». Nicht weit zu Kairos Sehenswürdigkeiten. Man spricht Englisch, auch Deutsch, zum Glück. Werde mir trotzdem ein kleines Wörterbuch für Touristen kaufen, Deutsch-Englisch-Englisch-Deutsch. Und endlich wissen, was sorry bedeutet. Gespannt auf Sehenswürdigkeiten, von denen ich noch nie gehört, geschweige gesehen. Nur ein paar kleine Fotos im Reise-Prospekt.
Als erstes acht Geh-Minuten zum weltberühmten Basar «Khan el-Kalili.» Ein Markt mit allem, was der Orient bietet. Mindestens zehnmal so groß wie der in Düsseldorf. Eine Stadt in der Stadt. Beeindruckt von Farben, Gerüchen und jaulenden Tönen taumele ich durch Massen von Menschen, verlor den Anschluss an meine Gruppe. Suche verzweifelt den Eingang, durch den wir in den Markt gingen. Da spricht mich ein Ägypter an: „Can I help you?“ Verstehe nicht, muss ein dummes Gesicht gemacht haben: „Sind Sie ein Deutscher?“ Überrascht nicke ich nur. „Wir können gerne Deutsch reden. Habe zwei Jahre in Deutschland bei Blohm & Voss in Hamburg gearbeitet, Deutsch gelernt. Wenn Sie wollen, begleite ich Sie jetzt durch Ägyptens berühmtesten Basar.“
Glücklich, als mir klar wird: Jetzt befielt mir keiner, was ich tun oder lassen soll. Im Gegenteil, er fragt mich, ob ich Lust habe, mich führen lassen will oder nicht. Jetzt bin ich ein Herr. Einer, der sich geschmeichelt fühlt und antworte: „Ja, gerne.“ Erklärt mir, was Ägypter lieben und warum, beidseits der schmalen Gänge kreuz und quer durch den Markt. Obst, Gemüse, lebende Hühner, Enten und Küken, sogar Schlangen und Kröten in engmaschigen Gitterkörben. Geschlachtet Teile von Schwein, Rind, Kamel und Gazelle. Würste, Schinken. Es duftet nach Gebratenem, da nach Fleisch, dort nach Fisch. Aus dem Meer Fische aller Art und Muscheln, Krebse und Kraken, die ich noch nie gesehen. Frisch gefangen für anspruchsvolle Köche und Hausfrauen. Ungezählte Körbe mit Kräutern, Gewürzen, Farben, Gerüche aus Tausend und einer Nacht. Stände mit Gebäck, Berge von Süßigkeiten. Da und dort kleine Mahlzeiten. Aber auch Gold- und Silber-Werkstätten. Lampenbauer, Teppich-Knüpfer. Stoffe in allen Farben des Regenbogens. Von der Decke herunter gehängte farbige Bahnen aus Wolle, Seide und Damast. Teppiche in verschiedenen Größen mit Mustern aus vielen Ländern des Orients.
Sogar ein Schneider, der Besuchern einen Djellaba anmisst. Am selben Tag fertig zum Mitnehmen. Gewand aller Männer in Ägypten, knöchellang. Weiß und weit geschnitten, damit in der Hitze des Tages stets ein Windzug den Körper kühlt. Wäre es bei uns das ganze Jahr so heiß wie hier, würde ich die 30 Mark ausgeben, mir einen nähen lassen. Ginge auch in einem solchen Gewand zur Arbeit. Ha, würden die Augen machen!
Überall kleine Tischchen, an denen Tee serviert, kleine Leckereien. Teils unter Dach und teils im Freien, weiße Markisen über uns kühlen Plätze, wo Menschen sich niederlassen. An einem runden Tischchen bleibt mein Begleiter stehen: „Darf ich Ihnen einen Malventee anbieten?“ Noch nie so leuchtendes Rot aus gläsernen Bechern getrunken. Noch nie so frisch geröstete Mandeln geschmeckt. Noch nie hat mir ein Fremder sein Herz ausgeschüttet. Glücklich nach Jahren in Hamburg wieder in Kairo, seiner Heimat zu sein.
Plötzlich erlischt die elektrische Beleuchtung. Im selben Augenblick leuchten aberhundert Petroleum-Lampen auf. Auch er hat rasch auf unserem Tischchen eine hübsch geformte angezündet:
„Entschuldigen Sie, der Strom fällt öfter als einmal am Tag aus. Das Licht der Öllampe aber seit Tausenden von Jahren hell genug, zu erkennen, was wirklich wichtig ist.“ Bittet mich in sein kleines Lädchen gegenüber, die Lampe in der Hand. Zeigt mir eine Auswahl silberner Teelöffel als Souvenir. Acht Mark war der schönste mir wert. Sein Griff schmückt ein Skarabäus. Kleiner Käfer, als Symbol der Fruchtbarkeit wie ein Gott verehrt. Hätte ich einen Sohn, ich würde ihn Skarabäus nennen. Mit der Aussicht, viele Enkel zu bekommen. Die Zeit vergeht mit Staunen über das alte und neue Ägypten. Die anderen sicher längst wieder im Hotel. Der Mann ohne Namen fährt mich im Korb seines Dreirads zurück. Fühle mich wie der Pharao von Ägypten.
Am nächsten Vormittag einen Vortrag gehört über die Bedeutung einer Moschee bei Muslimen. Das Bauwerk ein Ort, Allah, ihrem Gott zu danken. Zum ersten Mal eine Kirche in Pantoffeln betreten. Auf den zwei Stufen vor dem Eingang in die «Aqsunqur-Moschee» jede Menge Filz-Pantoffeln zur Auswahl. Große für Männer, kleinere für Frauen. Alle ziehen die Schuhe aus, schlüpfen in Pantoffel. Heiligen Boden darf man nicht mit dem Schmutz der Straße verunreinigen. Schlürfen weiß Gott gewöhnungsbedürftig. Sich flach auf den Boden zu werfen bleibt uns erspart. Touristen erlaubt man aufrecht zu gehen, sich alles anzusehen. Bringen sie doch dringend notwendige Devisen ins Land. So nennt man fremdes, eingeführtes Geld.
Langsam schreiten wir durch alle Räume der riesigen Halle, sehen uns um und staunen. In der Kaaba, dem heiligen Raum liegen Männer auf dem Boden, höre sie Gebete murmeln. Alle exakt ausgerichtet in Richtung Mekka. Für Anhänger Mohammeds das, was Jerusalem für Christen ist. Orte, an denen der Gründer ihrer Religion in den Himmel aufgefahren sein soll. In der weiträumigen Moschee mit goldglänzenden Mosaiken überfällt mich plötzlich ein Gefühl, das ich als Kind kennengelernt.
Auch hier denke ich an Gott. Obwohl kein Bild von Allah oder seinem Propheten Mohamed zu sehen ist. Ihre Religion verbietet Abbildungen von Menschen generell. Von Allah, dem Allerhöchsten, Unsichtbaren erst recht. Im Gegensatz zu unseren Kirchen, die voll sind mit Bildern von Christus am Kreuz und vielen Heiligen. Gottvater und Heiliger Geist gemalt oder aus Holz oder Gips geschnitzt, obwohl sie wie Allah ebenso unsichtbar sind. Und keiner weiß, wie sie aussehen.
Schmuck aber sollte sein. Allah zu danken und zu ehren. Deshalb entwickelten Künstler im Laufe der Jahrhunderte hinreißend schöne Kaligraphien. Schrift, die wie Ornamente aussehen. Aus Gips geschnitten Decken und Gewölbe, wirken hier wie Strickmuster im schräg einfallenden Tageslicht. Wände und Gebets-Nischen in Moscheen, Burgen und Herrensitzen mit Mosaiken geschmückt. Auch hier in der Aqsunqur-Moschee immer wieder hingeschaut und es nicht fassen können. Schöneres sah ich nie. Baute ich jemals ein Haus, holte ich einen ägyptischen Künstler und ließ ihn Decken wie Gewölbe in Stuck schneiden, die Wände mit Mosaiken schmücken.
Meine Schuhe fand ich wieder, wo ich sie hingestellt. Kein Dieb hatte sie gestohlen. Obwohl westliche Schuhmodelle in Sandalen-Ländern begehrt sind. Aus echtem Leder in Form gebracht. Früher soll man Diebe hingerichtet haben, die Straßenschuhe von Besuchern vor einer Moschee mitgenommen, konnte man sie überführen.
Nächsten Tages im Bus zu den drei Pyramiden. Habe mir alles gemerkt, was der Reiseführer uns vorher erzählt. Bis dahin noch nie so viel von Königen gehört und gelesen, die schon 5000 Jahre tot sind. Ließen Pyramiden schon zu Lebzeiten bauen, in denen sie nach ihrem Tod bestattet wurden. Großartiger als Burgen früherer Herzöge am Rhein. Schlösser von Kaisern überall in Europa. Dome mit den Reliquien katholischer Heiligen. Christliche Kirchen überstanden Jahrhunderte. Pyramiden aber über vier Jahrtausende, wie ich jetzt weiß.
Frage mich: wer müsste ich sein, damit man für mich später auch so viel Aufwand macht? Müsste schon ein Pharao sein, kein Baron. Ein Handlanger schon gar nicht. So reich werde ich nie sein, um schon zu Lebzeiten ein so riesiges Grabmal bauen zu lassen, das nach 5000 Jahren an mich erinnert, Pilgerströme anlockt. Wer muss ich sein, um ein Pharao zu werden? Baron dagegen ein Leichtes. Nie habe ich mich so klein gefühlt wie hier vor der Pyramide des Cheops. Aber nicht das von anderen gedemütigte Waisenkind.
Viel mehr wie befreit und glücklich, wahre Größe zu erleben. Die Großmut eines Pharao, der mich nicht verjagen oder einsperren lässt, weil ich heiliges Gelände mit schmutzigen Sandalen betreten. Damals als Kind drei Tage kein Mittagessen bekommen. Weil Hemd und Hose nach Schweinestall stanken, den ich säubern musste. Anschießend zum Beichten in die Hauskapelle ging. Den Beichtvater muss es gestört haben, meldete es der Heimleitung. Muslime kennen keine Beichte, ob ich die Religion wechsle und an Allah glaube?
Die größte der drei Pyramiden in Gizeh nahe Kairo. Pharao Cheops ließ sie vor 4500 Jahren errichten. Um in der obersten von vier Kammern im Innern bestattet zu werden, den Göttern nahe. Seine Leiche gewaschen, mit speziellen Ölen einbalsamiert und mit Binden aus Leinen fest umwickelt. Vorher schon alle Eingeweide heraus operiert, weil sie schnell verwesen. Alles Innere anstecken, das dann schnell verfault. Die wichtigsten Organe, Gehirn, Herz und Lunge einzeln in sogenannten Kanopen-Gefäßen in die Grabkammer gestellt. Die leeren Stellen im Körper des Toten mit duftenden Heilkräutern ausgestopft. Damit bleibt, der er war: ein lebender Pharao.
Dem Leichnam im Sarkophag brachten Angehörige jede Woche Nahrung und Getränke. Damit er nicht verhungerte, verdurstete, am Leben bleibt. Bis die Seele, die ihn beim Tod verlassen, wieder in seinen Körper zurückgekehrt. Seele, auf Ägyptisch «Ka», ist unsterblich. Wie in allen Religionen der Welt. Hölle und Fegefeuer kennen sie nicht. Nur unterschiedlich lange Abwesenheit der Seele, die der Totengott «Anubis» bestimmt. Abhängig vom Bemühen des Menschen, auf Erden ein den Göttern gefälliges Leben zu führen. Für alles, was sichtbar, gab es einen Gott. Für jeden einen eigenen Tempel. So stand es im Prospekt.
Gewaltig die Maße der Cheops-Pyramide. Stehe ich davor, komme mir noch viel kleiner vor als ich schon bin. Nur noch winziger Marienkäfer vor dem 146 m hohen Bauwerk. Mehr als 4000 Jahre war es das höchste der Welt. 230 m lang jede der vier Seiten seines quadratischen Grundrisses. Außer mir nur noch zwei unserer Gruppe, die sehen wollen, wie es innen aussieht. Klettern außen steinerne Stufen bis vor den Eingang in fünfzehn Metern Höhe. Hinein in einen niedrigen, schmalen Gang, aufwärts wie alle Gänge zu den drei Kammern. Dürfen nur bis zur ersten Kammer gehen. Dort Skulpturen und vergoldetes königliches Gerät bewundert.
In der obersten der Pharao Cheops, den Göttern nah. Sein Leichnam hat die Jahrtausende leider nicht so erkennbar überdauert wie der des Pharao Ramses II. Schon gar kein Abbild seines Gesichtes erhalten. Wie das des Pharao Tut ench Amun. Dessen goldene Mumien-Maske dem Gesicht des 19jährigen Knaben abgeformt wurde. Cheop nur auf Wandmalereien in seiner Grabkammer. Sein Leichnam im innersten mehrerer ineinander geschachtelter Särge vermutlich auf seidenen Kissen gebettet. Der äußerste Sarg aus massivem Stein. Die inneren aus Bronze oder hartem Holz der Libanonzeder.
Ein Sarkophag, in dem Pharaonen Jahrtausende überlebten. Umgeben von Kanopen mit Innereien, goldenen Gefäßen und kleinen Statuen des Pharao. Kein Sterblicher durfte die Kammer betreten. Seit dem 19. Jahrhundert ist es Archäologen erlaubt, das Innere zu erforschen. Präparierte, noch erkennbare Gesichter von Pharaonen mit erhaltenen Bildern und Plastiken aus ihrer Zeit zu vergleichen.
Nach einer guten halben Stunde endlich wieder an der frischen LuGrell das Tageslicht, Sonnenbrille vergessen, verflixt. Vor den Bussen, die Besucher wieder zum Hotel bringen sollten, eine große Anzahl von Männern im Djellaba. Gestikulieren und reden unaufhörlich. In einer Hand ein Bündel Ägyptische Pfundnoten. Man hatte uns vor Geldwechslern gewarnt, sie böten angeblich mehr als man in Banken bekäme. De facto wechselt man schlechter als beim offiziellen Kurs. Der Profit geht an die Geldwechsler.
Leider soll dieses Geschäft in Deutschland verboten sein. Sonst könnte mich die Idee reizen, den nächsten Lotto-Gewinn am Düsseldorfer Hauptbahnhof zu wechseln, dass mehr für mich übrig bleibt. Das Geld Reisender aus Frankreich oder der Schweiz gegen Deutsche Mark tauschen. Für Franc und Franken von einer Bank mehr Mark bekommen als ich eingetauscht.