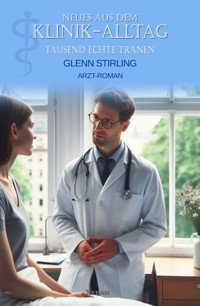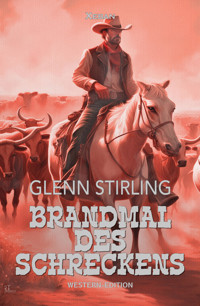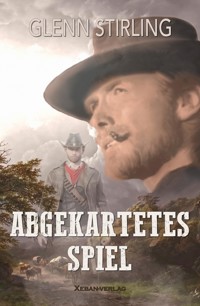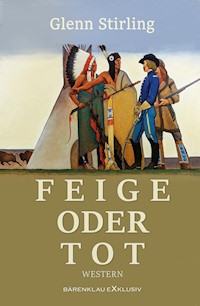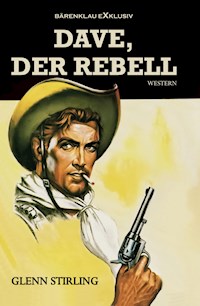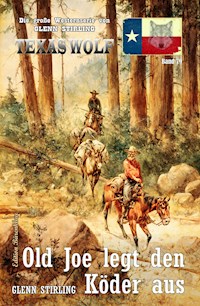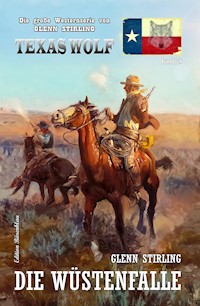3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: XEBAN-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Die vorliegende Geschichte handelt von einem Piratenschiff und seiner Besatzung und sie in allen Einzelheiten wahr.
Wir schreiben das Jahr 1870.
Die berühmte »Sweet Mary«, die von Kapitän Lars Detlevsen geführt wird, ist eine legendäre Dreimastbark, die von Geheimnissen umwittert ist. Mitten im Frieden befindet sie sich auf Kaperfahrt und treibt vor der Küste Amerikas ihr Unwesen. Sie ist in einem geheimen Auftrag mit einer Besatzung unterwegs, wie sie wilder und zusammengewürfelter nicht sein kann; sie ist unterwegs in die Hölle und der Teufel selbst gibt die Kommandos …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Glenn Stirling
Die Männer der sieben Meere
Das Flaggschiff des Teufels
Piraten-Roman
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Authors
© Copyright dieser Lizenzausgabe by XEBAN-Verlag.
Verlag: XEBAN-Verlag: Kerstin Peschel, Am Wald 67, 14656 Brieselang; [email protected]
Lizenzgeber: Edition Bärenklau / Jörg Martin Munsonius
www.editionbaerenklau.de
Cover: © Copyright by Steve Mayer nach Motiven, 2024
Korrektorat: Sandra Vierbein
Alle Rechte vorbehalten!
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt beim XEBAN-Verlag. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Die Männer der sieben Meere
Das Flaggschiff des Teufels
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Über den Autor Glenn Stirling
Das Buch
Die vorliegende Geschichte handelt von einem Piratenschiff und seiner Besatzung und sie in allen Einzelheiten wahr.
Wir schreiben das Jahr 1870.
Die berühmte »Sweet Mary«, die von Kapitän Lars Detlevsen geführt wird, ist eine legendäre Dreimastbark, die von Geheimnissen umwittert ist. Mitten im Frieden befindet sie sich auf Kaperfahrt und treibt vor der Küste Amerikas ihr Unwesen. Sie ist in einem geheimen Auftrag mit einer Besatzung unterwegs, wie sie wilder und zusammengewürfelter nicht sein kann; sie ist unterwegs in die Hölle und der Teufel selbst gibt die Kommandos …
***
Die Männer der sieben Meere
Das Flaggschiff des Teufels
Piraten-Roman von Glenn Stirling
1. Kapitel
Orkan in der Brandungshölle von Cape Cod!
Die Luft war erfüllt von einem alles durchdringenden Getöse. Die Wogen brandeten zu gigantischer Höhe empor. Der Sturm peitschte die Gischt über die Wellenkämme, die zu kochen schienen. Wie Schlünde gähnten die Wogentäler. Eine Hölle war aufgebrochen. Und inmitten dieser Hölle ein Schiff!
Der Gaffelschoner »Harmony« kämpfte sich durch diese Hölle. Wie ein Spielball wurde er auf die Wogenkämme emporgehoben, um unmittelbar danach wieder in ein Wellental hinabgerissen zu werden.
Bis auf das Klüwersegel war alles übrige Tuch geborgen. Aber der Wind riss, zerrte, schlug in das schmale Klüwersegel hinein und war drauf und dran, es zu zerfetzen.
Der Gaffelschoner hatte fünf Männer an Bord, Fischer, die von Island kamen und die Küste von Massachusetts anliefen. Achtzig Meilen waren es noch bis Boston. Hier an der Stelle, wo sich der Meeresgrund des Atlantiks von tiefster Tiefe zur Küste von Massachusetts erhob, herrschte selbst unter normalen Umständen eine Brandung, die schon vielen Schiffern zum Verhängnis geworden war. Die Männer der »Harmony« kannten die Gefahr der Brandungshölle bei Cape Cod. Aber dieses Kennen nutzte ihnen nichts, nicht jetzt im Hurrikan.
Die Männer hatten sich an ihrem Schiff festgezurrt, um nicht vom Deck gerissen zu werden. Der Steuermann und Bootsmann klammerten sich beide an das Ruderrad und zwangen das Schiff weiter auf Westkurs. Ein Beidrehen war jetzt unmöglich. Dafür war der Sturm viel zu stark. Geriet der Schoner dwars zum Wind, würde die glitschige Ladung, die aus Tausenden von Fischleibern bestand, überkommen, also verrutschen, was ein sicheres Kentern zur Folge haben würde.
Noch hielt das Klüwersegel den Schoner im Wind. Aber dann kam, was die ganze Zeit schon von allen erwartet wurde, was sie befürchteten, weshalb sie immer wieder bange Blicke in Richtung Klüwersegel sandten: Ein mörderischer Knall erfolgte, der sogar das Brüllen des Orkans übertönte. Mit diesem Knall flog das Klüwersegel davon, verschwand in dieser Wand sprühenden Gischtes, den der Sturm vor sich hertrieb.
Jetzt war nun der letzte Fetzen Segeltuch zum Teufel. Das Schiff rollte, stampfte, taumelte und gierte auf die sich immer mehr nähernde Küste zu. Und damit drohte auch die Gefahr der Riffe und Untiefen.
Joe Linton, der Bootsmann, stand zusammen mit dem Steuermann am Ruder, versuchte etwas von dem zu erkennen, was sich vor dem Schiff tat. Aber er hatte Mühe, überhaupt zu sehen, was auf dem Vorschiff vorging.
Zwei der Männer hatten sich dort festgebunden. Aber nun, da das Klüwersegel weg war, brauchte der Kapitän jede Hand, um einen Treibanker auszuwerfen. Es war die einzige Möglichkeit, das Schiff jetzt auf Kurs zu halten, da der Wind von achtern kam, und die »Harmony« immer öfter aus dem Ruder geriet.
Der Käptn brüllte die Befehle nach vorn, und der Wind trieb die Worte den Männern zu.
Die Männer versuchten sich loszubinden. Und sie hatten es gerade geschafft, als eine schwere See von achtern überkam und den Rumpf des Schiffes sekundenlang völlig
unter Wasser drückte.
In diesem Moment geschah es!
Die Untiefen vor Cape Cod waren näher gewesen, als Kapitän und Mannschaft in diesem brodelnden Hexenkessel hatten annehmen können. Ein furchtbarer. Stoß erschütterte das Schiff. Die beiden Männer auf dem Vorschiff wurden wie von Geisterhand davongetragen.
Joe Linton versuchte vergeblich am Ruderrad Halt zu finden. Aber eine viel größere, viel mächtigere Kraft packte ihn und riss ihn weg, schleuderte ihn gegen die Wanten, wirbelte ihn über Deck, und er hatte nicht ein einziges Mal die Möglichkeit, sich irgendwo festzuhalten. Dann prallte er mit voller Wucht mit der Schulter gegen die Back, meinte, das Bewusstsein zu verlieren vor Schmerz, aber dann entdeckte er über sich eine mächtige Brechersee, die sich berghoch neben dem Schiff auftürmte, um nun wie vom Himmel herunter auf das Deck zu schlagen.
Joe Linton begriff und handelte sofort. Er konnte sich frei machen, sprang auf, und war mit einem Satz in den Wanten des Großmastes. Trotzdem schluckte er noch Wasser, und die Woge, die über ihm zusammengeschlagen war, nahm ihm sekundenlang den Atem. Als sich das Wasser verlief, war das Deck dort leer, wo sich vorher Joe Lintons beide Kameraden befunden hatten.
Der Steuermann hatte mit Mühe wieder das Ruder erreicht. Aber es war sinnlos. Es gab keinen Kurs mehr zu steuern. Das Schiff war aufgelaufen, hing auf einem der Riffe vor Cape Cod fest. Und was das bedeutete, wussten der Kapitän und Joe Linton. Nur der Steuermann schien es nicht zu begreifen. Er war wie von Sinnen. Er versuchte, das Ruder herumzuschlagen. Er schrie und tobte, und das Haar hing ihm wirr im Gesicht.
In diesem Augenblick senkte sich abermals ein schwerer Brecher wie die Faust eines Riesen auf das Schiffsdeck herab.
Bruchteile von Sekunden später war alles eine einzige brodelnde, schäumende, brüllende Wassermasse, in der Sparren, Taue und Segelfetzen herumgewirbelt wurden … und der Steuermann.
Joe Linton sah ihn noch dicht an sich vorbeifliegen, ohne ihm helfen zu können. Das Meer hatte ihn losgerissen, trug ihn fort, nahm ihn mit, zog ihn hinab in seinen Schlund.
Der Schrei des Kapitäns übertönte noch das Brüllen des Meeres und des Hurrikans.
Joe Linton riss den Kopf herum und sah den Kapitän, der jetzt als schlaffer Körper in den Wanten hing. Und erst auf den zweiten Blick erkannte Joe den zerschmetterten Schädel des Schiffsführers.
Bis jetzt hatte Joe Linton keine Angst empfunden. Sie waren immer mehrere gewesen in der Not. Und irgendwie gab ihm das Halt.
Doch nun befand er sich allein an Bord, an Bord eines Wracks, das am Felsen hing, über das die See herfiel wie ein wütendes Tier und das zerschlagen wurde von dem Meer, geschunden vom Sturm, die Küste nahe und doch endlos weit.
Joe war bis zum Kajütendach geklettert und hatte sich dort an den Ringbolzen festgezurrt. Die Brechseen hoben das Schiff an, um es dann mit noch mehr Wucht erneut auf den harten Grund des Riffes aufzusetzen. Im Sturm schmetterten die in der Luft baumelnden Blöcke, schlugen die abgerissenen Stahldrähte wie Peitschen und schließlich kam, was kommen musste: Der Besanmast brach und ging mitsamt der Takelage steuerbords in die See.
Das so erleichterte Achterschiff hob sich an, und für ein paar Augenblicke lang schien es, als gelänge es dem Wrack, sich vom felsigen Untergrund zu lösen. Doch eine neue See schmetterte es wieder zurück auf die alte Stelle, und der ganze Schiffsrumpf dröhnte, krachte, splitterte, dass Joe Linton meinte, der Rumpf müsste in zwei Teile brechen.
Der Nordost wehte jetzt einen eigenartig warmen Regen über das sterbende Schiff.
Joe Linton krümmte sich zusammen, als es wie aus Eimern auf seinen Rücken schüttete. Er blickte nach Westen, wo irgendwo unsichtbar für ihn die Festlandsküste sein musste. Vierzig Meilen, zwanzig? Oder war es näher? Er versuchte, das Leuchtturmfeuer zu erkennen. Irgendwo dort vorn musste doch das Leuchtfeuer von Cape Cod sein. Aber er sah nichts als diese Waschküche des tobenden Orkans. Darüber ein nahezu nächtlicher Himmel. Ringsum alles grau in grau und noch immer vom tosenden Gebrüll des Orkans erfüllt.
Jetzt erwischte es den Großmast. Bis unterhalb der Saling splitterte er auf, barst und kippte nach Lee in die See.
Abermals machte das Schiff den Eindruck, als wollte es sich vom Felsen lösen. Es wurde angehoben, schwamm frei, schlug dann dwars zum Sturm, krängte, und in diesem Augenblick verrutschte die glitschige, silbrige Ladung aus Tausenden von Fischleibern.
Der Sturm hob die »Harmony« an, und schon schien es, als wollte er sie über die Untiefen hinweg zur sicheren Küste tragen. Doch dann schmetterte er den aufgerissenen Leib des Schoners gegen einen zweiten, noch höher aus dem Meer aufragenden Felsen.
Der Schlag war einfach zu viel für die »Harmony«. Ihr gequälter Leib zersprang, zersplitterte, zerplatzte regelrecht in zwei Teile. Und während das Vorschiff, von den Fluten mitgerissen, davongetragen wurde, kippte das Achterschiff neben dem Riff in die Tiefe, so dass nur der aufgerissene Teil nach oben ragte. Doch als wollte das Meer rasch nachholen, was es versäumt hatte, ergossen sich gewaltige Brecher in die aufgerissene Stelle und füllten diesen halben Rumpf wie eine Tasse auf.
Joe Linton war bei dem Aufschlag von einem herumwirbelnden harten Gegenstand am Kopf getroffen worden und in tiefe Ohnmacht gesunken. Als er jetzt aufwachte, ergossen sich schwere Seen über ihn, und er brauchte eine ganze Weile, um zu begreifen, was ihm geschah. Noch immer war er am Kajütendach festgezurrt. Aber es war eine Frage der Zeit, das begriff er, wann das noch immer festhängende Achterschiff am Riff herabrutschen und mit Joe versinken würde.
In diesem Augenblick näherte sich ein riesiger Brecher. Wie ein gewaltiger Turm schob er sich heran, geradewegs auf das Schiff zu, wie ein Vollstrecker, der gekommen war, um zu vernichten, was sich ihm da noch in den Weg stellen wollte.
Voller Entsetzen starrte Joe Linton diesem riesigen Ungetüm eines Wellentitanen entgegen.
Sekundenlang war er nicht fähig, etwas zu tun. Doch dann verstand er, begriff diese ganze drohende vernichtende Gefahr, der er sich da stellte. Mit hastigen Handgriffen löste er den Tampen, mit dem er sich an die Ringe gebunden hatte, warf sich herum, stürzte auf den Niedergang der Kajüte zu, stürmte voraus, schlug gegen die Tür, die nachgab, und da war er schon drin.
In diesem Augenblick donnerte diese gewaltige Woge auf das Schiff nieder.
Unten, in der Kajüte, war Joe Linton gegen den angeschraubten Tisch getaumelt, krallte sich nun verzweifelt und voller Panik daran fest, während dieser gewaltige Brecher das Schiff zu zertrümmern suchte.
Ein Splittern und ein Krachen und explosionsartige Knalle übertönten alle anderen Geräusche. Auf einmal klirrte es über Linton, wurde heller, und er sah in der Öffnung, wo das Skylight vom Brecher weggerissen worden war, den sturmzerfetzten grauen Himmel.
Unmittelbar danach ergoss sich eine Wasserflut in die Kajüte und überschüttete Linton, der vergeblich am Tisch Halt suchte, und von dieser Flut regelrecht weggespült wurde. Es schwemmte ihn in eine Ecke, wo er mit dem Kopf anschlug. Für Sekunden war er nicht mehr imstande, klar zu denken.
Auf einmal löste sich der Schiffsrumpf vom Riff, drehte sich wie ein Kreisel, schoss in die Tiefe, wurde wieder emporgeschleudert, drehte sich in der Luft und krachte berstend auf die Oberfläche des Meeres zurück.
Joe Linton wurde von einem Schwall Wasser gepackt, herumgewirbelt, mitgerissen und regelrecht aus der Kajüte herausgespült. Er fand sich wieder in der kochenden See inmitten zersplitterter Rahen und Planken, und er hatte Not, nicht von einem dieser Holzstücke erschlagen zu werden.
Linton entdeckte vor sich einen Rettungsring. Der tanzte wie ein Spielzeug auf der Oberfläche einer Woge herum, schien greifbar nahe, und doch gelang es Linton nicht, ihn zu erreichen. Er schwamm, gab seine letzte Kraft, und wäre um ein Haar noch von einer Rahe erschlagen worden, die auf dem Kamm einer Woge herunterschoss und haarscharf neben Linton ins Wasser stürzte.
Aber Joe Linton hatte sich in seiner Verzweiflung in den Kopf gesetzt, diesen Rettungsring zu erreichen. Er sah ihn immer wieder. Mal tauchte er auf, mal war er verschwunden. Linton biss die Zähne zusammen und schwamm beharrlich in der Richtung, wo er den Ring zum letzten Mal gesehen hatte.
Er wusste nicht, wie lange er versucht hatte, den Ring einzuholen, doch schließlich gewahrte er ihn keine Armlänge von sich. Und noch einmal, als er schon versucht war, aufzugeben und der immer stärker werdenden Müdigkeit nachzugeben, nahm er alle Kräfte zusammen und konnte den Ring packen. Er krallte seine Hände in die Leine, die um den Ring herumlief, riss den Ring zu sich und zog ihn sich über den Oberkörper, streckte die Arme darüber und konnte für ein paar Sekunden lang Luft schöpfen.
Sein Schwimmen hatte ihn aus der größten Gefahr herausgebracht. Dort, hinter ihm, wo er vorhin noch gewesen war, wirbelten noch immer in der kochenden See die Wrackteile herum. Reste des Schiffsrumpfes waren sonst nicht mehr zu erkennen. Der Sturm schien das Achterschiff völlig zerschmettert zu haben.
Erst jetzt empfand Linton die eisige Kälte des Wassers. Aber die Erschöpfung, die ihn umfing, war so stark, dass er einzuschlafen drohte. Die Furcht davor ließ ihn sich auf die Lippen beißen. Er rieb sich die Augen, die ohnehin schon vom Salz brannten. Aber die Schwäche wurde immer größer. Als er sich mit der Rechten über den Kopf fuhr, empfand er einen brennenden Schmerz. Und dann, als er mit der Hand vor die Augen geriet, sah er das Blut an seinen Fingern. Doch schon die nächste Welle hatte es ihm wieder weggespült.
Er schwamm, und er lebte!
Irgendwo dort vorn musste die Küste sein! Irgendwo da vorn lag Cape Cod.
Der Sturm ließ immer noch nicht nach. Brecher ergossen sich über Linton, dass er fürchtete, ertränkt zu werden. Und er bekam Hustenanfälle, würgte und erbrach das geschluckte Wasser.
Aber plötzlich war da vorn ein Licht. Nur einen Augenblick lang sah er es. Dann war es wieder hinter einem Wellenberg verschwunden. Doch wenig später schon wurde er auf die Höhe eines Wellenkammes getragen, sah von der Woge herab dieses Licht in derselben Richtung.
Das Leuchtfeuer von Cape Cod!
Es konnte gar nicht weit sein. Aber er war nicht imstande, zu schätzen, wie groß die Entfernung sein mochte. Der Gedanke an das Licht, an die nahe Küste, an die mögliche Rettung gab ihm neue Energie. Und die Hoffnung war eine Kraft, die ihn wachhielt. Er begann trotz seiner Erschöpfung zu singen - ein Krächzen, ein Würgen, kein Gesang. Aber ihm selbst kam es wie ein Siegesschrei vor. Derselbe Wind, der die »Harmony« zerschlagen hatte, trieb ihn jetzt der rettenden Küste entgegen. Ein Hurrikan in diesen Breiten! So etwas gäbe es nicht, hatte der Kapitän noch gesagt, als der Sturm begonnen hatte. Der Kapitän musste es jetzt besser wissen. Aber er hatte diese Erkenntnis mit ins nasse Grab genommen.
Die Tatsache, seine Kameraden verloren zu haben, war Joe Linton noch gar nicht richtig klargeworden. Doch jetzt, wo er in dieser brodelnden See trieb, wo es ihn regelrecht auf die Küste zuschwemmte, da begann er zu begreifen, was überhaupt geschehen war.
Je näher sich Linton der Küste zu bewegte, um so wilder gebärdete sich das Meer. Die geringere Wassertiefe war die Ursache für diese harten, kurzen Seen, die hier im Sturm verursacht wurden. Die Brecher schlugen zu wie Äxte. Das Meer war an der Oberfläche fast nur noch weiß. Überall Gischt. Es sah aus wie ein Schneegebirge.
Aber da war der Sturm, der trieb. Und so oft er auch Joe Linton untertauchte, die Zähigkeit des hageren Südstaatlers ließ ihn überleben. Doch mit einem Mal sah er vor sich eine schwarze zerklüftete Wand aufwachsen, und zugleich hob es ihn empor, als sollte er diesen Felsklotz vor sich von oben bewundern dürfen. Die Woge, die ihn hochtrug, schleuderte ihn mit einer Wucht ohnegleichen in Richtung auf das schroffe, zerklüftete Gestein.
In panischer Angst schrie Linton mit überschnappender Stimme. Er ruderte mit Händen und Füßen. Er spürte, wie der Rettungsring an seinen Hüften niederging, über seine Oberschenkel rutschte und schließlich an den Füßen hängenblieb.
Er hörte sich entsetzt noch immer schreien, flog durch die Luft und sah einen schwarzen Felsschlund auf sich zuschießen, gewahrte noch etwas, das aussah wie ein Strauch, dann flog er schon in diesen Schlund hinein.
Hart streifte es seinen Rücken, dann prasselte etwas gegen seine Schulter, und auf einmal meinte er mit Ruten geschlagen zu werden, bevor ein harter Stoß seinen Kopf traf und ihm die Besinnung nahm.
Die Woge flutete auf den Felsen, riss zurück, aber sie nahm Joe Linton nicht mit. Er war in diesem Strauch hängengeblieben, der dort in der Felsspalte vegetierte. Wie ein Stofffetzen hing dieser Mensch innerhalb der Felsspalte in der Umklammerung des Strauches, während noch immer Wasser vom Felsen in die Tiefe floss.
Neue Brecher brandeten gegen den Felsen, aber sie waren schwächer, spülten nicht bis in diese Höhe hinauf.
Waren es Sekunden oder Minuten, die vergangen waren, bis wieder ein gigantischer Brecher eine Wasserflut in die Felsspalte schleuderte, und diese Wasser brandeten um den Körper des Bewusstlosen herum. Die Eiseskälte des Wassers aber war es, die Joe Linton wieder ins Bewusstsein zurückrief. Verwirrt und von Zwangsvorstellungen geplagt, wachte er auf und begriff nicht, wo er sich befand, bis abermals eine Woge emporgeschleudert wurde und sich über ihn ergoss.
Er schnatterte mit den Zähnen vor Kälte, spürte, wie sein ganzer Körper zu erstarren schien, bis der Lebenswille, bis die Angst vor dem Tod seine anderen Empfindungen überwand. Mit einem Mal ging es ihm nur noch darum, am Leben zu bleiben. Er sah nach unten, wo das Meer kochte, wo es sich hob und senkte und wo die größeren Brecher bis zu ihm empor wuchteten.
Als er nach oben blickte, erkannte er, dass sich der Felsriss verbreiterte, und dass es dort noch mehr solcher Sträucher gab wie jenen, in dem er festhing.
Hand über Hand zog er sich nach oben, und es störte ihn nicht, dass seine Hände aufgerissen waren, dass er sich an den Felsen die Fingernägel abbrach, sich die Arme aufriss und die Schultern stieß. Seine Knie waren zerschrammt, vom scharfen Felsenstein aufgeschnitten, aber es ging ums Überleben. Höher und höher zog er sich empor, und bis hier herauf reichte die Macht des Meeres nicht mehr. Nur der Sturm schleuderte seine Kraft in diesen Felsen hinein, presste Linton förmlich an das Gestein.
Aber das konnte ihm nur recht sein. Als er dann höher kam und sich der Felsen etwas abflachte, gerieten seine Hände sogar in Gras. In Gras, das bis in die Felsspalte hineinwuchs. Er zog sich höher und höher. Und dann lag er da wie ein geprellter Frosch, atmete schwer, musste sich abermals erbrechen, wälzte sich zur Seite und entdeckte jetzt, was vor ihm lag.
Grünes Land, Gras vom Sturm gebeugt, aber kein Busch, kein Baum, nur flaches Land.
Als seine Kraft etwas zunahm, kroch er wie ein Tier auf allen Vieren landwärts, immer weiter zum Landinneren hin. Und er schaute nicht zurück zum Meer, zu diesem brandenden Tod, der hinter ihm war.
Er richtete sich auf, torkelte ein Stück, brach zusammen, stemmte sich abermals empor, torkelte weiter, immer landeinwärts.
Und plötzlich sah er es. In einer Mulde lag es, geschützt und kaum von der See her zu erkennen: Ein Haus, aus Feldsteinen gebaut, trotzig und fest wie ein Stück des Felsens selbst.
Ein Haus, in dem Menschen lebten!
Linton wollte schreien, aber mehr als ein Krächzen kam nicht aus seinem Hals. Er torkelte weiter, fiel hin, immer wieder auf die aufgeschlagenen schmerzenden Knie. Aber er spürte es gar nicht. Doch seine Kräfte ließen nach.
Da vorn war dieses Haus, waren Menschen, war die Rettung.
Er torkelte, fiel abermals, und jetzt hatte er nicht mehr die Kraft, auf die Beine zu kommen. Als er versuchte, wenigstens zu knien und auf allen Vieren dahin zu rutschen, da war der Schmerz in den aufgeschlagenen Knien so stark, dass er mit einem Aufschrei abermals hinfiel und dann reglos liegenblieb.
Noch einmal hob er den Kopf, starrte sehnsüchtig zum Giebel des Hauses hinüber, aber niemand war dort, der ihn erspäht hätte, der gekommen wäre, um ihm aufzuhelfen. Resigniert stöhnte er auf, und seine Stirn sank in das weiche Gras.
2. Kapitel
Er war ein kleiner schwarzer Bastardhund. Der Wind trug ihm die Witterung eines fremden Menschen in die Nase. Er stand draußen an diesem Schutzwall, der nach der Seeseite hin um das Haus errichtet worden war. Und immer noch war diese Witterung. Der kleine Schwarze lief los, folgte der Richtung, aus der diese Witterung kam.
Und dann sah er den Menschen, der reglos im Gras lag.
Furchtlos lief er hin, beschnupperte ihn von allen Seiten, und sein Instinkt sagte ihm, dass der Mensch noch lebte.
Der kleine Schwarze reckte den Kopf empor und bellte. Danach spähte er zum Haus hin. Doch da rührte sich nichts. Nun lief der kleine Schwarze auf das Haus zu, hetzte, als sei der Teufel hinter ihm her, und war dann an der Haustür. Die hatte man verschlossen. Er bellte wieder, kratzte an der Tür, scharrte, und endlich wurde die Tür aufgerissen. Aber eine Hand griff nach dem kleinen Schwarzen und eine zweite schlug ihm übers Hinterteil. Dazu sagte eine barsche Männerstimme schimpfend:
»Wie oft habe ich dir gesagt, dass du dieses Gekratze lassen sollst! Die ganze Tür machst du mir kaputt, verdammter Köter!«
Der Hund jaulte auf, drehte sich im Kreis und lief wieder hinaus.
»Jetzt kommst du rein!«, brüllte der Mann. Aber der Hund blieb sitzen, als wollte er, dass der Mann zu ihm käme.
Es war ein mittelgroßer, breitschultriger Mann, dem die Haare bis über die Ohren zum Hals fielen, rotblonde Haare. Sein Gesicht war kantig, zerfurcht, die Nase breit und zerschlagen, die Augen unter buschigen, wulstigen Brauen.
»Was hast du, zum Teufel? Was ist mit dir?«, fuhr er den Hund an. Der kleine Schwarze lief los, blieb dann wieder stehen, sah sich um, wartete, als hoffte er, der Mann werde ihm nachkommen. Aber der Mann kam nicht. Er blieb in der Tür stehen. »Was willst du, zum Teufel?«
Und der Hund lief wieder los, kam wieder zurück, und endlich begriff der Mann.
Er rief über die Schulter ins Haus hinein: »Der Schwarze hat irgendwas. Vielleicht hat er Strandgut entdeckt.