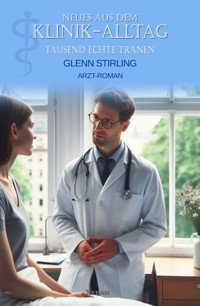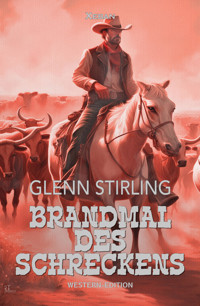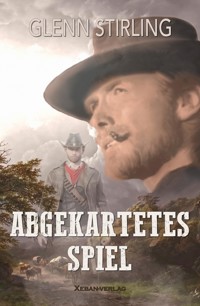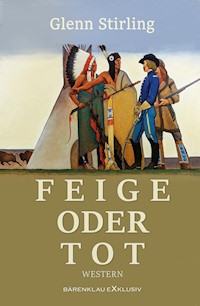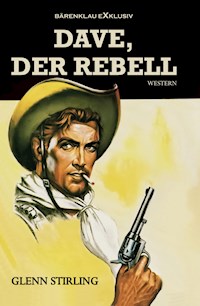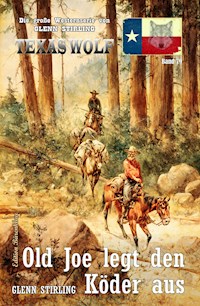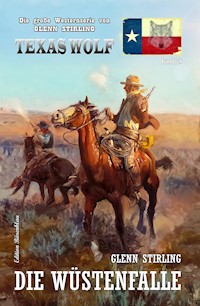3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: XEBAN-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Wir schreiben das Jahr 1936, kurz vor Beginn des 2. Weltkrieges.
Die SANSSOUCI, ein stolzer Ozeanliner, der zu den Rivalen im Kampf ums Blaue Band gehört, ist ein 36.000 BRT-Schnelldampfer: hochmodern und luxuriös.
Sie bringt die US-Olympiamannschaft zur Olympiade nach Berlin. Genau diese Fahrt leitete jedoch das Schicksal dieses herrlichen Schiffes mit allen Menschen darauf ein. Auf dem Rückweg von Bremerhaven in den Heimathafen New York nimmt die SANSSOUCI eine geheimnisvolle Ladung und noch geheimnisvollere Passagiere an Bord …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Glenn Stirling
Die Männer der sieben Meere
Passagierschiff SANSSOUCI
in Seenot
Seefahrer-Roman
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Authors
© Copyright dieser Lizenzausgabe by XEBAN-Verlag.
Verlag: XEBAN-Verlag: Kerstin Peschel, Am Wald 67, 14656 Brieselang; [email protected]
Lizenzgeber: Edition Bärenklau / Jörg Martin Munsonius
www.editionbaerenklau.de
Cover: © Copyright by Steve Mayer nach Motiven, 2024
Korrektorat: Sandra Vierbein
Alle Rechte vorbehalten!
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt beim XEBAN-Verlag. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Die Männer der sieben Meere
Passagierschiff SANSSOUCI in Seenot
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Über den Autor Glenn Stirling
Das Buch
Wir schreiben das Jahr 1936, kurz vor Beginn des 2. Weltkrieges.
Die SANSSOUCI, ein stolzer Ozeanliner, der zu den Rivalen im Kampf ums Blaue Band gehört, ist ein 36.000 BRT-Schnelldampfer: hochmodern und luxuriös.
Sie bringt die US-Olympiamannschaft zur Olympiade nach Berlin. Genau diese Fahrt leitete jedoch das Schicksal dieses herrlichen Schiffes mit allen Menschen darauf ein. Auf dem Rückweg von Bremerhaven in den Heimathafen New York nimmt die SANSSOUCI eine geheimnisvolle Ladung und noch geheimnisvollere Passagiere an Bord …
***
Die Männer der sieben Meere
Passagierschiff SANSSOUCI in Seenot
Seefahrer-Roman von Glenn Stirling
1. Kapitel
Der See lag im kupfernen Abendglanz dieses Spätsommertages. Über den Bergspitzen im Nordosten ballten sich drohende Gewitterwolken zusammen, deren Schatten bis weit über das Schilf am nördlichen Ufer des Lago Maggiore fielen.
Hardy Meichsner kam dieser Anblick wie ein Symbol vor. Ein Symbol der Zeit und dessen, was er von ihr zu erwarten hatte.
Als die Tür des Besucherzimmers knarrte, schreckte er aus seinen Gedanken auf. Er wandte sich vom Fenster ab, blickte die ältliche Sekretärin an, die ihn mit gesenktem Kopf über den Rand ihrer dunklen Hornbrille hinweg ansah.
»Ist es wirklich so wichtig, dass Sie den Grafen stören müssen?«
Jedes ihrer Worte verriet ihre tiefe Missbilligung.
»Es ist eine äußerst wichtige Information, und ich wette mit Ihnen, dass der Graf Sie feuern würde, wenn Sie mich nicht auf der Stelle zu ihm lassen.«
Sie zuckte zusammen wie unter einem Schlag, wandte sich um, öffnete die Tür wieder und rief mit spröder Stimme: »Herr Meichsner ist da.«
Von drinnen schallte es bis ins Besucherzimmer: »Dann herein mit ihm!«
Hardy Meichsner ging an der Sekretärin vorbei, die ihn noch immer verschreckt ansah, schloss die Tür hinter sich und blieb stehen.
Ein dutzend Mal war er schon hier in diesem Raum gewesen, aber es erging ihm wie beim ersten Mal: Er war einfach überwältigt. Diese Wand von Büchern, die schweren massiven Eichenmöbel, dieser Klotz von einem Schreibtisch, der gewaltige Globus, die schweren Leuchter, die kostbaren Vorhänge und Gardinen. Aber alles das war nichts gegen den Anblick der Gestalt, die da in einem riesigen Sessel hinter dem Schreibtisch thronte.
Schütteres graues Haar, einen Kopf wie geschnitzt, an dem vor allen Dingen die Nase auffiel. Sie hatte etwas Raubvogelhaftes an sich. Auch die Augen wirkten wie von einem Greifvogel. Hell, scharf dreinblickend, drohend.
Die Schultern des Mannes wirkten breit. Die ganze Gestalt erinnerte an ein Denkmal. So saß er da und beobachtete seinen Besucher. Kein Muskel in dem kantigen Gesicht schien sich zu bewegen.
Meichsner grüßte kurz; dann trat er an den Schreibtisch heran. Er wartete die Aufforderung, sich zu setzen, nicht ab. Eine solche Aufforderung würde es bei Graf Bendorff nie geben.
Dass er sich unaufgefordert gesetzt hatte, veranlasste den Grafen, die buschigen Augenbrauen als Zeichen seiner Verwunderung nach oben zu ziehen. Aber kein Wort der Missbilligung, keine Frage, nicht einmal den Gruß von Meichsner hatte er erwidert. Er schrieb und wartete.
Hardy Meichsner kannte ihn. Er wusste, dass Graf Bendorff kein Mann vieler Worte war, und es interessierte ihn auch nicht, denn er wurde für das, was er tat, von ihm bezahlt. Gut bezahlt. Man könnte sagen, fürstlich bezahlt.
Hardy Meichsner zog das kleine Notizbuch aus seiner Seitentasche, klappte es auf und las ohne Umschweife vor:
»Am 18. Juli dieses Jahres putscht in Spanisch-Marokko ein General namens Franco mit seinen Offizieren gegen die republikanische Volksfrontregierung. Der Putsch greift rasch auf andere Kasernen, auch auf das Festland Spaniens über, und die Regierung reagiert ziemlich langsam. Trotzdem mobilisiert sie regierungstreue Einheiten gegen Franco und seine Offiziere und gegen die putschenden Einheiten auf dem Festland. Sie hätten eigentlich überhaupt keine Chance gehabt, sich länger als eine Woche zu halten. Im Grunde verfügt dieser General Franco gar nicht über die notwendigen Munitionsreserven, um das Festland überhaupt zu betreten. Aber da geschieht etwas Merkwürdiges. Da taucht vor Tanger in der Nacht ein Schiff auf, löscht auf der Reede vor Tanger seine Ladung, und gleichzeitig gehen mehr als zweitausend Passagiere an Land. Schon wenig später verlassen diese Passagiere die freie Zone von Tanger in Richtung Spanisch-Marokko und schließen sich nach meinen zuverlässigen Informationen den rebellierenden Truppen dieses Generals Franco an. Und er übernimmt wie selbstverständlich die Ladung, die ihm dieses zunächst noch unbekannte Schiff zukommen lässt. Es bleibt zunächst ein Geheimnis, was es für ein Schiff ist. Aber dann stellt sich heraus, dass es sich um die SANSSOUCI handelt. 36.000 Bruttoregistertonnen, eins der schnellsten und schönsten Passagierschiffe dieser Welt.«
Der Graf sah Meichsner aus schmalen Augen an. »Die SANSSOUCI?«, fragte er mit spröder Stimme. »Ich denke …«
Meichsner nickte. »Ich weiß, was Sie sagen wollen. Die SANSSOUCI fährt für eine New Yorker Reederei, und deren Stammkapital befindet sich im Besitz von Gustave Pelliard, einem der mächtigsten, reichsten Männer Frankreichs.«
Der Graf lehnte sich zurück, lächelte und sagte: »Natürlich. Das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Schließlich ist Pelliard mein Freund.«
Unbeirrt fuhr Meichsner in seinem Bericht fort und las weiter aus seinem kleinen Notizbuch vor:
»Nachdem die SANSSOUCI ihre Ladung gelöscht hatte, lichtete sie die Anker und verließ das Mittelmeer in Richtung New York. Ich habe ermittelt, wo sich die SANSSOUCI befunden hatte, bevor sie Tanger anlief. Und zwar war sie nach ihrer Ausreise von New York zuerst nach Bremen gefahren. Fast alle Passagiere waren Zuschauer oder Teilnehmer an der Olympiade 1936 in Berlin. Unter anderem befand sich die amerikanische Olympiamannschaft an Bord. Unter ihnen die größten Favoriten der Amerikaner: Jesse Owens für den Langstreckenlauf, und Morris für den Zehnkampf. Dort in Bremen sind ganz offensichtlich jene »Passagiere« an Bord gegangen, die sich später den Truppen dieses Generals Franco anschlossen.
Auf dem Weg nach Bremen hat die SANSSOUCI auch Southampton angelaufen. Dort ging diese Mrs. Simpson von Bord, von der die ganze Welt redet, dass sie die Geliebte des englischen Königs Edward VIII. wäre.«
Der Graf hob abwehrend die Hände. »Diese Geschichte interessiert jetzt nicht.«
»Sie hat aber einige Bedeutung, Graf«, widersprach Meichsner. »Dieser Edward VIII. ist äußerst deutschfreundlich. In Großbritannien hat sich im Verhältnis zum Deutschen Reich einiges geändert, und das spielt auch hier eine Rolle.«
»Im Augenblick interessiert mich nur dieses Schiff. Berichten Sie mir, was geschehen ist, nachdem es Tanger in Richtung New York verlassen hat.«
»Es ist der neueste Stand, Graf. Mehr weiß ich noch nicht. Ich habe keine Ahnung, welche Fahrt die SANSSOUCI antritt, wenn sie in New York wieder Passagiere an Bord genommen hat.«
»Nun gut. Dann habe ich jetzt einen Auftrag für Sie; einen neuen Auftrag. Ich weiß, dass Sie lange zur See gefahren sind, dass Sie Offizier an Bord von Frachtschiffen waren, deshalb werde ich Ihnen eine Position als Zweiter oder Dritter Offizier an Bord der SANSSOUCI verschaffen. Es kann auch sein, dass es eine andere Rolle ist, die Sie dort spielen müssen. Aber wie ich erwarten kann, werden Sie Ihrer Aufgabe gerecht werden.«
»Welche Aufgabe genau, Graf Bendorff? Es kann doch nicht bloß die sein, dass ich die Arbeit eines Schiffsoffiziers oder was immer an Bord der SANSSOUCI erfüllen muss.«
Zum ersten Mal lächelte Graf Bendorff, und sein eben noch so kantiges wie gemeißelt wirkendes Gesicht entspannte sich.
»Natürlich nicht«, sagte er leise, beugte sich ein wenig yor und fuhr fort: »Ich muss wissen, was die SANSSOUCI an Bord nimmt, ich muss wissen, wohin sie fährt, ich muss alles erfahren, was hinter der Geschichte steckt, die Sie mir hier eben gerade vorgesetzt haben.«
»Ich bin sicher, dass der französische Geheimdienst ebensolche Anstrengungen unternehmen wird.«
Der Graf winkte ab. »Mich interessiert kein Geheimdienst. Mich interessiert, was hier geschieht.«
Er strich sich nachdenklich übers Kinn, warf einen prüfenden Blick auf Meichsner, starrte dann aber zum Fenster hinaus auf den abendlichen See. Und wie zu sich selbst sagte er: »Wir werden ein Schiff chartern. Ein schnelles und gutes Schiff mit einer zuverlässigen Besatzung, das die SANSSOUCI vor dem europäischen Festland erwarten wird, wenn sie das nächste Mal von New York kommend da eintrifft. Und Sie, Meichsner, werden da schon an Bord der SANSSOUCI sein. Dazu benutzen Sie ein Flugzeug. Wie Sie ja wissen, hat die deutsche Lufthansa mit ihrem Flugboot Do 18 acht Flüge von Europa über die Azoren nach New York geplant und davon, wie ich heute Morgen noch gelesen habe, vier erfolgreich hinter sich gebracht. Der nächste Flug findet übermorgen statt, und ich werde Ihnen einen Platz in dieser Maschine besorgen, koste es was es wolle.
Sobald die SANSSOUCI sich mit Ihnen an Bord dem Festland nähert, nehmen sie Verbindung mit dem Schiff auf, das dort auf Sie wartet. Sie erhalten, wenn Sie in New York ein treffen, durch unseren Mittelsmann zusätzliche Anweisungen, die ich Ihnen jetzt noch nicht geben kann. Und nun, Meichsner, machen Sie sich auf den Weg. Die formellen Dinge und die Finanzierungsfragen besprechen Sie am besten draußen mit meiner Sekretärin.«
»Eine Frage, Graf Bendorff, ist Rose nicht mehr da?«, erkundigte sich Meichsner.
Der Graf lächelte. »Sie werden sie wiedersehen. Sie werden sie in Paris wiedersehen. Denn das vergaß ich Ihnen zu sagen: Ich möchte gerne, dass Sie in Paris bei Monsieur Pelliard vorbeifahren und ganz kurz mit ihm sprechen. In seinem Vorzimmer werden Sie ganz sicher Mademoiselle Rose begegnen …«
2. Kapitel
Traditionsgemäß heulte der Typhon des großen Passagierschiffes auf, als die SANSSOUCI die Freiheitsstatue vor New York passierte. Voraus die Skyline von Manhattan, Symbol eines freien, mächtigen Landes.
Kapitän Dale, ein großer hagerer Mann mit dunklem Haar, stand oben auf der Brücke und blickte nachdenklich auf die Kette der Wolkenkratzer, die sich vor ihm zeigten. Neben ihm stand Jack Powell, sein IO (Erster Offizier), ein blonder Mann mit kühnem Gesichtsausdruck.
»Ich bin froh, dass wir in Lissabon Leute an Bord genommen haben. Wie stünden wir jetzt da, wenn kein einziger Passagier an Bord wäre.«
Jack Powell schwieg. Er wusste, was es für Passagiere waren. Die meisten von ihnen hatten diese Fahrt nicht zu einem reinen Vergnügen angetreten, sondern waren Flüchtlinge. Zum großen Teil Juden, die voraussahen, was ihnen dieses Deutschland des Dritten Reiches bescheren würde und die die Gelegenheit der Olympiade nutzten, um dieses Dritte Reich zu verlassen. Über Frankreich waren sie bis nach Portugal gekommen. Nur wenige von ihnen hatten sich in einem dieser Länder, die auf dem Wege lagen, niederlassen können. Und jetzt war Amerika ihre große, vielleicht auch ihre letzte Hoffnung.
Es gab allerdings auch ein paar Erste Klasse-Passagiere. Doch im Großen und Ganzen standen die Kabinen der ersten Klasse leer. Auf der Fahrt über den Atlantik hatten sich nur wenige Gäste am Kapitänstisch befunden. Die meisten der Passagiere fuhren in der Touristenklasse. Bei manchen hatte der Zahlmeister großzügig mit dem Fahrpreis entgegenkommen müssen, denn ein Zwischendeck gab es auf der SANSSOUCI nicht.
Gravitätisch rauschte der Passagierdampfer auf den Hafen zu. Jetzt war der Augenblick gekommen, wo die Schlepper längsseits kamen und die SANSSOUCI gleich an den Haken nehmen würden. Der Lotse befand sich auch schon seit geraumer Zeit an Bord. Er stand halbrechts bei den beiden Schiffsoffizieren und gab seine Anweisungen an den Rudergast.
Die SANSSOUCI war ein großes Schiff, und entsprechend geräumig hatte man Ruderhaus und Brücke angelegt. Und sie war auch ein sehr modernes Schiff. Von französischen Ingenieuren entworfen, befand sie sich im Eigentum einer der solventesten amerikanischen Reedereien. Nur wenige Leute in Amerika wussten, dass diese Reederei zu einundfünfzig Prozent im Besitz eines französischen Magnaten war.
Nicht einmal Kapitän Dale hatte davon genaue Kenntnis.
Ein Beiboot näherte sich von Manhattan her und kam längsseits.
»Na endlich«, meinte Kapitän Dale und sah ungeduldig auf die Uhr. »Es wird ja höchste Zeit, dass Finch kommt.«
Ein paar Minuten später meldete ein Läufer die Ankunft von Mr. Alexander Finch. Kurz darauf empfing Kapitän Dale den Gast in seinem Salon.
Genau wie Dale war Finch ein großer Mann, hager, so etwa Ende Vierzig. Dale fiel auf, dass Finch seit dem letzten Zusammensein eine deutliche Spur grauer geworden war.
Sie begrüßten sich lächelnd. Dann nahmen sie in den behaglichen Sesseln Platz, und ein Steward servierte auf Dales Geheiß hin einen Drink.
Als der Steward verschwunden war und die beiden Männer ihre Gläser in den Händen hielten, noch immer ein verbindliches Lächeln in den Gesichtern, da begann schließlich Finch das eigentliche Gespräch, dessentwegen sie zusammengekommen waren. Und das Lächeln schwand jäh aus seinem Gesicht.
»Ihr Umweg über Lissabon ist offensichtlich nicht unbemerkt geblieben. Wenn Sie mit dem Schiff festmachen, werden Journalisten an Bord kommen und Ihnen ein paar Fragen stellen, von denen eine lautet: Wen haben Sie in Bremen an Bord genommen? Und eine zweite wird lauten: Wohin haben Sie diese Menschen und diese Fracht gebracht?«
Dale lächelte. »Es war eine humanitäre Aufgabe, die ich da erfüllt habe. Flüchtlinge; ebensolche Flüchtlinge wie jene, die ich hier an Bord habe.«
»Wohin haben Sie diese Flüchtlinge gebracht?«, wollte Finch wissen.
»Aber ich habe es Ihnen doch über Funkspruch mitgeteilt. Diese Leute sind in Tanger in der Freizone von Bord gegangen.«
»Natürlich«, sagte Finch, »das haben Sie mir mitgeteilt. Und Sie behaupten, das seien Flüchtlinge gewesen? Juden etwa?«
Dale zuckte die Schultern. »Ich weiß es nicht. Vielleicht Juden. Sie hatten ihr ganzes Gepäck, sie hatten alles dabei.«
»Frauen und Kinder natürlich auch.«
»Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich nicht um alle meine Passagiere, obgleich ich verantwortlich dafür bin, dass es ihnen gutgeht. Aber Klagen sind mir nicht zu Ohren gekommen. Da müsste ich mich schon mit dem Zahlmeister unterhalten, wieviel Frauen, Kinder und Männer es gewesen sind. Ich kenne nur die Gesamtzahl. Es waren 2248.«
Finch beugte sich vor und blickte Dale durchdringend an.
»Kapitän, wir können diese Antwort nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Man wird Ihnen sehr eindringliche Fragen stellen. Sie dürfen nicht vergessen, dass die Interessen der politischen Mächte auf der Welt sehr unterschiedlich sind. Uns geht es aber nicht um die Politik; uns geht es darum, dass wir ein kaufmännisches Unternehmen haben, eine Reederei, die Profit machen soll. Es ist zwar gut, wenn die sich von der deutschen Reichsregierung Flüchtlinge auf das Schiff setzen lassen und an irgendeinen Ort dieser Erde bringen, wo sie die Möglichkeit haben, freie Menschen zu sein. Es besteht aber auch die ganz erhebliche Gefahr, dass es sich nicht um Flüchtlinge gehandelt hat, sondern um Soldaten. Soldaten, die unter dem Vorwand, Flüchtlinge zu sein, einem putschenden General zur Verfügung gestellt werden und um Kriegsmaterial, das sich ebenfalls an Bord dieses Schiffes befand.«
»Kriegsmaterial?«, fragte Dale sichtlich überrascht. »Ich hatte nur das Hab und Gut der Flüchtlinge an Bord, sonst nichts.«
Finch lehnte sich zurück. »Wollen Sie mir das im Ernst erklären?«
Dale zuckte die Schultern. »Ich weiß nicht mehr, und mehr möchte ich auch nicht wissen. Sie haben vorhin ganz recht gesagt, dass es sich bei einer Reederei um ein kaufmännisches Unternehmen handelt, das Profit machen muss. Ich habe die Fracht im Voraus kassiert. Der Zahlmeister wird Ihnen die Abrechnung vorlegen, das Geld aushändigen, und ich glaube zugunsten der Reederei das Beste getan zu haben. Bis jetzt habe ich nicht unter dem Zwang gestanden, meine Passagiere einer Gehirnwäsche unterziehen zu müssen, oder in jeder Kiste, die sich an Bord befindet, nachzusehen, was sie beinhaltet. Ich bin nicht von der Polizei, und ich bin kein Zöllner.«
Finch nickte, als hätte er eine andere Antwort nicht erwartet. »Und wie sieht es mit Ihrer Mannschaft aus? Ist die auch so fest in der Überzeugung, alles recht und gut getan zu haben, und nicht einen Deut davon weiß, was wirklich hinter dieser Geschichte steckt?«
»Meine Mannschaft wird Ihnen keine andere Antwort geben können als die, welche ich Ihnen gegeben habe.«
Finch erhob sich. »Nun gut. Ich habe inzwischen ein Telegramm bekommen. Ein Telegramm aus Paris. Dazu muss ich Ihnen erklären, dass einundfünfzig Prozent der Reederei in den Händen eines französischen Multimillionärs liegen. Eines Mannes, der mächtiger ist, als Sie es sich vorstellen können. Und dieser Mann möchte Sie, wenn Sie das nächste Mal nach Europa kommen, sprechen. Und er hat mich beauftragt, das sage ich Ihnen im Vertrauen, Sie ganz eindringlich danach zu befragen, ob es sich tatsächlich um Flüchtlinge gehandelt hat, wie vor allen Dingen von Deutschland aus behauptet wird, oder aber um Soldaten. Und das ist eine Behauptung, die zum Teil von französischen Gazetten ausgeht.«
Dale zündete sich eine Zigarre an, machte den ersten Zug und blickte gedankenverloren dem Rauch nach, den er dann ausblies. Schließlich sagte er langsam und jedes Wort überlegend: »Will dieser Franzose, dem einundfünfzig Prozent der Reederei gehören, vielleicht einen anderen Kapitän?«
Finch hob beschwörend die Hände. »Um Himmels willen! Das hat kein Mensch gesagt. Er würde es auch nur über meine Leiche verlangen können. Dann müsste er mich ablösen. Und noch bin ich der Manager der Reederei, noch bestimme ich, wen wir als Kapitän einstellen. Nein, das kommt gar nicht in Frage! Sie sehen mich auf Ihrer Seite. Aber der Verdacht, dass es sich um Soldaten gehandelt hat, die von der Naziregierung jenem faschistisch angehauchten, putschenden General Franco zur Verfügung gestellt werden, ist natürlich ausgesprochen worden, und man muss ihn entkräften.«
Dale lächelte geringschätzig. »Was schreiben denn die Engländer? Ich hatte auf der Hinfahrt einige sehr prominente Passagiere an Bord, unter anderem auch ein Teil des Freundeskreises um König Edward VIII.«
»Ich weiß, ich weiß. Mrs. Simpson war an Bord, und noch einige mehr. Mr. Dale, lassen Sie sich von mir sagen, das hat alles keine Bedeutung. Es interessiert nicht, was die Engländer sagen, und wen Sie an Bord Ihres Schiffes hatten. Das sind nur Ablenkungsmanöver. Hier geht es um etwas anderes. Dieser Gustave Pelliard, dieser Mann, dem einundfünfzig Prozent unserer Reederei gehören, der Mitinhaber von Ölgesellschaften, Raffinerien, Stahlfabriken und vielem anderen mehr auf dieser Welt ist, dieser Gustave Pelliard ist ein eingeschworener Feind Hitlers. Das müssen Sie wissen. Und wenn wir bei der These bleiben, dass es sich um Flüchtlinge gehandelt hat, und Ihre Geste im Grunde eine humanitäre Hilfe war, dann müssen Sie dafür sorgen, dass es nichts, aber auch gar nichts gibt, wodurch das Gegenteil bewiesen wird. Ich möchte auch keinerlei solcher Aktionen mehr billigen; halten wir uns von jeder Politik fern. Dieses Schiff ist ein Passagierdampfer, einer der modernsten und schönsten der Welt, und dabei wollen wir es belassen. Wir wollen Passagiere über die Ozeane fahren, wir wollen ihnen den luxuriösesten Service bieten und trotzdem guten Verdienst machen. Aber wir wollen keinesfalls uns in den Dienst irgendeiner Sache stellen, die uns nachher zum Verhängnis wird.«
Dale sagte nichts dazu. Er blickte auf seine Zigarre, drehte sie zwischen den Fingern und sah schließlich Finch an, als erwartete er von ihm weitere Äußerungen.