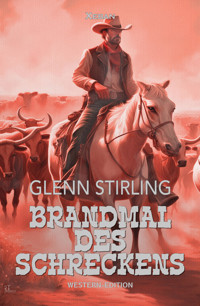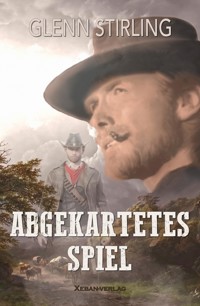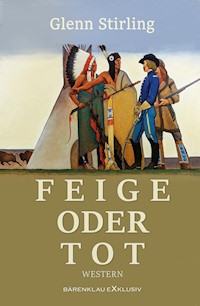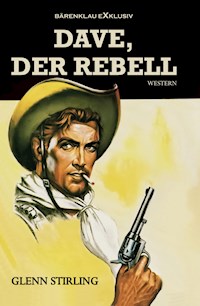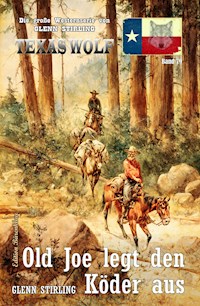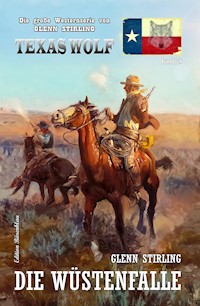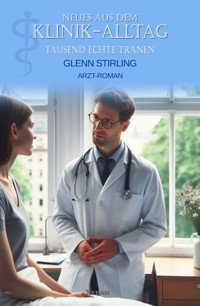
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: XEBAN-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Deutschland Mitte der 1950er-Jahre. Neid, Intrigen und Ängste – aber auch Liebe – junger Menschen, die Ärzte werden möchten, unterscheiden sich im Krankenhausalltag von damals zu heute nur geringfügig.
Da wäre die hübsche Asiatin Sora, die als Krankenschwester in der Peter-Fröhlich-Klinik angestellt ist. Sie erfährt die bittere Wahrheit über ihren derzeitigen Freund Ben, als er ihr schonungslos und ohne Umschweife mitteilt, dass er sich von ihr trennt und das Krankenhaus verlässt. Nach außen hin bewahrt Sora ihr Gesicht, doch im Inneren zerspringt ihr Herz in tausend Stücke.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Glenn Stirling
Neues aus dem
Klinik-Alltag
Tausend echte Tränen
Ein Arzt-Roman
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Authors
© Copyright dieser Lizenzausgabe by XEBAN-Verlag
www.xebanverlag.de
Verlag: Xeban-Verlag: Kerstin Peschel, Am Wald 67, 14656 Brieselang; [email protected]
Lizenzgeber: Edition Bärenklau / Jörg Martin Munsonius
www.editionbaerenklau.de
Cover: © Copyright by Claudia Westphal mit einem Motiv von edeebee, 2024
Korrektorat: Ilka Richter
Alle Rechte vorbehalten!
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt beim XEBAN-Verlag. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Neues aus dem Klinik-Alltag
Tausend echte Tränen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Das Buch
Deutschland Mitte der 1950er-Jahre. Neid, Intrigen und Ängste – aber auch Liebe – junger Menschen, die Ärzte werden möchten, unterscheiden sich im Krankenhausalltag von damals zu heute nur geringfügig.
Da wäre die hübsche Asiatin Sora, die als Krankenschwester in der Peter-Fröhlich-Klinik angestellt ist. Sie erfährt die bittere Wahrheit über ihren derzeitigen Freund Ben, als er ihr schonungslos und ohne Umschweife mitteilt, dass er sich von ihr trennt und das Krankenhaus verlässt. Nach außen hin bewahrt Sora ihr Gesicht, doch im Inneren zerspringt ihr Herz in tausend Stücke.
***
Neues aus dem Klinik-Alltag
Tausend echte Tränen
Arzt-Roman von Glenn Stirling
1. Kapitel
Ein halbes Jahr hatte sie Ben für das Glück ihres Lebens gehalten. Die Gerüchte über ihn waren von ihr ignoriert worden. Aber dann erfuhr sie eine konkrete Tatsache, keine Klatscherei. Einfach eine erschütternde Wahrheit. Er wollte weg. Er wollte sie einfach verlassen, klammheimlich. Und er wollte zu einer anderen, der er gehörte. Sie wartete auf ihn, wollte, dass er dies alles ihr selbst sagen wollte. Und er kam …
Schwester Sora lehnte am Fenster, als Ben eintrat. Sie trug noch ihre Operationskleidung, der Mundschutz hing herunter und sie sah fragend auf den großen und breitschultrigen, dunkelhaarigen Arzt, der jetzt die Tür hinter sich schloss und sich der zierlichen, hübschen Koreanerin zuwandte.
»Du hast mich rufen lassen? Du also. Habt ihr im OP nichts zu tun?«, erkundigte er sich vorwurfsvoll und zog die buschigen Augenbrauen wie im Zorn zusammen.
Sora fiel es nicht leicht, die Frage zu stellen, die sie jetzt stellen wollte. Sie entsann sich der mitleidigen Blicke ihrer Kollegen und Kolleginnen vom Operationsteam, und sie dachte an so vieles andere mehr, das mit ihr und vornehmlich aber mit Ben zusammenhing, der da vor ihr stand. Vor allen Dingen aber war es die bange Furcht vor der Antwort, die er ihr auf ihre Frage geben sollte.
»Du willst fort?«, wollte sie wissen.
Er hatte den Kittel geöffnet, hakte die Daumen in die Seitentaschen und nahm eine herausfordernde Haltung ein. »Na und? Bin ich hier etwa angekettet? Mir schmeckt hier schon lange einiges nicht mehr.«
»Meinst du mich?«, fragte sie leise.
Er ahnte nicht, was in ihr vorging. Auch jetzt lächelte sie. Verriet nicht, wie es in ihr tobte und wühlte. »Mit dir hat das doch nichts zu tun«, behauptete er. »Ich komme mit Rose nicht klar, das weißt du doch. Ich kann diesen Kerl nicht ausstehen! Immerzu schnauzt er herum!«
»Er ist ein hervorragender Arzt«, erklärte sie.
»Dann weißt du mehr als ich«, entgegnete er scharf. »Immerhin bin ich selbst Arzt. Aber wenn du das besser beurteilen kannst …«
»Ich bin seit acht Jahren in dieser Klinik, und an jedem Operationstag, den Doktor Rose operiert hat, war ich als OP-Schwester am Tisch. Ich glaube auch, dass ich beurteilen kann, was ein guter Arzt ist. Er ist ein guter Arzt.«
»Es geht jetzt nicht nur um ihn. Es geht um alles hier.«
Sie nickte, als habe sie verstanden. »Also auch um mich. Oder etwa nur um mich?« Sie sah ihn fragend an. Wieder las er die Angst. Jetzt lächelte sie nicht mehr. Und nun begann er zu begreifen, wie es um sie stand.
Er kam auf sie zu, quälte sich ein Lächeln ab und meinte beruhigend: »Wir können doch Kontakt halten. Hamburg ist zwar eine ganze Ecke weg von hier, aber …« Sie hatte noch eine zweite Frage, ein Gerücht, das ihr zu Ohren gekommen war. Mein Gott, das ganze Haus hier wird es wissen, und ich habe es, vermutlich, zuallerletzt erfahren. Und dann fragte sie: »Ist es wahr, dass du verheiratet bist?«
Er zuckte wie unter einem elektrischen Schlag zusammen. »Wer sagt das?«, fuhr er sie an.
Also ist es wahr, dachte sie und sah zu ihm auf. Er war ein sportlicher Typ, ein Bär. Und ›Bär‹ hatte sie ihn immer genannt. Neben ihm wirkte sie in ihrer Zierlichkeit wie ein Kind. Seine Kraft hatte sie geliebt. Alles an ihm war ihr so wunderbar erschienen, das halbe Jahr an seiner Seite, die Stunden des gemeinsamen Glücks. Und nun stand eine Lüge zwischen ihnen; hoch wie eine Mauer, die unüberwindbar schien.
»Es ist also wahr?«, fragte sie leise.
Er wandte sich ab. Er brachte es nicht fertig, ihr jetzt in die Augen zu sehen, in diese treuen, zuverlässigen Augen.
»Es ist wahr, ja, es ist wahr. Aber du weißt ganz genau, dass du mir mehr bedeutet hast.«
»Du hast es mir nie gesagt«, stellte sie fest. Sie tat es, ohne die Stimme zu erheben, und es war eigentlich kein Vorwurf herauszuhören. Einfach eine schlichte, aber im Grunde doch niederschmetternde Feststellung.
Er sah sie wieder an, stemmte die Arme in die Hüften, blickte auf sie herunter und meinte: »Ich habe mich eine lange Zeit mit meiner Frau überhaupt nicht verstanden. Ich wollte mich von ihr scheiden lassen. Ja, das wollte ich. Ich hatte auch Angst, dass du es erfährst. Ich gebe es zu, ich hatte Angst, dass du dann nichts mehr von mir wissen willst. Aber die Dinge laufen nun mal im Leben nicht immer so, wie man es vorausberechnet.«
Sie ahnte es und sprach es aus. »Du gehst zu ihr zurück, nicht wahr?«
Er nickte nur, wandte sich um und begann im Zimmer auf und ab zu wandern. Er hatte die Arme hinter dem Rücken verschränkt, hielt den Kopf gesenkt und begann jetzt zu reden, als doziere er vor jungen Studenten oder Medizinalassistenten: »Ich habe dich sehr geliebt, Sora. Aber meine Frau hat zwei Kinder. Und letztlich geht es mir um die Kinder. Sie brauchen ihren Vater, verstehst du? Ich hatte geglaubt, mein eigenes Glück wäre auch nicht unwichtig. Aber mittlerweile muss ich zugeben, dass ich auch die Pflicht habe, mich um die Familie zu kümmern …«
Sora lachte plötzlich. Sie konnte einfach nicht anders, sie musste lachen. Und mit schrill klingender und sich überschlagender Stimme unterbrach sie ihn: »Es ist schön, dass du nun weißt, was du mir sagen musst. Aber das alles kommt zu spät. Du hättest es mir früher sagen müssen.«
Er starrte sie an wie ein Fabelwesen. In dieser Tonart hatte er sie noch nie sprechen hören. Immer war sie ihm wie das niedliche anlehnungsbedürftige Mädchen aus dem fernen Asien vorgekommen; hübsch, schmusig und treu wie Gold. Mit diesem neckischen und liebenswerten Akzent in ihrem so tadellosen Deutsch. Auf einmal kam etwas in Sora durch, das er bei ihr gar nicht vorhanden geglaubt hatte. Sie konnte energisch, ja, wie er meinte, sogar bissig werden. Und eine Kostprobe davon sollte er bekommen, bevor er dazu kam, etwas zu sagen.
»Ich werde für dich kämpfen, hast du einmal gesagt. In der Not hält man zusammen, das hast du auch gesagt. Wenn wir beide uns immer liebhaben, werden wir die dicksten Mauern einrennen, das hast du auch gesagt.«
Sie lachte wieder. Aber ihr Lachen klang angriffslustig und gefährlich. Darin war nicht die mindeste Spur von Fröhlichkeit enthalten. Und ihr sonst so liebevoller Blick ähnelte jetzt eher dem einer angreifenden Tigerin.
»Du bist, hast du einmal gesagt, ein Mensch, der seine Freunde sorgfältig auswählt. Du bist, hast du gesagt, ein Mann, der zu seinem Wort steht.« Sie lachte abermals. Und dann fuhr sie mit schneidend scharfer Stimme fort: »Weißt du, was du wirklich bist, Doktor Ben Moll? Du bist ein Feigling. Du hast dich, so sagt man doch auf Deutsch, wie ein Dieb in der Nacht davonstehlen wollen. Durch Zufall habe ich erfahren, dass du gekündigt hast.«
»Ich wollte es dir die ganze Zeit sagen«, beteuerte er und spürte gleichzeitig, dass sie es geschafft hatte, ihn in die Defensive zu drängen. Vorhin noch wollte er sie herausfordern, nach dem Motto, dass der Angriff die beste Verteidigung sei. Aber jetzt stand er in der Ecke. Und er fühlte sich in diesen Augenblicken dieser kleinen zierlichen Person so unterlegen, dass er am liebsten aus dem Zimmer gelaufen wäre. Und sie war noch lange nicht fertig. Sie hatte eben erst begonnen, ihn mit Worten zu geißeln, und fuhr dann fort: »Du wolltest einfach verschwinden! Du wolltest mir gar nichts sagen! Du hattest Angst davor, mir die Wahrheit zu beichten! Eine Frau und zwei Kinder! Du erkennst plötzlich die Verpflichtung der Verantwortung! Du lügst, wenn du den Mund aufmachst! Es fällt dir sogar leicht. Du redest große Dinge. Sie kommen dir nur so über die Zunge. Weißt du, was man in meiner Heimat sagt: ›Die Sonne leuchtet nur bis auf die Haut, aber nicht auf deine Gedanken!‹. Ich habe deine Gedanken zu spät lesen können, Ben, viel zu spät«, fügte sie resignierend hinzu. »Ich bin schuld an allem, weil ich dir geglaubt habe, weil ich gedacht habe, dass das, was du sagst, auch der Sinn deiner Gedanken ist.«
»Nun tu nur nicht so, als wäre ich der einzige Mann in deinem Leben gewesen. Menschenskind, solche Enttäuschungen kommen nun mal vor. Ich habe selbst einige davon hinter mir. Meinst du, mir macht es Spaß, nach Hamburg zurückzugehen? Ich würde es am liebsten mit dir gemeinsam tun.«
»Hast du mich danach gefragt?« Jetzt lächelte sie wieder. Das war dieses unverbindliche Lächeln, das im Grunde die Gedanken verbarg, die sie beherrschten; dieser Schmerz, die Bedrängnis, das alles, was sie in Wirklichkeit erfüllte. Das Lächeln sollte dies vertuschen.
»Ich kann dich doch nicht mitnehmen nach Hamburg, wo meine Frau lebt. Früher oder später wäre sie dahintergekommen und …«
»Und dann hättest du Angst gehabt, nicht wahr? So ein großer, starker Mann wie du. Aber er hat Angst wie ein kleiner Junge.«
Er fühlte sich verhöhnt von ihr. »Also, wenn du nicht sachlich mit mir diskutieren kannst …«
Sie lachte wieder und unterbrach seine Worte damit. Gelassen und noch immer lächelnd meinte sie: »Es ist gut, Ben. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Geh! Geh weg! Fahr nach Hamburg zu deiner Frau und deinen Kindern! Sie haben ein Recht auf dich. Aber ich hätte vielleicht auch das Recht gehabt, dass du selbst zu mir kommst und es mir sagst.«
»Ich fahr’ ja noch nicht jetzt. Ich fahre erst morgen früh. Ich hätte es dir natürlich noch gesagt, ganz klar.«
Sie sah ihn von unten herauf an nickte, als habe sie keine andere Antwort erwartet und flüsterte: »Ganz klar, Ben. Ich weiß. Natürlich hättest du es mir gesagt.«
»Das glaubst du nicht?«, meinte er, als er den Zweifel in ihren Augen las.
»Ich glaube dir alles. Alles habe ich dir geglaubt, Ben. Geh jetzt! Geh! Ich habe den Stab zwischen uns schon zerbrochen.«
Er sah sie verwirrt an, blieb noch ein paar Augenblicke unschlüssig stehen, und als sie ihn urverwandt anlächelte, wandte er sich abrupt um und ging hinaus, ohne sich noch einmal umzudrehen. Als die Tür hinter ihm zuschlug, verwandelte sich das Gesicht Soras. Aus dem lächelnden Antlitz wurde eine steife Maske. Der Blick der schönen Mandelaugen schien starr zu werden. Um die Lippen dieser schönen Koreanerin zuckte es. Aber keine Träne rann über ihre Wangen, nur die schlanken, im Operationsraum so begehrten Hände verkrampften sich.
Dann schien sie sich einen Ruck zu geben, richtete sich auf, und in ihr Gesicht kehrte Entschlossenheit zurück. Es war, als habe sie etwas von sich abgestreift. Sie verließ ebenfalls den Raum, sah nicht rechts und links, und ging mit kurzen, aber zielstrebigen Schritten auf das Vorbereitungszimmer des OP zu. In wenigen Minuten würde die nächste Operation stattfinden. Und sie, die von allen Operateuren so hochgeschätzte Schwester Sora, wurde dort gebraucht.
2. Kapitel
Markus Renner ging am Schluss des Gefolges von Dr. Lerch bei der Visite. Außer dem Oberarzt, dem Stationsarzt, der Stationsschwester und zwei Assistenzärzten waren zwei Medizinstudenten, die als Famulus ihre praktische Zeit an der Klinik ausüben mussten, bei der Visite anwesend. Markus Renner war seit einer Woche als Famulus der gynäkologischen Abteilung zugeteilt. Er trug einen weißen Kittel wie die Ärzte, hatte ein Stethoskop wie die Ärzte und sah mit seinen fünfundzwanzig Jahren für die Patienten auch wie ein Arzt aus. Aber er war es noch nicht, obgleich es bis zu seinem Staatsexamen nicht mehr weit hin war.
Markus Renner hatte Angst. Jedes Mal bei der Visite zitterte er vor Aufregung und gab sich Mühe, am Schwanz des Gefolges zu bleiben, sich möglichst vor den Blicken des Oberarztes zu verstecken. Denn Markus Renner fürchtete nichts mehr als den Auftrag, womöglich einer Patientin eine intravenöse Spritze geben zu müssen.
Er hatte schon viele Male an künstlichen Versuchsarmen die Injektionsspritze gesetzt, aber eine Puppe ist kein Mensch. Und Markus Renner hatte vor nichts so viel Angst wie vor dem Augenblick, da er bei einem richtigen Menschen eine wirkliche Spritze in eine richtige Vene setzen musste. Schon bei dem Gedanken flatterte er, und so erging es ihm auch diesmal. Er hoffte, der Kelch möge auch heute Vormittag an ihm vorübergehen.
Sie kamen in Zimmer 317 der gynäkologischen Station, das inoffiziell das ›Operationszimmer‹ genannt wurde, weil hier Fälle nach größeren Operationen lagen.
In diesem Zimmer befanden sich vier Frauen. Eine davon, eine jüngere, war schon längere Zeit hier. Sie bekam regelmäßig Injektionen. Das wusste Markus Renner. Und dies war auch der Grund seiner Angst. Meist musste ein Famulus oder ein Medizinalassistent diese Injektionsspritze setzen. Gestern hatte das die Medizinalassistentin Dr. Hella Pusch tun müssen. Und sie konnte es hervorragend. Vorgestern war der zweite Famulus mit dieser Aufgabe betraut worden. Und es war glimpflich abgegangen. Markus Renner fürchtete, dass es ihn heute treffen könnte. Bevor er noch das Zimmer als letzter betrat, überlegte er, ob es nicht besser wäre, wenn er einfach davonliefe, vortäuschte, auf die Toilette gehen zu müssen, bloß, um nicht dranzukommen. Aber das wäre aufgefallen. Ganz sicher hätte es die Stationsschwester bemerkt. Und Schwester Else hatte einen Blick für Leute, die sich drücken wollten. Sie hatte ein goldiges Herz für jemand, der Hilfe brauchte, aber sie konnte steinhart sein, wenn jemand versuchte, seine Pflicht nicht zu tun.
Markus Renner hatte es schon im Gespür, dass er heute und jetzt auserwählt war. Und dann stand er bereits im Kreise der anderen, fühlte den Blick von Oberarzt Dr. Lerch auf sich ruhen, sah das Lächeln im Gesicht des Arztes und hörte dessen wohlvertraute Stimme sagen: »Nun, lieber junger Freund, die Patientin bekommt wieder ihre intravenöse Injektion. Ich glaube, das werden Sie heute mal erledigen, nicht wahr?«
Markus Renner meinte einen Kloß im Hals zu haben, wollte etwas antworten und spürte zugleich, wie ihm die Knie weich wurden.
Fortlaufen, dachte er, einfach wegrennen.
Aber er blieb stehen, und wie automatisch nahm er die Injektionsspritze, die ihm Schwester Ingrid aufgezogen hatte. Dabei lächelte sie ihm aufmunternd zu. Er lächelte dankbar zurück und merkte, dass er zu zittern begann, als er die Spritze in der Hand hielt.
Um Himmels willen, zusammenreißen, einfach so tun, als wäre das die Versuchspuppe und kein wirklicher Mensch, dachte er. Ich bringe es hinter mich. Was soll schon passieren? Ich hab’ es doch am Versuchsobjekt immer gekonnt. Also werde ich’s auch jetzt können.
Wie im Traum schritt er auf die Patientin zu, die schon ihren Arm hinhielt, und wie im Trancezustand legte er die Oberarmbandage an, sah ganz dicht neben sich das Gesicht von Schwester Else, dem Dragoner, wie man sie hier auf der Station nannte. Auf einmal wirkte ihr Gesicht gar nicht mehr so streng. Und doch wuchs die Angst, verstärkte sich das Zittern in Markus Renners Hand.
Das Gesicht der jungen Patientin sah er immer nur wie einen weißen Fleck. Er hatte das Gefühl, durch eine Milchglasscheibe zu schauen. Das Lächeln der Frau nahm er gar nicht wahr. Sie hielt ihm tapfer ihren Arm hin. Vielleicht ahnungslos, was in dem jungen Mann vorging.
Die Nadelspitze näherte sich der Armbeuge. Die Vene war kaum zu erkennen. An dem Plastikarm der
Versuchspuppe hatte die Vene sich abgezeichnet wie eine oberirdische Rohrleitung. Hier aber versuchte er vergeblich zu erkennen, wo überhaupt die Vene war.
Die Furcht lähmte ihn regelrecht. Mit seiner linken Zeigefingerspitze fuhr er über die Stelle hinweg, wo die Vene liegen musste. Stationsschwester Else hatte eben die Armbeuge desinfiziert. Jetzt blickte sie vorwurfsvoll auf den jungen Mann und raunte ihm zu: »Nicht mit dem Finger!«
Der Anraunzer machte ihn noch nervöser. Das Zittern wurde so stark, dass es alle, die in der Nähe waren, erkannten, auch die Patientin.
»Sagen Sie mal«, fragte Dr. Lerch, »was ist denn los? Fühlen Sie sich nicht wohl?« Natürlich konnte er sich denken, was in den Famulus gefahren war.
»Herr Oberarzt, sollte nicht jemand anderer …«, begann Schwester Else und blickte Dr. Lerch fragend an. Er nickte ihr zu. »Also gut, machen Sie das, Schwester.«
Und dann kam die rettende Hand von Schwester Else, die dem zitternden Famulus die Spritze wegnahm und sie dann mit unübertrefflicher Sicherheit an die Vene setzte, einführte, ohne danebenzustechen und unnötigen Schmerz zu verursachen.
Markus Renner folgte dem Rudel hinter dem Oberarzt her wie im Traumzustand, als es weiterging. Aber draußen auf dem Flur blieb der Oberarzt dann stehen, wandte sich um und blickte Markus Renner scharf an und sagte: »Wir wollen uns nachher noch einmal unterhalten.«
Plötzlich lachte jemand im Gefolge des Oberarztes. Markus Renner war es, als würden Schläge auf seinen Rücken erteilt. Er zuckte richtig zusammen, sah dann zur Seite und blickte in das Gesicht einer jungen Medizinalassistentin. Er kannte ihren Namen nicht. Aber sie erinnerte ihn an irgendwen, ohne dass er in der Lage gewesen wäre zu sagen, um wen es sich da handelte. Sie war etwa so alt wie er, hatte blondes Haar, trug das Haar zum Pferdeschwanz gerafft und sah ihn voller Spott an.
Allerdings hatte niemand in dieses Lachen eingestimmt. Und Dr. Hella Pusch, die andere Medizinalassistentin, meinte ein wenig vorwurfsvoll: »Nun tu mal nicht so. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.«
Dr. Lerch wandte sich schweigend um und ging zum nächsten Zimmer. Seine Gefolgschaft trottete hinterher … bis auf Markus Renner.
Er war stehengeblieben, wandte sich jetzt um, ohne dass jemand auf ihn achtgab. Als sich die Tür hinter dem letzten aus dem Gefolge geschlossen hatte, lief er wie von Furien gehetzt zurück zur Treppe, nahm nicht den Lift, sondern fegte die Stufen hinunter, rannte fast noch einen Pfleger um, und stürmte dann in den Umkleideraum im ersten Stock. Dort riss er sich förmlich den weißen Kittel herunter, hängte ihn hastig auf den Haken, wusch sich die Hände, zog sich seine Jacke über und war nach wenigen Minuten wieder draußen. Er stürmte die Treppe hinunter, jagte durchs Foyer und wollte zum Ausgang. Da fiel ihm ein, dass er im Labor seine Aktentasche mit der Monatskarte der Straßenbahn hatte. Er machte kehrt und eilte den rechten Seitengang entlang zum Labor.
Als er seine Tasche hatte, stürmte er wieder zurück und wollte aus der Klinik heraus. Er war wie besessen von der Idee, hier wegzukommen.
Ich kann kein Arzt sein. Ich werde das nie können. Ich bin unfähig. Ich schmeiß’ das ganze Studium hin. Ich bring’ es einfach nicht fertig, eine Spritze zu setzen. Ich Versager, ich Niete! Diese Vorwürfe hämmerte er sich immer wieder in den Kopf. Das Gelächter dieser Medizinalassistentin hatte er noch in den Ohren wie Paukenschläge.
Er war so in seine Gedanken vertieft und rannte fast, als vor ihm eine Tür aufging, eine Schwester heraustrat und er mit ihr zusammenprallte.
Er sah nur etwas Grünes, konnte seinen Lauf nicht mehr stoppen, und da war es schon passiert. Etwas klirrte auf die Steinfliesen, hüpfte noch auf dem Boden herum. Er hörte einen spitzen Schrei, und dann sah er, wen er da umgerannt hatte. Es war Schwester Sora. Sie trug noch Operationskleidung.
Sie starrte ihn verstört an, während aus ihren Augen Tränen liefen.
»Um Gottes willen, habe ich Sie verletzt?«, keuchte er, schluckte und wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. Dann erinnerte er sich daran, dass etwas zu Boden gefallen war, blickte hin und sah, dass es sich um irgendwelches Operationsbesteck handelte. Er kniete sich hin, las alles zusammen, tat es auf das ebenfalls am Boden liegende Tablett, richtete sich auf und trat zu Schwester Sora hin, die immer noch wie stocksteif dastand.
Als er vor ihr stehenblieb, kam ihm ihr Blick glasig vor. Sie lächelte plötzlich. Aber es war so maskenhaft verzerrt, so unwirklich, dass er fragte: »Habe ich Sie wirklich nicht verletzt? Mein Gott, was ist denn mit Ihnen? Sie weinen ja! Schwester Sora …«
Sie war immer so nett zu ihm gewesen. Wenn er bei den Operationen den Haken halten musste, um dicht dabei zu sein, da hatte sie ihm nicht mit der Verächtlichkeit manch anderer Operationsschwester dieses oder jenes gesagt, sondern sich immer hilfreich ihm gegenüber benommen und stets freundlich.
»Schwester Sora«, fragte er fast flehentlich, »ist denn wirklich nichts? Warum weinen Sie denn? Tut es so weh?« Er fasste sie an den Schultern, richtig besorgt, dass er sie doch verletzt haben könnte.
Sie schüttelte den Kopf. Und immer noch gequält lächelnd erwiderte sie: »Nein, nein. Es ist nichts. Es ist schon gut.«
»Entschuldigen Sie«, stieß er hervor.