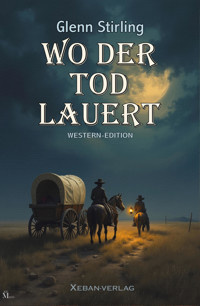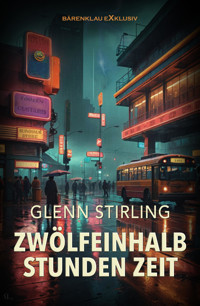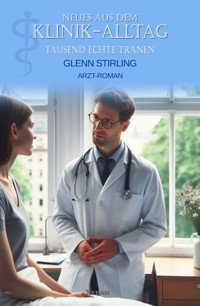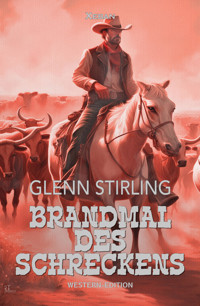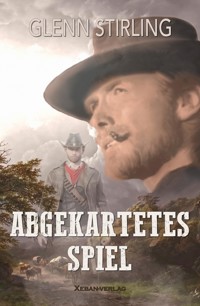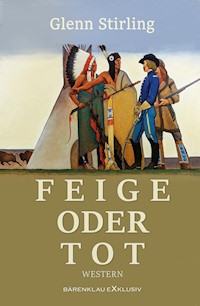3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
p>Zwei großartige Western von Glenn Stirling in einem Band. Sei nicht feige, oder du bist tot. Das ist ihr Motto im täglichen Kampf ums Überleben. Doch bei jedem guten Vorsatz gibt es einen Haken, der alles zunichtemachen kann.
Eroll Slaughter und weitere sieben Cowboys der Slaughter-Ranch sind unfreiwillig der US-Armee beigetreten. Petro Sugarez gelingt es jedoch, zu desertieren. Mit Glenn Scott und dem Vormann Jack Stinner macht er sich auf den Weg, Eroll und die anderen aus der Armee herauszuholen. Ein sehr schwieriges Unterfangen, denn die Cowboys sind bereits mit zwei Abteilungen ausgeritten, um Indianer aufzuspüren. Als sie auf eine Übermacht der Apachen stoßen, führt Captain Donelly sie ungewollt in eine Sackgasse, aus der es kein Entrinnen gibt …
Oder – wer überfällt die Postkutsche nach Blue City, wenn sie mit Geldkisten beladen ist? Auf der Suche nach den Banditen geraten die Gesetzeshüter auch auf falsche Fährten, und dann sind da noch zwei tückische Kopfgeldjäger, die Ärger machen. Ist der tote Revolvermann Blackburn, auf den eine Prämie ausgesetzt hat, in Wahrheit noch am Leben? Und was hat die eigensinnige Rancherstochter Ginger damit zu tun? – Nichts ist, wie es scheint!
In diesem Band sind folgende Western von Glenn Stirling enthalten:
› Feige oder tot
› Der Mann aus der Wüste
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Glenn Stirling
Sei nicht feige, oder du bist tot
Zwei Western
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer mit Edward Martin, 2022
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die Handlungen dieser Geschichten sind frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Feige oder tot
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Der Mann aus der Wüste
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Anhang
Hier ist eine kleine Auswahl der von Glenn Stirling erschienen Western, weitere finden Sie auf der Plattform Ihres Vertrauens.
Das Buch
Zwei großartige Western von Glenn Stirling in einem Band.
Sei nicht feige, oder du bist tot. Das ist ihr Motto im täglichen Kampf ums Überleben. Doch bei jedem guten Vorsatz gibt es einen Haken, der alles zunichtemachen kann.
Eroll Slaughter und weitere sieben Cowboys der Slaughter-Ranch sind unfreiwillig der US-Armee beigetreten. Petro Sugarez gelingt es jedoch, zu desertieren. Mit Glenn Scott und dem Vormann Jack Stinner macht er sich auf den Weg, Eroll und die anderen aus der Armee herauszuholen. Ein sehr schwieriges Unterfangen, denn die Cowboys sind bereits mit zwei Abteilungen ausgeritten, um Indianer aufzuspüren. Als sie auf eine Übermacht der Apachen stoßen, führt Captain Donelly sie ungewollt in eine Sackgasse, aus der es kein Entrinnen gibt …
Oder – wer überfällt die Postkutsche nach Blue City, wenn sie mit Geldkisten beladen ist? Auf der Suche nach den Banditen geraten die Gesetzeshüter auch auf falsche Fährten, und dann sind da noch zwei tückische Kopfgeldjäger, die Ärger machen. Ist der tote Revolvermann Blackburn, auf den eine Prämie ausgesetzt hat, in Wahrheit noch am Leben? Und was hat die eigensinnige Rancherstochter Ginger damit zu tun? – Nichts ist, wie es scheint!
In diesem Band sind folgende Western von Glenn Stirling enthalten:
› Feige oder tot
› Der Mann aus der Wüste
***
Feige oder tot
1. Kapitel
»Unterschreiben Sie!«, sagte der stämmige Sergeant und drückte seinen klobigen Zeigefinger auf eine Stelle des vorgedruckten Formulars.
Zwei Corporale flankierten den jungen Burschen, der mit glasigen Augen auf die Uniformierten starrte. Das blonde Haar hing ihm wuschelig in die Stirn, seinem Mund entströmten Wolken von Alkoholdunst, und in der Linken hielt er noch die leere Flasche, die ihm der eine Corporal spendiert hatte.
Von draußen drang der Klang der Tanzmusik durch das offene Fenster. Ein Mann lachte entfernt, und kurz darauf kicherten Mädchen.
»Unterschreiben Sie endlich, Mann!«, sagte der bullige Sergeant erneut und hielt dem jungen Burschen den Kiel hin. »Dann können Sie wieder zurück zu den Mädchen. Sie warten doch schon!«
»Warten die?«, lallte Eroll Slaughter mühsam. »Ich will aber nicht schreiben. Ich will zu den Mädchen …«
»Los, mach keinen Zirkus, Mann!«, knurrte der Sergeant. »Hol ihm noch eine Flasche, Jim!«
Der Corporal griff zum Schrank und brachte eine gefüllte Brandyflasche zum Vorschein. Er entkorkte sie, und hielt sie dem jungen Slaughter so hin, dass er danach greifen konnte. Der versuchte das auch, aber der Corporal rückte sie ihm sofort wieder aus den Fängen.
»Erst schreiben, Eroll!«
Und Eroll beugte sich über den Tisch, ergriff den Kiel und ächzte: »Wo, zum Teufel?«
»Hier!« Der Sergeant presste wieder den Finger auf jene Stelle. Slaughter nickte schwerfällig und begann zu schreiben. Eckig, ungelenk und mit einem dicken Klecks hinter seinem Namen. Dann richtete er sich auf, lächelte, als habe er ein großes Werk vollbracht und rülpste ergriffen.
Der Corporal ließ ihn einen Schluck aus der Flasche trinken und sagte: »Nun hau ab!«
Der andere Corporal – ebenfalls nicht mehr jung und geschult im Umgang mit frisch geworbenen Rekruten -, bugsierte Slaughter an die Luft. Als er allein zurückkam, lachte er und sagte: »Das wäre der Achte heute. Na, wenn die morgen aufwachen, werden sie Augen machen.«
Der Sergeant grunzte etwas Unverständliches, nahm selbst einen Schluck aus der Flasche und knurrte dann: »Eigentlich eine Schweinerei, wie wir sie anwerben – aber wie sonst soll der General je ein neues Regiment auf die Beine bringen.«
Der Corporal nahm sich die Flasche, trank ebenfalls und erwiderte: »Ich bin nur gespannt, was das noch für ein Theater gibt. Dieser Slaughter ist Texaner. Die in eine Uniform zu pressen, ist schon ein Kunststück.«
»Wenn er desertiert, wird er an die Wand gestellt. Das ist ganz einfach. Ist doch nur ein armes Schwein. Nach dem fragt keiner, wenn er plötzlich bei der Kavallerie herumspringt. Passt nur auf, dass ihr nicht mal einen erwischt, wo der Alte ein Rancher ist oder so was. Dann kriegen wir Stunk.«
»Ach wo«, erklärte der Corporal, »die sind alle acht aus einer Mannschaft. Haben Vieh angetrieben und besaufen sich nun. Seit drei Tagen tun sie das, und jetzt ist die Kasse leer. Slaughter hatte keinen Cent mehr im Beutel, als ich ihm die Flasche hingestellt habe. Der hat sich so gefreut, dass er weitersaufen kann.«
»Gut, Männer, dann brechen wir für heute ab. Morgen früh werden die acht Burschen eingesammelt, und für uns geht es dann auf neue Suche.«
Die Sonne stand schon hoch, als Eroll Slaughter auf einem rumpelnden Wagen aus seinem Rausch erwachte. Er blinzelte benommen, rieb sich die Augen, tastete nach seiner Stirn, die ihm vorkam wie ein unter Druck stehender Behälter, dann wollte er sich aufrichten. Aber es gelang ihm erst beim zweiten Versuch, denn der Wagen schaukelte zu sehr.
Die Hitze unter der Plane war zum Ersticken. Eroll wusste noch immer nicht, wo er war, und hatte das dringende Bedürfnis, sich zu übergeben. Vor allem sehnte er sich nach frischer Luft. Doch was er jetzt sah, kam ihm wie ein schlechter Traum vor. Vor ihm lagen zwei Cowboys der Mannschaft, der er auch angehörte. Sie hatten offenbar noch mehr getankt und waren anscheinend erst auf halbem Wege zum Erwachen. Fünf andere Männer hockten an den Planken. Auch Cowboys aus der Mannschaft seines Vaters. Sie grinsten ihn grimmig an, und allesamt wirkten sie ziemlich mitgenommen.
»Verdammt, Jungs, was ist das für ein Schaukelkarren? Wo stecken wir denn?«, krächzte Eroll heiser. Aber bevor ihm einer antwortete, sah er schon einen neunten Mann hinten an der Planke. Einen kräftigen Burschen mit strohblondem Haar unter dem Armyhut. Ein Soldat, genauer hingesehen ein Corporal der US-Kavallerie.
»Haben wir irgendwo ein Depot gesprengt?«, fragte Eroll schuldbewusst. »Eh, Jungs, redet doch!«
Da ergriff Mike Dummings das Wort für die anderen.
»Eroll«, sagte er sanft, »Eroll, du und wir alle haben gestern im Suff etwas unterschrieben.«
»Unterschrieben?«, bellte Eroll.
»Ja, Eroll, wir haben unterschrieben, dass wir von nun an freiwillig bei der Army dienen. Für zwei Jahre.«
Eroll rieb sich erneut die Augen, doch er träumte das alles nicht. Und die Männer vor ihm waren wirklich seine Kameraden. Ebenso wie der Strohblonde hinten an der Planke ein echter Soldat zu sein schien.
»Freiwillig? Bei der Army? Ich?«, stammelte Eroll. »Das ist gelogen!«
Mike grinste schief.
»Es ist nicht gelogen. Die Schweine haben uns besoffen gemacht und uns dann …«
»Dann gilt es nicht!«, rief Eroll. »Wo ist überhaupt Stinner?«
»Er ist eingelocht.« Mike sah hilfesuchend auf seinen Kameraden, der ihm zur Linken hockte. »Sag du es ihm, Steve!«
Steve zuckte nur mit den Schultern. An seiner Stelle antwortete ein dunkelhaariger Mann mit deutlich mexikanischem Einschlag.
»Der Capataz hat kurz vor unserer Abfahrt erfahren, dass sie uns reingelegt haben, Chico. Und da ist er hin und hat mit dem Sergeanten Krach bekommen. Er hat ihn zusammengeschlagen, aber sie waren zu elf Mann. Jetzt sitzt er beim Sheriff. Er hatte keine Chance, Amigo.«
»Vormann Stinner eingelocht, ein Vormann der Slaughter-Ranch! Sind die total verrückt? Wenn mein Alter das erfährt, jagt er die ganze Mannschaft hierher! Der schlägt diese Yankeefratzen in Teile!« Eroll wollte noch viel mehr ankündigen, aber da schrie ihn der Corporal hinten an der Planke an: »Wenn du verdammtes Großmaul nicht aufhörst, die Armee zu beleidigen, legen wir dich quer über eine Deichsel und schlagen dir die Haut vom Hintern!«
Eroll bewies, dass er von seinem mächtigen Vater noch eine Menge geerbt hatte. Er schrie zurück: »Das müsst ihr verdammten Blaubäuche mal versuchen! Aber mein Alter wird es euch heimzahlen und jeden von euch Yankees auf einen guten Baum verfrachten, wo er euch langzieht!«
»Wer ist denn dieser große Mann, heh? Vielleicht der Präsident der USA, wie?«
»Ich heiße Slaughter«, entgegnete Eroll, und er sagte das, als habe er eben verkündet, er sei Abraham Lincoln. »Eroll Slaughter. Aus Texas. Vielleicht begreifst du jetzt?«
»Nein«, erwiderte der Corporal. »Ich weiß nur, dass du eine verflucht große Schnauze hast, die wir dir bei der Armee winzig klein machen.«
»Habt ihr gehört, er weiß nicht, wer die Slaughters sind!«, rief Eroll. Das kränkte ihn fast mehr als die Tatsache, für die Army geschnappt zu sein.
»Er ist ein Yankee aus Boston. Das hört man«, sagte Mike. Und zu dem Corporal gewandt, fuhr er fort: »Slaughter hat in Texas die zweitgrößte Ranch. Sie ist größer als zehn oder zwanzig Bostons zusammen.«
»Dann wird es ihm guttun, wenn er mal zur Army kommt, dieser Rotzjunge!«, rief der Corporal.
»Ihr werdet euch aber wundern«, meinte Eroll. Er sah zu dem mexikanischen Cowboy hin, der ihm vorhin die Story von Stinners einsamen Kampf erzählt hatte. »Pepe, haben wir eine Chance?«
»Sie reiten zu zehn Mann neben und hinter dem Wagen. Wir haben keine Waffen mehr. Ich weiß nicht, Hermano, aber ich glaube, wir haben jetzt erst einmal keine Chance.«
»Keine Chance?«, fragte Eroll und sah sich wild um. Er versuchte die Plane anzuheben, um nach draußen zu sehen. Sie war so festgezurrt, dass er sie nicht lösen konnte.
Der Corporal lachte.
»Ihr werdet noch sanft wie Lämmer. Und wer desertiert, bekommt eine Kugel ins Hirn.«
»Du hast etwas vergessen, Kleiner«, sagte Eroll wütend. »Du hast vergessen, dass ihr uns geschnappt habt.«
Der Corporal spie aus, zuckte mit den Schultern und meinte höhnisch: »Das müsst ihr erst mal beweisen. Wir haben Zeugen genug, dass ihr freiwillig unterschrieben habt. Die US-Army presst niemanden in ihren Dienst.«
Eroll wollte etwas sagen, aber da legte ihm der etwas ältere und ruhigere Mike die Hand auf den Arm.
»Moment, Eroll!«, sagte er und wandte sich dem Corporal zu. »Habt ihr schon mal Texaner auf diese Weise zur Armee geholt?«
»Hier noch nicht, aber es macht keinen Unterschied«, erklärte der Corporal spöttisch. »Ihr seid nicht besser als andere.«
Mike nickte, als stimme er zu, doch er entgegnete ruhig: »Das ist euer tragischer Irrtum, Blaubauch. Doch ihr werdet selbst dahinterkommen. Eroll, am besten ruhst du dich noch etwas aus. Don und Juan sind ja auch noch nicht wieder aufgewacht. Wir haben sagenhaft viel Zeit, Eroll.«
Eroll glaubte in Mikes Gesicht etwas zu erkennen, was nach einer Idee aussah.
»Hmm, hoffentlich ist es dann nicht zu spät.«
Mike lächelte.
»Abhauen können wir immer, aber ich möchte den Augenblick nicht verpassen, wo wir diesen Hundesöhnen, die uns hier ins Netz gezogen haben, eine Tracht Prügel verpassen, an die sie sich lebenslänglich bestens erinnern.«
Der Corporal hatte es natürlich gehört und sagte barsch: »Das werde ich melden. Dafür werden sie euch gleich einsperren, wenn wir in Fort Verde sind.«
2. Kapitel
Der Sheriff von Jerome hatte Vormann Stinner sofort entlassen, als der wieder halbwegs zu sich gekommen war. Mehr konnte er nicht für ihn tun, obgleich seine Sympathie ganz auf Seiten des Vormanns war.
Stinner hatte es arg erwischt. Sie waren zu einem Dutzend über ihn hergefallen, und das, was der Sergeant abgekriegt hatte, war nichts gegen das, was Stinner widerfahren war. Der Doc in Jerome hatte schon allerlei erlebt, nur nicht, dass jemand, der so zusammengeschlagen worden war, nach so kurzer Zeit schon wieder auf seinen Beinen stand. Er verpflasterte Stinner, betrachtete das unförmige Gesicht und meinte trocken: »Sie sehen aus, Vormann, als hätten Sie unserem Schmied den Amboss ersetzt, aber ich denke, das wird wieder.«
Stinner schwieg verbissen.
Der Doktor selbst war kein Schwächling, doch diesen Burschen hier bewunderte er. Zudem war Stinner gar nicht mehr so jung. Für einen Achtunddreißigjährigen hatte er ein ungeheures Stehvermögen gezeigt.
»Ich habe vier von den Soldaten noch in der Stadt. Sie sind nicht transportfähig. Und die anderen sehen auch ziemlich mitgenommen aus, Vormann. Vielleicht tröstet Sie das etwas?«
»Gibt es hier einen Telegrafen?«, fragte Stinner.
Der Doktor lächelte.
»Ja, aber das ist sehr teuer. Bekommen Sie nicht acht neue Cowboys?«
Stinner fuhr herum.
»Neue Cowboys? Diese Jungs werden wiedergeholt, das schwöre ich Ihnen. Und einer davon war den Sohn von C. Slaughter! Wissen Sie, wer Slaughter ist?«
Der Doktor nickte.
»Ja, der zweitgrößte Viehbaron in diesem schönen Amerika.«
»Der größte! Die Kings sind ein Konsortium. Aber Slaughter ist der Alleinbesitzer. Und seinen Sohn haben sie mitgeschleppt. Er hat zwar noch zwei Söhne, und Eroll wird die Ranch bestimmt nicht erben, aber trotzdem …«
»Das wird der Army aber bitter aufstoßen, wie?«, meinte der Doktor.
»Ich möchte nicht in der Haut des Burschen stecken, der das veranlasst hat«, erwiderte Stinner. »Wissen Sie, ich war einmal Sheriff in Sidney. Oben in Nebraska. Da haben sie auch Soldaten geworben. Aber so nicht. Das sind ja Banditenmethoden.«
»Ich weiß, aber sie haben einen neuen General. Die Kavallerie hat ungeheure Verluste erlitten gegen die Apachen. Jetzt sind auch noch die Hualapais verrückt geworden. Die Armee versucht mit aller Macht, ohne Zeitverlust frische Truppen gegen Geronimo in Marsch zu bringen. Westlich von hier sind mehrere Siedlerstellen gebrandschatzt worden, Transporte wurden überfallen, und seit Kurzem fallen sie auch über die Atchison, Topeka und Santa Fe Railroad her. Die Armee könnte sich zerreißen, weil es mal hier und mal dort knallt, und nie hat die Truppe genug Leute.«
»Dann sollen die kämpfen, die in dieses Land gehören, Doc. Wir sind mit achthundert Zuchtstieren hierhergekommen, die Mr. Slaughter nach Jerome verkauft hat. Es waren verflucht wilde Burschen, die wir nicht verladen konnten. Was geht uns aber die Army an? Ich werde Slaughter telegrafieren, und danach ist die Hölle los!«
»In dieser Stadt ist die Army nicht beliebt. Trotzdem, für euch Texaner rührt ebenso wenig einer die Hand. Sie sehen nur zu, hören zu, amüsieren sich. Das genau ist es, mehr nicht, Vormann.«
»Slaughter würde schon einen Affentanz loslassen, wenn sein dritter Sohn nicht dabei wäre. Aber nun macht das die Geschichte noch schöner für uns.«
»Wenn nur Ihre Jungs nicht inzwischen Dummheiten machen.«
Stinner nickte.
»Das befürchte ich nämlich auch. Mike ist zwar sehr vernünftig, aber gerade Slaughters Junge ist ein Hitzkopf. Und die anderen würden vielleicht auf ihn hören, wenn ich nicht da bin …«
3. Kapitel
An dem langen Tisch, der quer mitten im Raum stand, saßen drei Offiziere in blauen Uniformen, rechts und links von ihnen Männer in Chargenrängen, und am Tischende notierte ein Protokollschreiber, was gesagt wurde. Kriegsgericht in Fort Verde.
Der Vorsitzende war ein Major, ein Mann von etwa fünfundvierzig Jahren, dessen Gesicht Härte und gnadenlose Strenge verriet. Das Kriegsgericht tagte seit dem frühen Morgen. Elf Fälle waren schon abgeurteilt, ausnahmslos Widerstand gegen die Vorgesetzten, Versuch der Desertation und versuchter Aufruhr und Meuterei. Oder Beschwerden, das waren die meisten.
In Fort Verde befanden sich gegenwärtig an die hundert sogenannte Freiwillige, die unter ähnlichen Umständen rekrutiert worden waren wie die acht Cowboys in Jerome.
Der zwölfte Fall begann. Es lief wie schon mehrmals an diesem Tage, kaum ein Unterschied. Zwei bewaffnete Soldaten führten einen Zivilisten herein. Ein junger Mann, dessen Kleidung verriet, dass er noch vor Kurzem Rinder gehütet hatte. Ein Cowboy. Fast alle Rekrutierten waren Cowboys. Die Armee brauchte versierte Reiter, die mit einer Waffe umgehen konnten und nicht erst langwierig ausgebildet werden mussten. Kenner der Wildnis, Reiter und Kämpfer also, die man sofort in den Kampf schicken konnte. Dieser Mann schien aber keinen Geschmack am Kämpfen zu haben.
Der Major leierte die Personalien herunter, alles monoton und von einem Hauch Müdigkeit und Langweile überschattet.
»Sind Sie das?«, murmelte er.
Der junge Mann nickte. »Ja, das bin ich.«
»Was wollen Sie also? Sie behaupten, nicht freiwillig zu den Fahnen getreten zu sein?«
»Ich bin verschleppt worden!«, behauptete der Cowboy.
»Ich habe aber hier eine unterschriebene Erklärung von Ihnen. Sehen Sie nach, ob das Ihre Unterschrift ist!«
Es war seine Unterschrift. Und da stand, dass der Cowboy Bob Reglin freiwillig zu den Waffen geeilt war. Für sein Vaterland, für die Nation.
»Ich war betrunken, als ich das geschrieben habe. Ich kann mich nicht einmal erinnern.«
Der Major nickte müde.
»Das ist uns gleich. Dann trinken Sie nicht, wenn Sie nichts vertragen. Die Zeugen!«
Zwei Corporale der Kavallerie kamen, mussten ihre Namen nennen und begannen abwechselnd zu erzählen, dass der Cowboy Reglin völlig freiwillig und nur ganz unwesentlich unter Alkohol stehend die Erklärung aus freien Stücken unterschrieben hatte. Zwei Minuten später fällte der Major das Urteil.
»Der Rekrut Reglin hat freiwillig diese Erklärung unterschrieben, wie Zeugen beweisen. Der Rekrut hat von der Unterzeichnung der Erklärung an Dienst bei der Armee getan. In dieser Eigenschaft hat er eine nicht der Wahrheit entsprechende Behauptung vorgebracht, indem er erklärte, zu dem Dienst in der Armee gepresst worden zu sein. Da diese Verleumdung das Ansehen der Armee schwer schädigt, muss der Rekrut bestraft werden. Er wird unter Berücksichtigung seiner mangelnden Erfahrung mit militärischen Grundsätzen ausnahmsweise nicht mit schwerer Haft bestraft, sondern lediglich einem Kommando zugeteilt, bei dem ihm der Wert echten Soldatentums ersichtlich wird. Wegtreten!«
Dieses Urteil fällte der Major an diesem Tage insgesamt achtzehnmal. Die vier anderen Verurteilungen betrafen offene Meuterei, aber die Gemaßregelten mussten ebenfalls zu diesem Kommando, statt in Haft.
Keiner wusste, was es bedeutete. Auch keiner der acht Slaughter Cowboys, die allesamt dieses Urteil zu hören bekamen. Nur Eroll Slaughter erfuhr eine kleine Variante in seinem Urteilsspruch. Da nämlich erklärte der Major zusätzlich: »Auch die Tatsache, dass der Verurteilte der Sohn des Ranchers Slaughter aus Texas ist, wird hier in Arizona keine Rolle spielen. Die von ihm abgegebene freiwillige Rekrutierungserklärung ist rechtskräftig. Da der Verurteilte aber sehr uneinsichtig ist und selbst vor Gericht immer wieder behauptete, zum Dienst gepresst zu sein, wird er nach Ableistung des Dienstes im Sonderkommando zusätzlich vier Wochen schweren Arrest absolvieren. Wegtreten!«
4. Kapitel
Das Kommando bestand aus zwei Abteilungen. Die eine führte Captain Donelly, die andere ein Lieutenant Ross. Jede der Patrouillen gruppierte sich aus zweiundzwanzig Mann und je einem Papago-Scout. Die Hälfte der Soldaten waren langgediente Kavalleristen, darunter ein paar Sergeanten, Corporale und Gefreite. Die restlichen Reiter waren sogenannte Freiwillige, die jetzt dieselbe Uniform trugen wie alle anderen Soldaten, im Gegensatz zu ihnen aber überhaupt keine Ausbildung genossen hatten. Doch sie waren Cowboys ohne Ausnahme, und das ersah man an ihren Sätteln. Sie durften ihre oder von der Armee besorgte McClellan-Sättel benutzen. Ebenso erlaubte die Armee, dass diese Männer Waffengurte wie Cowboys trugen. Doch auch die übrige Truppe war unkonventionell bewaffnet. Von einigen Militär-Lee-Enfield-Gewehren bis zur Winchester 66 waren so gut wie alle möglichen Gewehrmodelle vertreten. Sogar Sharpsbüchsen gab es zwei, und entsprechend vielfältig war die Munition.
Jeder Soldat besaß nur insgesamt sechzig Schuss Gewehrmunition. Für die Revolver gab es noch weniger. Damit ließ sich pro Reiter ein Colt nur zweimal nachfüllen.
Slaughters Sohn und dessen sieben Kameraden wurden zu Donelly eingeteilt. Später kamen Donelly allerdings Bedenken, als er sah, dass die acht ehemaligen Cowboys aneinanderhingen wie die Kletten. Er zählte vier aus und tauschte sie mit Lieutenant Ross gegen vier aus dessen Patrouille. Damit war Slaughters kleine Mannschaft auseinandergerissen.
Trotzdem schwor Eroll Slaughter seinem Corporal: »Bei der ersten Gelegenheit wendet sich das Blatt!«
Der altgediente Corporal grinste nur und erwiderte ungerührt: »Es geht gegen Rothäute. Da werdet ihr euch nicht anders entscheiden können, als mit uns zu gehen. Die Hualapais fragen nicht, ob du für uns oder gegen uns bist. Für die bist du ein Weißer. Und der wird skalpiert, wenn er nicht aufpasst!«
5. Kapitel
Pedro Sugarez, der seit Kindesbeinen auf Slaughters Ranch Pepe genannt wurde, befand sich seit zwei Stunden nicht mehr in Fort Verde. Während er noch sah, dass beide Patrouillen ausrückten, hatte Lieutenant Ross und auch keiner von dessen Chargen das Fehlen des Cowboys bemerkt. Die drei anderen Texaner in Ross’ Gruppe schwiegen. Pepes Flucht war ihrer aller Hoffnung. Auf einem Armeepferd floh Pepe im Durcheinander des Abrittes der Patrouille zuerst in die neben dem Fort liegende Siedlung. Hier hatten sich friedliche Puebloindianer und ein paar weiße Händler niedergelassen.
Pepe trug schon die Uniform. Damit fiel er hier nicht auf. Während die beiden Patrouillen schon weit vom Fort ritten, verließ Pepe die Siedlung und wandte sich nach Süden. Kein Mensch hielt ihn auf. Und die Pueblos, die ihm erstaunt nachsahen, dachten sich offenbar wenig. Im Fort selbst schien man ebenfalls kaum etwas gemerkt zu haben. Die Fortbesatzung war ohnehin nur mehr ein kleines Häuflein Verletzter, Alter und Kranker, abgesehen von den Artilleristen, die offenbar den einzelnen Reiter auch nicht beobachteten.
Für den neunundzwanzigjährigen Mexikaner gab es nur eines: Er musste seinen Boss verständigen. Slaughter war der Chef seines Vaters gewesen, und er selbst arbeitete seit seiner Kindheit auf Slaughters Ranch. Im Gegensatz zu den Texanern nannte er sich Vaquero und nicht Cowboy. Doch auf seine Nationalität angesprochen, gab es für ihn nur eine Antwort: Ich bin Texaner! Dem Geburtsschein nach war er das sogar. Sonst aber verkörperte Pepe all das, was man dem echten Vaquero nachsagt. Er war drahtig, temperamentvoll und stolz. Sein Mut ging bis an den Rand der Selbstvernichtung, sein Kampfgeist entsprach seinem hitzigen Temperament. Und es gab keinen Trick, den er nicht anzuwenden bereit war. Slaughter hatte ihn seit zehn Jahren jedem Treiben mitgeschickt, weil Pepe wie eine Wunderwaffe gegen Viehdiebe wirkte. Seine Härte war beispiellos, und vor vier Jahren hatte er mit drei Mann eine zwölfköpfige Rustlerbande aufgerieben.
Auch jetzt war es Pepe, der aus der Falle geschlüpft war und alles tun wollte, um seine Kameraden von dieser ungewollten Beschäftigung zu befreien.
Pepe rechnete nicht mit Slaughters Hilfe. Er wollte ihn nur irgendwie in Kenntnis setzen, andererseits aber die Befreiung seiner Freunde selbst in die Hand nehmen. Allein, das wusste er, würde er es nicht schaffen. Da er sich darüber klar war, dass Vormann Stinner ebenfalls etwas unternehmen würde, falls er nicht noch eingesperrt wurde, musste er versuchen, mit Stinner Kontakt aufzunehmen, Stinner käme dann, wenn man ihn freigelassen haben sollte, bestimmt zu »Rocky« Jim Talbots kleinem Rancho.
Das Rancho lag in einem weiten Tal, umgeben von verfilztem Buschwerk. Pepe brauchte fast einen Tag, um dieses kleine Anwesen zu erreichen. Schon von Weitem sah er drei Pferde im Corral, eine kleine Rinderherde und einen halb verfallenen Chuckwaggon auf der Weide, die den Regencreek säumte.
»Rocky«, stand vor dem Haus, und ihm war der Spitzname »Felsen« nicht zu Unrecht gegeben worden. Jim Talbot glich einer grob geschnitzten Skulptur. Breitschultrig, geradezu massig stand er da. Sein buschiges, struwweliges Haar war aschgrau, dabei konnte Rocky nicht älter als dreißig sein. Er glich einem Bären, schwerfällig, ungeheuer stark und bei allem gutmütigen Aussehen nicht ungefährlich. Als er Pepe erkannte, lächelte er.
»Ich hatte schon eine Faust gemacht, als ich das viele Blau gesehen habe. Wer steckt dich in so einen Fetzen?«
Pepe lachte schrill, sprang aus dem Sattel und gab Rocky die Hand. »Ich erkläre es dir. Aber ein paar andere Klamotten würden mir schon Spaß machen.« Er schielte zum Corral hin.
»Ein Pferd ist verschwitzt, und es trägt einen fremden Brand. Hast du Besuch?«
Rocky nickte. »Schläft jetzt. Ein alter Bekannter, als ich noch oben in Lamar gewesen bin. Glenn Scott. Er ist vor ein paar Tagen mit Old Diamond geritten. Jetzt will er sich einen Job suchen.«
»Was für ein Typ?«
»Einer, der zu uns passt, sonst wäre er nicht hier«, erwiderte Rocky gleichgültig. »Ziemlich smarter Junge. Erzähle mir, während wir dein Pferd versorgen, wie du zu diesem blauen Lumpen kommst!«
Pepe erzählte es ihm, und als er das Pferd im Corral hatte und sich eine Zigarette von Rockys Tabak drehte, trat dieser Glenn Scott aus dem Haus. Wer wie Pepe immerzu mit harten Burschen geritten war, kannte sich aus. Pepe sah mit einem Blick, wie er den hageren, muskulösen Mann einstufen musste. Spätestens am blanken Kolben des Patterson-Revolvers, den dieser Glenn Scott trug, sah er auch, dass jener Mann seine Härte auch an den Mann brachte.
»Hallo!«, rief Pepe.
Glenn Scott nickte ihm zu. Dann fragte er: »Ich habe noch etwas von deiner Story gehört, Mister, war da nicht von einem Vormann Stinner die Rede?«
»Richtig. Stinner ist unser Vormann gewesen. Er ist es noch. Aber sie haben ihn in Jerome eingebuchtet, und unterschrieben hatte er es ja auch nicht.«
»Stinner? So viele gibt es davon auch nicht. Ist er aus Sidney in Nebraska?«
Pepe nickte. »Ja, da ist er Sheriff gewesen.«
»Hm, dann kenne ich ihn. Und er steckt in Jerome?«
»Vielleicht«, sagte Pepe, »aber wie ich ihn kenne, ist er nicht mehr eingesperrt. Ich hoffte, ihn hier zu treffen.«
»Ja«, stimmte Rocky zu, »zumindest ist er bald hier. Oder wir müssen ihn in Jerome abholen.« Er sagte das so, als gäbe es gar keinen Zweifel daran, dass Glenn nicht ebenfalls mit ihnen reiten würde, um Stinner zu befreien.
Sie setzten sich auf den dicken Balken, der als Bank diente und neben dem Tränketrog auf zwei Steinbrocken lag. Glenn Scott drehte sich eine Zigarette, und Rocky starrte nachdenklich vor sich in den Sand, malte mit einem Zweig undefinierbare Figuren hinein, während Pepe aus seiner Feldflasche trank und sie dann hinter sich im Tränketrog auffüllte.
»Du bist also desertiert, Pepe«, meinte Glenn, als er von Rocky erfahren hatte, wer Pepe war.
»Genau, und ich mache mir einen Dreck daraus.«
»Ich habe auf dem Weg hierher eine Menge gehört. Geronimo hat sich von Cochise getrennt. Sie sind stärker geworden und treiben sich von New Mexico bis Arizona überall herum. Die Hualapais wittern auch Morgenluft, und die Army hat sagenhafte Verluste. Außerdem kommen sie dann, wenn sie wirklich in der Übermacht sind, stets zu spät.«
Rocky wandte sich Glenn Scott zu.
»Alles schön und gut. Aber hat es die Army nötig, Soldaten so anzuwerben, wie sie das mit Pepe und den anderen Jungs gemacht haben?«
Glenn zuckte mit den Schultern.
»Ich müsste euch noch etwas erklären, was mir zwei Soldaten erzählt haben, die ebenfalls desertiert sind und jetzt vielleicht schon wieder in Colorado angekommen sein dürften. Die haben beide mitangesehen, wie bei den Hualapais, die vor Hunger kaum noch stehen konnten, ein Indianeragent mit zwei Wagen voll Brot und Mais aufgetaucht ist. Außerdem brachte er noch ein Dutzend Rinder mit. Kurz darauf erschien die Armee, und ein Offizier hat behauptet, irgendwo in der Nähe hätten die Hualapais drei Pferde gestohlen und unweit davon geschlachtet. Die Hualapais gaben das auch zu. Sie hätten großen Hunger gehabt und kein Wild auftreiben können. Daraufhin hat der Offizier von seinen Soldaten das Brot mit Petroleum übergießen lassen, die Rinder wurden wieder weggebracht, und den Mais ließ er in den Colorado River schütten. Als die Hualapais verzweifelt um Gnade bettelten, wollte er sie durch Schreckschüsse vertreiben lassen. Die Hualapais sollen das falsch verstanden haben, und kurz danach lagen dreißig der Rothäute in ihrem Blut. Die Armee zog ab, und ich wette, der Offizier ist sich dabei noch großartig vorgekommen. Einen Tag darauf haben die Hualapais die gesamte Ranchbesatzung niedergemacht, wo sie vorher die drei Pferde gestohlen hatten und wohin die Armee die Rinder brachte. Wenn die Armee den Krieg mit Geronimo nicht in den Griff bekommt, braucht mich keiner zu fragen, woran das liegt. Jetzt sind ja nicht nur die Apachen verrückt, nun haben wir es auch noch mit den Hualapais zu tun, die vorher keiner Seele etwas zuleide getan haben.«
»Na und?«, fragte Rocky. »Sollen wir etwa die Kastanien aus dem Feuer holen?«
»Nein«, meinte Pepe, »Glenn will uns nur erklären, wieso die Armee so viele Verluste hatte.«
»Hatte?« Rocky lachte böse auf. »Sie wird noch viel mehr haben. Glaubst du denn, dass sich ein Krieg mit gepressten Cowboys gewinnen lässt?«
Glenn nickte. »Wenn die Jungs erst vor den Rothäuten stehen, bleibt ihnen kaum etwas anderes übrig, als zu kämpfen.«
»Also gut, essen wir erst etwas, danach denkt es sich angenehmer. Vielleicht taucht Jack auch noch auf«, erwiderte Rocky und ging ins Haus.
6. Kapitel
Jack Stinner kam in der Nacht. Er war im Gesicht aufgequollen wie ein Hefekloß. Die Haut schimmerte in allen Farben. Aber auf dem Ritt hatte sich sein Zorn auf die Armee mindestens verzehnfacht.
Rocky kochte Kaffee, Glenn versorgte Stinners Pferd, und Pepe meinte: »Jetzt sind wir zu viert. Wenn wir die anderen nicht herausbekommen, sind wir vier Flaschen.«
Jack Stinner sah Glenn an und lächelte, aber sein aufgedunsenes Gesicht wirkte dabei nur verzerrt.
»Dich hätte ich hier nie erwartet, Scott.