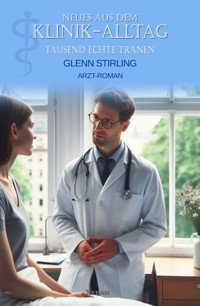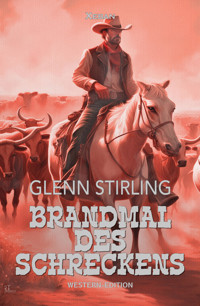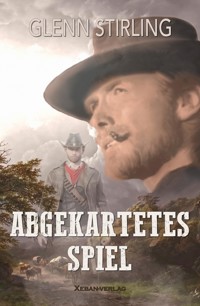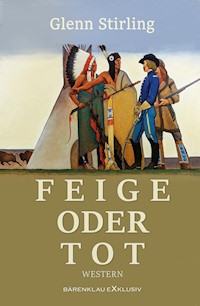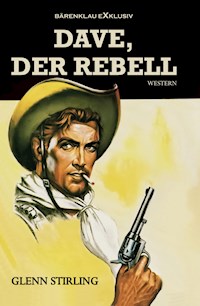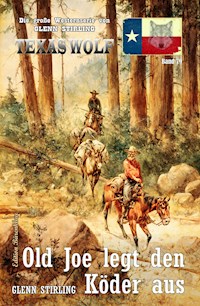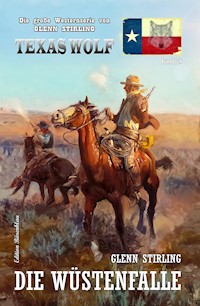3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: XEBAN-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
p>»Ein Mann, der so alt wie ich ist, weiß, wann er nicht mehr zurückkehrt. Dies ist meine letzte Fahrt«, sprach der faltengesichtige Schiffszimmermann der ›Princess of Scotland‹ eines Tages.
Ich wollte ihm nicht glaube und sagte es ihm auch. Daraufhin schüttelte er den Kopf. »Ich weiß, was ich weiß. Ich bin alt und damit jenseits von Gut und Böse. Ich brauche niemand zu fürchten, auch den Seetiger nicht. Ich weiß, Mr. Feiler, Sie verehren ihn noch. Sie glauben, er wäre ein großer Mann. Aber auf seine Art ist auch der Teufel ein großer Mann. Dann müsste der Seetiger ein sehr, sehr großer Mann sein …«
Ich dachte, der Alte würde Seemannsgarn spinnen. Damals wusste ich noch nicht, welche tödlichen Gefahren auf mich und die übrige Mannschaft warteten. Aber als wir erst in der Beringsee kreuzten und schließlich den Lockruf des Goldes in Alaska vernahmen, hatte der Tod bereits die Hand nach uns ausgestreckt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Glenn Stirling
Die Männer der sieben Meere
Sie nannten ihn Seetiger
Seefahrer-Roman
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Authors
© Copyright dieser Lizenzausgabe by XEBAN-Verlag.
Verlag: XEBAN-Verlag: Kerstin Peschel, Am Wald 67, 14656 Brieselang; [email protected]
Lizenzgeber: Edition Bärenklau / Jörg Martin Munsonius
www.editionbaerenklau.de
Cover: © Copyright by Steve Mayer nach Motiven, 2024
Korrektorat: Sandra Vierbein
Alle Rechte vorbehalten!
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt beim XEBAN-Verlag. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Die Männer der sieben Meere
Sie nannten ihn Seetiger
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Über den Autor Glenn Stirling
Eine kleine Auswahl der Romane von Glenn Stirling
Das Buch
„Ein Mann, der so alt wie ich ist, weiß, wann er nicht mehr zurückkehrt. Dies ist meine letzte Fahrt“, sprach der faltengesichtige Schiffszimmermann der ‚Princess of Scotland‘ eines Tages.
Ich wollte ihm nicht glaube und sagte es ihm auch.
Er schüttelte den Kopf. „Ich weiß, was ich weiß. Ich bin alt und damit jenseits von Gut und Böse. Ich brauche niemand zu fürchten, auch den Seetiger nicht. Ich weiß, Mr. Feiler, Sie verehren ihn noch. Sie glauben, er wäre ein großer Mann. Aber auf seine Art ist auch der Teufel ein großer Mann. Dann müsste der Seetiger ein sehr, sehr großer Mann sein …“
Ich dachte, der Alte würde Seemannsgarn spinnen. Damals wusste ich noch nicht, welche tödlichen Gefahren auf mich und die übrige Mannschaft warteten. Aber als wir erst in der Beringsee kreuzten und schließlich den Lockruf des Goldes in Alaska vernahmen, hatte der Tod bereits die Hand nach uns ausgestreckt …
***
Die Männer der sieben Meere
Sie nannten ihn Seetiger
Seefahrer-Roman von Glenn Stirling
1. Kapitel
Die Überraschung kam, als wir in San Francisco festgemacht hatten. Unsere bis zur obersten Lademarke mit Fracht aus Singapur und Hongkong beladene ›Princess of Scotland‹ hatte den Stillen Ozean in einer Rekordzeit durchquert. Zugegeben, der Wind war unserer Viermast-Bark zu Hilfe gekommen, ein fantastischer Passat, der es uns ermöglichte, die meiste Zeit vor dem Wind zu laufen und alles Zeug zu setzen, was wir setzen konnten.
Ich stand gerade achtern und beobachtete, wie die Männer oben in der Takelage das letzte Tuch bargen und belegten, was noch gesetzt war. Da bemerkte ich plötzlich den Hafenmeister in seiner blauen Kapitänsuniform und neben ihm zwei würdige Herren in schwarzen Anzügen und Zylinder. Beide hatten graue Bärte, und irgendwie erinnerten sie mich an Totengräber. Ich wusste gar nicht, wie sehr ich mit dieser Ahnung den Tatsachen nahe kam. Aber in diesem Augenblick sagte ich mir, dass die drei sicher gekommen waren, um uns oder vielmehr dem Kapitän zu gratulieren für seine schnelle Fahrt, denn das war ja sicher, dass man in San Francisco nachgerechnet hatte und wusste, was es hieß, in vierunddreißig Tagen von Singapur nach hier zu fahren.
Die drei kamen tatsächlich auf die Gangway zu, die gerade von drei unserer Männer ausgelegt worden war. Oben an Bord, am Ende der Gangway, stand unser Midshipman, der rotblonde Lindon McCulloch.
Der Hafenmeister tippte mit zwei Fingern an den Schirm seiner Mütze, und ich hörte, wie er zu McCulloch sagte: »Ich möchte an Bord kommen! Diese beiden Gentleman auch, und wir wollen den Kapitän sprechen!«
McCulloch blickte unentschlossen nach achtern, entdeckte mich dann und wollte mir gerade wiederholen, was ihm gesagt worden war, da winkte ich und rief ihm zu: »Sie sollen raufkommen.«
Ich Narr glaubte noch immer daran, dass der Hafenmeister sich auf einer Gratulationstour befand, um dem Kapitän seine Glückwünsche auszusprechen für diese schnelle Fahrt. Deswegen erfüllte mich ein gewisser Stolz, als ich unseren Moses, einen sechzehnjährigen Jungen, nach unten zur Kapitänskajüte schickte, dass er ihm Bescheid sagen sollte.
Aber dann fiel mir doch auf, wie diese beiden schwarzgekleideten Zylinderträger prüfende Blicke nach allen Seiten warfen und das Schiff regelrecht zu begutachten schienen. Sie tuschelten miteinander, während der Hafenmeister langsam nach achtern ging. Erst nach einer Weile folgten die beiden, und nun kam mir zum ersten Mal diese Ahnung, dass es sich doch nicht um einen Glückwunsch handeln könnte. Schon das Gesicht des Hafenmeisters, der selbst lange Jahre als Kapitän gefahren war und nun schon im sechzigsten Lebensjahr stand, wirkte verschlossen, ernst, eigentlich unheilverkündend.
Zu jenem Zeitpunkt fuhr ich als Zweiter Offizier auf der ›Princess of Scotland‹. Sie war das neueste Schiff der Princess-Klasse, das modernste und schnellste zugleich. Kapitän Winters konnte stolz auf dieses Schiff sein, aber auch auf seine Mannschaft. Im Gegensatz zu vielen anderen Schiffen dieser Art wirkte es blitzsauber, ja, auch die Männer machten einen ordentlichen Eindruck und waren gut gekleidet. Soweit die Männer in der Takelage fertig waren, kamen sie an Deck, wo die anderen schon warteten.
Land, das bedeutete Urlaub, Entspannung, Vergnügen, Frauen. Darauf hatten diese Männer die ganze Reise über gewartet, und jetzt dürsteten sie danach, von Bord zu kommen.
Kapitän Winters kam jetzt an Deck, unter dem Arm die allen Männern an Bord bekannte schwarze Tasche, in der sich die Heuer befand, die er jetzt auszahlen würde.
Kapitän Winters trug seine Kapitänsuniform, und die stand ihm gut. Er war ein Mann von etwa vierzig Jahren, schlank, dunkelhaarig, ein Typ, auf den die Frauen fliegen.
Der Hafenmeister und Kapitän Winters kannten sich. Sie gingen aufeinander zu, begrüßten sich, und noch strahlte Winters stolz. Dazu hatte er auch Grund.
Der Hafenmeister stellte die beiden Schwarzgekleideten vor, deren Namen ich nicht verstand, dafür aber die Tatsache, dass der eine ein Notar und der andere ein Rechtsanwalt sein sollte. Und nun war ich fast sicher, dass es sich hier nicht um ein Begrüßungskomitee handelte, zumal jener Kleinere mit dem eisgrauen Bart zu Kapitän Winters sagte: »Am besten wäre es, wir könnten mit Ihnen allein sprechen, wo uns keiner zuhört.«
In diesem Moment schien Winters zu ahnen, dass Schlimmes bevorstand. Er sah sich suchend um, entdeckte mich und rief: »Mr. Feiler, kommen Sie bitte mit! So ganz alleine möchte ich mir die Geschichte auch nicht anhören, die da auf mich zukommt.«
Der Notar und der Anwalt warfen mir einen missbilligenden Blick zu, schienen aber dann die Tatsache zu schlucken, dass sich Winters ihre Geschichte nicht allein anhören wollte.
»Für mich ist die Sache, glaube ich, erledigt«, sagte der Hafenmeister. »Wir sehen uns sicher später.«
Er schüttelte Winters die Hand, tippte mit dem Zeigefinger an seinen Mützenschirm, nickte mir mit einem gequälten Lächeln zu, ging dann nach mittschiffs, um das Schiff zu verlassen. Ich schickte ihm, wie es sich gehörte, McCulloch nach, dass er ihn von Bord begleiten sollte.
Kurz darauf waren Winters, der Notar und der Anwalt und ich unten im sogenannten Kapitänssalon.
Auf der ›Princess of Scotland‹ hatte man, was die Technik des Schiffes anging, an nichts gespart. Aber der Kapitänssalon wirkte fast spartanisch einfach. Doch das hatte nun keine Bedeutung. Wir saßen uns an dem schlichten Tisch gegenüber, der in der Mitte des Raumes befestigt war. Der Notar, jener Kleinere mit dem eisgrauen Bart, legte die Tasche, die er bisher unter dem Arm getragen hatte, auf den Tisch. Er klappte sie auf, entnahm ihr ein paar Schriftstücke, holte dann umständlich einen sogenannten Zwicker, eine Klemmerbrille also, aus seiner Tasche, setzte ihn auf und sagte dann mit Unheil verkündender Stimme:
»Mr. Winters, ich bin hier, um dieses Schiff zu beschlagnahmen. Das Vermögen der Reederei O’Keefe ist gepfändet, soweit ein Vermögen noch da ist. Es handelt sich ausschließlich um Sachwerte, Barvermögen ist nicht mehr vorhanden.«
Winters und ich starrten den Notar fassungslos an. Mir war, als hätte ich geträumt. Aber Winters ging es nicht besser. Der konnte das auch nicht begreifen. Schließlich würgte er ein paar Worte heraus. »Wieso denn das?«, wollte er wissen.
Der Notar lächelte kümmerlich und meinte dann: »Ich habe persönlich Bedenken, ob Mr. O’Keefe, Ihr Reeder, überhaupt noch im Vollbesitz seiner geistigen Kraft ist …«
Winters und ich wollten schon vom Stuhl aufspringen.
Der Notar machte eine beschwichtigende Handbewegung und fuhr fort: »Bitte lassen Sie es mich sagen. Ich kann es begründen. In aller Offenheit und doch ganz sachlich möchte ich Ihnen erklären, dass ich Beweise dafür habe, dass zumindest Zweifel daran bestehen, ob Mr. O’Keefe noch weiß, was er tut, und lassen Sie mich das auch ausführen bitte! Zunächst einmal«, erklärte der Notar dann, »hat sich Mr. O’Keefe schon vor drei Jahren an einer Expedition beteiligt, die nach dem geheimnisvollen roten Mörderwal sucht, der, wie es in der Legende heißt, den Tod so vieler Menschen verursacht haben soll, der Schiffe zum Sinken brachte und mehr noch, was man sich dort in Seemannskreisen zusammendichtet. Um es in Ihrer Sprache zu sagen, halte ich es für einen starken Tobak, beziehungsweise um ein dickes Garn, was da gesponnen wurde. Immerhin, Mr. O’Keefe hat Tausende von Golddollar in diese Expedition gestopft. Von der letzten Expedition hat man bis heute nichts mehr gehört und gesehen. Auch die Bark ›Vancouver‹ ist noch nicht wiederaufgetaucht.«
Winters und ich wussten, wovon der Notar sprach. Es handelte sich um die Bark ›Vancouver‹, eine Walfängerbark, die Mr. O’Keefe gekauft hatte. Wir alle waren der Meinung gewesen, er wollte ins Walfanggeschäft einsteigen. Uns hatte das allerdings verwundert, weil gerade im Walfanggeschäft sich neuerdings Dampfer breitmachten. Die großen Walfangflotten bestanden in steigendem Maße aus Fangschiffen, die zumindest außer ihrer Besegelung noch mit Dampfmaschinen ausgerüstet waren. Insofern erschien es Winters und mir als unverständlich, dass jemand zu einem solchen Zeitpunkt noch eine der ältesten Walfängerbarken kaufte, denn damit war er ja nicht mehr konkurrenzfähig. Die ›Vancouver‹ gehörte ohnehin zu den unmodernsten, wenn auch äußerst seetüchtigen Walfangschiffen, die ich kannte.
»Nachdem zum vorgesehenen Zeitpunkt«, fuhr der Notar fort, »die ›Vancouver‹ nicht zurückgekommen war, rüstete Mr. O’Keefe wieder ein Schiff aus, diesmal die für solche Zwecke gänzlich ungeeignete ›Princess of Denmark‹.«
»Die ›Princess of Denmark‹? Das ist doch ein Frachter«, sagte ich, »der größte, den wir haben.«
Der Notar nickte und lächelte vielsagend. »Das ist es. Und dieses Schiff wurde in aller Hast umgerüstet. Danach übernahm Mr. O’Keefe das Kommando an Bord selbst. Nachdem sich Mr. O’Keefe bereits mit Eisenbahnaktien verspekuliert hatte, verschlang die Umrüstung, die zudem wegen der Eile überteuert durchgeführt werden musste, praktisch das gesamte Barvermögen seiner Firma. Kapitän Hudspeth hatte noch Heuerforderungen und Beteiligungen früherer Frachten von Mr. O’Keefe zu bekommen. Er klagte diese ein, weil Mr. O’Keefe sie ihm schuldig bleiben wollte. Zu einem Besitztitel gelangte Mr. Hudspeth aber erst, als die ›Princess of Denmark‹ bereits ausgelaufen war. Er konnte Pfändung erwirken. Die Forderungen Mr. Hudspeths wurden anerkannt und sind so hoch, dass das Gericht die »Princess of Kent« an die Kette gelegt hat, und in den nächsten Tagen wird die Versteigerung stattfinden. Eine weitere Forderung haben verschiedene Werften, aber auch die Hafenbehörde, da ja für einige Schiffe die Liegezeit nicht mehr bezahlt wurde.«
»Aber die Forderungen können nicht so hoch sein, dass Sie so ein prächtiges Schiff wie die ›Princess of Scotland‹ einfach beschlagnahmen dürfen.«
»Zunächst einmal muss ich alle Werte sichern«, sagte der Notar, »um die Forderungen erfüllen zu können. Das heißt, wenn natürlich ein Überschuss da ist, wird dieser Überschuss dem Vermögen Mr. O’Keefes gutgeschrieben.«
»Soviel ich weiß«, sagte Kapitän Winters, »besitzen die O’Keefes mehr als diese Schiffe. Sie haben Grundstücke und sie haben Landbesitz an der Ostküste. Ich werde mit Miss O’Keefe sprechen, und ich glaube …«
Jetzt meldete sich der Anwalt zum ersten Mal zu Wort und sagte: »Mr. Winters, mir ist bekannt, dass Sie mit Miss Isabell verlobt sind. Es wird Sie hart treffen, aber ich muss es Ihnen sagen. Miss Isabell begleitet ihren Vater auf dieser abenteuerlichen Reise. Soviel wir wissen, wollte Mr. O’Keefe seinen Walfänger finden, zumindest Gewissheit über das vermisste Schiff haben. Um nun ganz mit der Wahrheit herauszurücken, muss ich Ihnen sagen, dass wir eine Nachricht bekommen haben vom Schicksal der ›Princess of Denmark‹. Demzufolge ist dieses Schiff spurlos verschwunden. Sie wollte Juneau anlaufen, aber das ist nicht geschehen. Stattdessen erhielten wir über die Telegrafie von Juneau aus die Kunde, dass ein russisches Schiff im Nordmeer südlich der Sankt Lorenz-Insel, nahe der Yukonmündung, in Sichtweite der ›Princess of Denmark‹ begegnet sei. In dieser Gegend treibt bald Eis. Und wenn es sich nicht um einen Trugschluss handelt und die Russen tatsächlich der ›Princess of Denmark‹ begegnet sind, dann ist als sicher anzusehen, dass O’Keefe nicht mehr rechtzeitig zurückkommt, es sei denn, er hätte unmittelbar nach der Begegnung mit dem Russen beigedreht und wäre zurückgefahren. Dann aber hätten wir längst aus Juneau eine telegrafische Meldung bekommen.«
»Und Sie sagen«, fragte ich, »dass Mr. O’Keefe und seine Tochter an Bord der ›Princess of Denmark‹ sind?«
Der Anwalt blickte mich verwundert an. »Das habe ich doch gerade erzählt.«
»Mir will nur nicht einleuchten«, erwiderte ich, »dass Miss Isabell mitgefahren sein soll. Sie wusste doch von der Rückkehr unseres Schiffes und damit auch von der Heimkehr von Kapitän Winters.«
Der Notar und der Anwalt zuckten die Schultern. Schließlich sagte der Anwalt:
»Die Schiffe, die Habe, alles das, was die O’Keefes besitzen, wird jetzt verschleudert werden. Die Frachtpreise sind so schlecht, dass niemand ein Schiff kauft, es sei denn, er bekäme es halb geschenkt Die noch einlaufenden Schiffe werden ebenfalls für ein Butterbrot verschleudert werden.«
»Einen Augenblick!«, rief Kapitän Winters und hob mahnend die Hand. »Sie sprechen von Versteigern, von Verschleudern, von Verkaufen. Sie sprechen von Gläubigern, und Sie reden von Mr. O’Keefe, als wäre es nicht eine Tatsache, dass Mr. O’Keefe ja nicht allein der Besitzer der Reederei war.«
»Seine Tochter war Mitinhaberin«, behauptete der Notar.
Winters schüttelte den Kopf. »O nein, das weiß ich dann aber besser. Die Reederei gehört zwei Männern. Beide sind Kapitäne. Beide haben dieses Vermögen schwer erarbeiten müssen. Der eine hat die Geschäfte geführt. Der andere aber …«
»Wenn Sie von Patrick O’Keefe sprechen«, unterbrach ihn der Notar mit schneidender Stimme, »dann können Sie mir zugleich sagen, wo ich ihn finde. Ich habe nämlich monatelang, um meine Forderungen präsentieren zu können, durch die Pinkerton-Agentur nach ihm suchen lassen, ohne Erfolg. Kapitän Patrick O’Keefe ist verschwunden. Er wurde auch von niemandem wieder gesehen.«
Winters sah mich an, und ich nickte kaum merklich. Ich konnte mir denken, was er meinte. »Nun gut«, erklärte Kapitän Winters, »und was beschließen Sie zu tun?«
»Wir legen die ›Princess of Scotland‹ heute noch an die Kette. Das bedeutet, sie ist beschlagnahmt. Die Ladung darf auch nicht gelöscht werden.«
»Die Ladung ist nicht das Eigentum des Reeders«, entgegnete Kapitän Winters scharf. »Die Ladung wird gelöscht und danach können Sie tun, was Sie wollen.«
Der Anwalt ruckte mit dem Kopf vor, sah aus seinen stechenden Augen wie eine Schlange auf Winters.
»Sie haben doch diese Ladung auf eigene Rechnung hergebracht.«
Winters schüttelte den Kopf. »Es ist ein Auftrag der Amerikanisch-Chinesischen Handelsgesellschaft. Die Ware gehört nicht mir, und ich werde mich hüten, nur ein einziges Teil davon an Sie zu übereignen. Die Ladung wird gelöscht, und dabei bleibt es.«
»Also gut«, sagte der Notar. »Es lässt sich ja in Ihren Büchern feststellen, wie die Dinge liegen.«
»So ist es. Und jetzt, meine Herren, verlassen Sie bitte das Schiff. Sie wissen ja, die Ladung muss gelöscht werden. Und kommen Sie mir nicht mit der Kette, bevor die Ladung herunter ist.«
Wir waren alle aufgestanden und der Notar, der einen Kopf kleiner als Kapitän Winters war, trat an den Kapitän heran, sah zu ihm auf und sagte drohend: »Ich bin einverstanden, dass die Ladung gelöscht wird. Aber danach, Kapitän, werden wir die ›Princess of Scotland‹ an die Kette legen. Es wäre sehr töricht von Ihnen, wenn Sie uns daran hindern, unsere Pflicht zu tun. Wir haben die Zusage des Hafenkapitäns, dass er notfalls eine Gruppe Soldaten anfordert, die unserer Aufgabe Nachdruck verleihen.«
Kapitän Winters lächelte geringschätzig. »Übernehmen Sie sich nur nicht«, knurrte er. Dann wandte er sich mir zu und sagte: »Mr. Feiler, bringen Sie die beiden von Bord!«
2. Kapitel
Als wir hinaufkamen, hatte sich der Himmel bewölkt. Feiner Nieselregen sprühte über Deck. San Francisco-Wetter! Im Westen klarte es schon wieder auf. Irgendwie schien mir dieses Wetter zum Abgang der beiden zu passen.
Kapitän Winters war wieder an Deck und begann den ungeduldig wartenden Seemännern die Heuer auszuzahlen. Unmittelbar danach strömten die Männer von Bord. Zuletzt waren wir nur noch zu viert da:
Kapitän Winters, unser Erster Offizier Turek, Bootsmann Leif Johannson und ich.
Ich hatte noch einem Angestellten der Reederei die Bücher übergeben und abzeichnen lassen. Von nun an wurde das Löschen der Ladung durch Reedereiangestellte überwacht. Die Schauerleute befanden sich bereits in den Lasten, während die Ladebäume herumschwenkten und die Winden kreischten und knarrten. Auf der Pier puffte und zischte ein dampfgetriebener Ladekran, der schon die ersten Ballen chinesischer Seide landwärts schwenkte.
Der Käpt'n, der Erste Steuermann, der Bootsmann und ich, waren indessen unter Deck gegangen und saßen uns in der Kapitänskajüte gegenüber.
Winters hatte aus seinem kleinen Wandschränkchen eine Flasche Aquavit geholt. Der bullige Bootsmann Johannson schenkte ein, dann nahmen wir unsere Gläser, nickten uns zu und kippten den Inhalt mit einem Ruck hinunter. Ich warf unserem Ersten Steuermann Turek einen kurzen Blick zu.
Er hatte kurzes dunkles Haar, einen kantigen Schädel, knochige Fäuste und Arme mit stahlharten Muskeln. Sie waren tätowiert, diese Arme, tätowiert mit chinesischen Schriftzeichen, deren Bedeutung nicht jeder kannte. Ich wusste auch, dass Turek selbst einmal Kapitän gewesen war, in einem Sturm um Kap Horn aber sein Schiff verloren hatte. Damals hatte es geheißen, er wäre total betrunken gewesen, und nur deshalb habe er das Schiff in die Klippen gesetzt. Niemand wollte Turek mehr einstellen und ihm erst recht kein Kommando mehr geben. Aber O’Keefe hatte ihn sich geholt, wenn auch nur als Ersten Steuermann und nicht mehr als Kapitän. Doch jeder an Bord wusste, dass er Winters nur widerwillig respektierte.
Rechts von mir saß der Bootsmann, ein Kleiderschrank von einem Kerl, mit Fäusten wie Vorschlaghämmer. Seine Stirnglatze war von mehreren zackigen Narben »verziert«. Ich hatte das letzte Mal in Singapur erlebt, wozu Leif Johannson fähig war, hatte mit angesehen, wie er zwei Männer mit einem Mal gepackt und durch ein Fenster geschleudert hatte. Ich wusste, dass er in der Lage war, eine schwere Theke wie einen Stuhl umzufegen. Er fuhr auf diesem Schiff, seit es in Dienst gestellt worden war, also seit acht Jahren.
Wir sahen gespannt auf Kapitän Winters und warteten auf seine Anweisungen. Keiner von uns dreien ahnte, dass er gar keine Möglichkeit mehr haben sollte, nur eines von dem, was er plante, in die Tat umzusetzen. Er selbst ahnte natürlich am wenigsten, was ihm bevorstand, und so sagte er:
»Wir müssen drei Dinge tun. Erstens müssen wir, noch während die Ladung gelöscht wird, Vorräte bunkern. Zum zweiten müssen wir den Teil der Mannschaft, der abgeheuert ist, durch neue Leute ersetzen, und zum dritten müssen wir Verbindung zu Kapitän O’Keefe aufnehmen, wobei ich noch nicht einmal sicher bin, dass er sich tatsächlich noch dort aufhält, wo ich glaube. Was mich wundert, dass ihn die Pinkerton-Leute nicht gefunden haben sollen.«
»Was soll ich also tun?«, fragte Turek.
»Sie werden sich darum kümmern, dass wir Vorräte bunkern, ohne dass es jemand merkt.«
Er wandte sich mir zu und fuhr fort:
»Und Sie werden nach O’Keefe suchen. Wenn Sie ihn haben, und wenn Sie das Glück haben, ihn nüchtern zu finden, dann machen Sie ihm klar, um was es hier geht. Er könnte verhindern, dass die Reederei verschleudert wird, wie dieser Winkeladvokat erzählt hat. Und als dritte Sache geht es darum, die Fracht einzutreiben, möglichst in bar zu kassieren, die wir uns mit dieser Fahrt verdient haben. Das machen wir zwei.« Er sah den Bootsmann an, lachte hart und erklärte noch: »Wir werden den Gentlemen von der Amerikanisch-Chinesischen Gesellschaft die Tatsachen schon klarmachen!«
Johannson grinste schief und fuhr sich mit der flachen linken Hand über die geballte Rechte. Ihm schienen die Knöchel zu jucken in wilder Vorfreude auf eine neue Schlägerei.
3. Kapitel
Minuten später wurde uns klar, dass Winters’ Plan zumindest in einem Teil zusammengebrochen war. Als wir an Deck kamen, um nun ebenfalls an Land zu gehen, entdeckten wir eine Gruppe von Marinesoldaten auf der Pier. Sie wurden von einem jungen Offizier befehligt, der neben einem älteren Zollinspektor stand. Der Zollinspektor trug, wie das seinerzeit in San Francisco üblich war, einen Zweispitz.
Wir kamen nicht im Entferntesten darauf, dass diese Soldaten, die ja ziemlich weit vom Schiff entfernt standen, und jener Zollinspektor etwas mit uns zu tun haben könnten. Wir brachten die Gangway, die wir vorhin eingezogen hatten, dort auch wieder über Bord. Zuerst verließ Kapitän Winters, gefolgt vom Bootsmann, das Schiff.
Ich war nach mittschiffs gegangen und unterhielt mich noch mit dem Angestellten der Reederei, der das Löschen der Ladung beaufsichtigte. Da bemerkte ich, wie der Zollinspektor auf den Kapitän zuging, wie er grüßte und dann ein Schriftstück entrollte, das er die ganze Zeit über in der linken Hand getragen hatte. Und nun rückten auch die Soldaten an. Es war eine ganz unmissverständliche Geste, die der Kapitän ebenso begriff wie der Bootsmann. Allerdings konnte ich nicht verstehen, was gesprochen wurde, weil die Winschen einen derartigen Lärm verursachten, dass man kaum sein eigenes Wort verstehen konnte. Aber die drohende Haltung der Soldaten war überzeugend genug. Außerdem sah ich dem Bootsmann und dem mittlerweile auch von Bord gegangenen Ersten Steuermann Turek an, dass sich dort unten etwas tat, was durchaus nicht erfreulich sein konnte.
Ich ließ den Angestellten der Reederei stehen und lief über den Steg, der mittschiffs ausgelegt war, von Bord. Dann hastete ich hinüber zu Turek, der ein paar Schritte seitlich von Winters und dem Bootsmann stand und die Arme in die Seite stützte.
Bevor ich dazu kam, ihn zu fragen, hörte ich, wie jener Zollinspektor dem jungen Offizier etwas zurief und der mit einer schnarrenden, alles durchdringenden Stimme sagte: »Im Namen des Gesetzes! Ich verhafte Sie!« Und er sagte das zu Kapitän Winters.
Winters machte ein so verblüfftes Gesicht, dass er wie ein kleiner Junge aussah, den man zu Unrecht beschuldigt hatte, einen Apfel gestohlen zu haben.
»Aber das ist doch absoluter Schwachsinn!«, hörte ich Winters sagen. »Wie kommen Sie bloß auf diese verrückte Idee, dass ich geschmuggelt haben könnte? Ich bin mit diesem Schiff seit einem Dreivierteljahr nicht mehr in den Vereinigten Staaten gewesen.