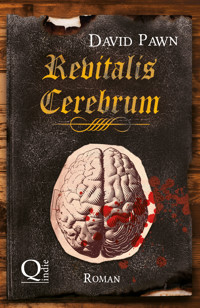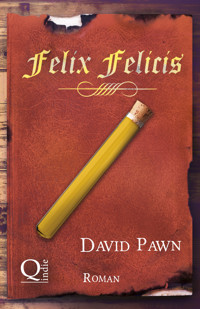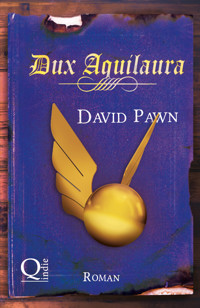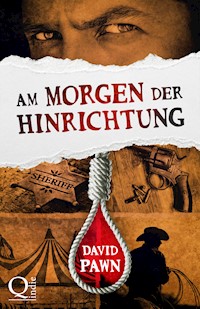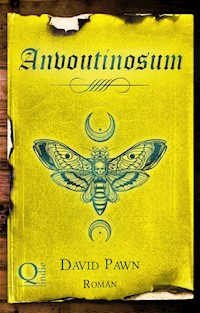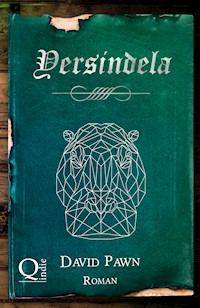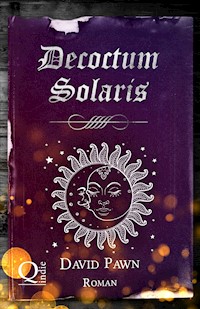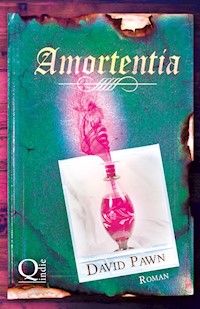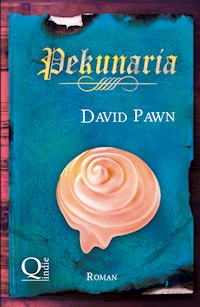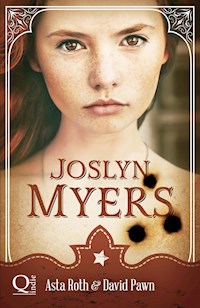3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
„Nun, mein Liebchen“, flötete der Vampir. „Hast du einen letzten Wunsch?“ „Verrecke!“ Geraldine Silvestri ist Vampirjägerin. Nicht genug damit, dass sie sich mit dem mächtigen Chef eines Vampirclans anlegt, der vor nichts zurückschreckt, indem sie einen von dessen Untergebenen tötet. Nein, es muss sich auch noch ein Stalker an ihre Fersen heften. Vor der barocken Kulisse Dresdens entspinnt sich eine Geschichte über Rache und Blutdurst, eine gekonnte Mischung aus Thriller und Vampirroman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Die Wahrheit hat Zähne
David Pawn
Qindie steht für qualitativ hochwertige Indie-Publikationen. Achten Sie also künftig auf das Qindie-Siegel! Für weitere Informationen, News und Veranstaltungen besuchen Sie unsere Website: http://www.qindie.de/
Copyright © 2017 David Pawn
Michael Siedentopf
Schweizer Str. 40
01069 Dresden
Umschlaggestaltung: Casandra KrammerUmschlagmotive: © Shutterstock All rights reserved.
ISBN-13: 978-3752147490
1
Geraldine Silvestri schwang die Axt in einem weiten Bogen herum. Eine Bewegung, die trotz der Waffe in ihren Händen grazil wirkte, als gehörte sie auf die Bühne einer Ballettaufführung. In einem Halbkreis kam der schwere, scharf geschliffene Kopf aus Höhe ihrer Hüften nach oben, schlug gegen den Hals ihres Widersachers, durchschnitt Haut, Sehnen, Arterien und schließlich Knochen und trennte so den Kopf vom Rumpf. Beide Teile stürzten auf die Marmorplatten, die den Boden des Kirchenvorraums bildeten. Der Kopf rollte ein wenig zur Seite. Was da anstelle von Blut aus den klaffenden Wunden floss, sah dunkel, beinahe schwarz aus. Zäh wie Asphalt quälte es sich aus dem Leib. Und es stank, als verwese es bereits seit hundert Jahren im Inneren, was vermutlich sogar zutraf.
Sie wollte sich abwenden und in das Hauptschiff laufen, als die eichene Außentür aufschwang und ein Polizeibeamter eintrat.
Geraldine hatte den Dorfpolizisten bereits auf ihrem Weg hierher beobachtet. Der Lärm in der Kirche musste seine Aufmerksamkeit erregt haben, und er sah sich gezwungen seinen Dienst zu verrichten. Kaum erblickte er, was sie angerichtet hatte, da stand er ihr auch schon breitbeinig in oftmals eingeübter Schussposition gegenüber. Die Waffe im Anschlag, die Augen fixierend auf sie gerichtet.
Sie reagierte mit den in vielen Jahren trainierten Reflexen, spannte die Gesichtsmuskulatur an, zog den Unterkiefer zurück, senkte die Brauenpartie und veränderte so ihr natürliches Aussehen im Bruchteil einer Sekunde. Die beste Maske ist das eigene Gesicht, hatte ihr schon ihr Großvater erklärt.
Allenfalls ihr langes Haar, die beige Bluse und die Jeans blieben als unveränderte Merkmale. Aber Kleider konnte man wegwerfen und Haare frisieren. Ihre Augen verbargen sich hinter farbigen Kontaktlinsen. Außerdem befand sich der Beamte viel zu weit entfernt, um zuverlässig ihre Augenfarbe zu benennen.
„Lassen Sie das Beil fallen“, befahl er.
„Streitaxt“, sagte Geraldine.
„Verdammt, lassen Sie das Ding fallen.“ Geraldine sah, dass der junge Mann sich alle Mühe gab, beherrscht und autoritär zu sprechen, aber ein leichtes Beben des rechten Knies verriet seine Nervosität. „Los, machen Sie schon, sonst werde ich schießen.“
Geraldine dachte noch über eine Alternative nach, da begann das Orgelspiel. Bei den Klängen, die das Instrument erzeugte, handelte es sich nicht um eine melodische Tonfolge, die der Kraft und Erhabenheit eines Gottes huldigte, sondern um eine ohrenbetäubende Kakophonie. Wie ein Aufschrei tausender Kreaturen, die in einem fernen Urwald vor einem Feuer flüchten, auf- und abschwellende Schreie im Höllenfeuer versinkender Seelen.
In einem Reflex wollten die Hände zu den Ohren, um diese vor dem Lärm zu schützen.
Der Beamte beherrschte sich, diesem zu gehorchen, aber für eine Sekunde war seine Aufmerksamkeit dennoch abgelenkt. Seine Augen irrten von Geraldine ab zur Tür hinter ihr, als könne er den wahnsinnigen Orgelspieler dort erkennen. Diesen Moment nutzte sie und schleuderte ihm die Axt entgegen. Gleichzeitig stürmte sie der Waffe hinterher auf ihn zu.
Er trat, erneut ein Reflex, einen Schritt zurück, als er Stahl und Holz sich überschlagend auf sich zurasen sah. Sein folgender Schuss verfehlte dadurch das Ziel und traf einen hölzernen Engel aus dem 16. Jahrhundert. Im nächsten Augenblick war Geraldine bei ihm, über ihm. Wie tausendmal geübt trat sie ihm in den Bauch. Der nächste Kick ging in Richtung seiner Leber. Der Mann klappte zusammen. Sie warf sich auf ihn, schlug ihm mit den Händen gleichzeitig gegen beide Schläfen und nahm ihm die Waffe ab. Sie hockte sich auf seine Brust, die Arme mit den Beinen auf den Boden drückend. Ihre Hände suchten die Handschellen. All das geschah in Bruchteilen von Sekunden. Der junge Beamte war noch immer benommen, da fand er sich bereits auf dem Bauch liegend, die Hände auf dem Rücken gefesselt. Geraldine, inzwischen wieder mit der Streitaxt in der Hand, stand breitbeinig über ihm und atmete gleichmäßig ein und aus, um sich ein wenig zu beruhigen. Sie brauchte ihre volle Konzentration.
„Seien Sie froh, dass es so glimpflich für Sie abgegangen ist“, sagte sie. „Wenn Milos sie erwischt hätte, wären Sie ein blutleerer Sack.“ Sie deutete auf den Torso hinter sich, ungeachtet der Tatsache, dass der Polizist zu ihren Füßen dies nicht sehen konnte.
Aus dem Hauptschiff der Kirche drang weiterhin unausgesetzt der Lärm des Orgelspiels. Sprängen drei Affen auf Manual und Pedal des Instrumentes herum, es könnte nicht unmelodischer klingen.
„Also gut, Laszlo“, sagte Geraldine, legte die Axt über ihre Schulter und marschierte zum Eingang in das Hauptschiff, als wäre sie ein Holzfäller, der zu seinem Tagwerk im Wald aufbrach.
Das Erste, was sie bemerkte, war der Leichnam des Pfarrers auf dem Altar. Wie eine weggeworfene Lumpenpuppe lag er dort neben den umgestürzten Leuchtern. Um ihm zu helfen, kam sie also zu spät. Eigentlich wusste sie das, seit das irrsinnige Orgelspiel eingesetzt hatte. Sie wandte sich um und ging rückwärts weiter in den Raum hinein, den Blick nach oben zur Orgelempore gerichtet, wo ihr Gegner sein Konzert gab.
„Laszlo!“, rief sie. „Ich bin hier.“
Die Orgel verstummte mit einem dumpfen Schnaufen. Helles Lachen füllte im nächsten Moment den Sakralbau.
„Was ist so lustig?“
Das Lachen brach ab. „Du“, kreischte jemand von oben herab. „Ihr Menschen. Immer so bemüht, unsereiner aus dem Weg zu räumen. – Was ist mit Milos?“
„Ist ein wenig kopflos geworden bei meinem Anblick“, rief sie hinauf.
Wieder antwortete ihr schrilles Lachen. In alten Filmen lachten die verzweifelten Insassen von Irrenanstalten auf diese Weise. Ein unmenschliches Geräusch, als nutzte jemand eine kurbelgetriebene Lachmaschine, die schlecht geölt worden war. Und erneut brach dieses Lachen abrupt ab. Jemand legte einen Hebel an eben jener Maschine um und sie hielt ohne Verzögerung an.
Sie sah Laszlo von Ödermark auf der Balustrade der Orgelempore stehen. In einer ausladenden Geste spreizte er beide Arme, seinen nachtblauen Umhang präsentierend. Im nächsten Augenblick sprang er und landete federnd drei Schritte von Geraldine entfernt. Sie bewegte sich kein Jota. Sollte er sich in Posen werfen so viel er mochte, es sollten schließlich seine letzten werden.
Er lächelte sie an, das heißt, so hätte es vielleicht für einen unbeteiligten Beobachter ausgesehen, wenn ein solcher zugegen gewesen wäre. Aber Geraldine wusste, dass er in Wahrheit nur sein Gebiss präsentierte. Die beiden Eckzähne sahen im Schein der Kerzen besonders beeindruckend aus. Leuchtend weiß hoben sie sich vor den blutroten Lippen ab, die auf den ersten Blick wie geschminkt wirkten.
„Es wird mir ein Vergnügen sein, auch das letzte Zweiglein des Baumes abzutrennen, der auf dem stolzen Namen van Helsing gründet“, sagte er.
Er wollte sie reizen, wollte eine überhastete Reaktion provozieren. Das war ihr bewusst. Dennoch spürte sie ein leichtes Zucken in ihrem rechten Arm. Der wollte offenbar, ohne einen Befehl des Hirns abzuwarten, die Axt auf den blutsaufenden Bastard schleudern. Sie nahm sich zusammen, lächelte stattdessen zurück.
„Wissen Sie, Laszlo, das unterscheidet sie schon immer von Ihrem Bruder. Sie halten zu viel von sich selbst. Das ist bei euch Blutsaugern genauso wie bei normalen Menschen. Es gibt Arschlöcher und es gibt große Arschlöcher. Und bei Ihnen hat es zum großen Arschloch nicht gereicht, darum reißen Sie das Maul zusätzlich auf, wenn überschüssige Luft aus dem Körper muss.“
„Ich denke, das genügt an höflicher Konversation“, entgegnete ihr Gegenüber. „Beginnen wir mit dem Abendessen.“
Für den Ungeübten wäre die Bewegung des Vampirs nicht erkennbar gewesen. Scheinbar aus dem Stand sprang er nahezu zwei Meter in die Höhe und auf Geraldine zu. Aber sie verstand ihr Handwerk, weitergegeben von Generation zu Generation. Sieben davon trennten sie von ihrem berühmten Vorfahren.
In einem oftmals trainierten, verfeinerten Bewegungsablauf trat sie einen Schritt zurück und schwang zugleich die Axt über ihre rechte Schulter, ihre Augen dabei stets auf den Widersacher gerichtet, der sich von oben herab auf sie stürzen wollte. Der reagierte seinerseits blitzschnell, warf die Arme nach vorn und sorgte so dafür, dass sich seine Flugbahn verlängerte und er in Geraldines Rücken landete. Seine Lackschuhe streiften ihr blondes Haar.
Sie fuhr auf dem Absatz herum, da umschlangen sie bereits seine sehnigen Arme und pressten die ihren eng an den Leib. Unfähig die Streitaxt einzusetzen starrte sie in seine silberfarbenen Augen, hell wie Bergseen.
„Nun, mein Liebchen“, flötete er. „Hast du einen letzten Wunsch?“
„Verrecke!“ Sie nahm die Schulter zusammen, stieß so viel Luft aus den Lungen wie möglich, senkte den Brustkorb und tauchte nach unten aus der Umklammerung. Ehe er erneut zugreifen konnte, schlug sie ihm das stumpfe Ende der Streitaxt zwischen die Beine.
So seltsam es war, dass es überhaupt Untote gab, so unglaublich ihre Fähigkeiten den Normalsterblichen erscheinen mochten, so verblüffend erwiesen sich einige ihrer Schwachstellen. Vampire ließen sich nur durch Feuer, Enthauptung oder den berühmten Pflock in den Leib töten, ihre Wunden heilten unglaublich schnell und Schmerzen empfanden sie nur an wenigen ausgesuchten Stellen des Körpers. Aber eben dort, wo Geraldine traf, befand sich so eine Stelle und die Wirkung war nicht weniger heftig, als bei einem normalen Mann, wenngleich Laszlo von Ödermark schon lange Erfüllung bei einer Frau nicht in deren Schoß, sondern an ihrem Hals suchte.
Er sackte zusammen und griff nach seinen Weichen. Aber die Ablenkung von seinem Ziel, Geraldine zu töten, währte nur kurz. Im nächsten Augenblick hatte er sich bereits wieder gefangen, blickte nach oben und versuchte, sich schwungvoll aufzurichten, doch es war zu spät. Geraldine schwang die Axt über ihm und trennte mit einem wuchtigen Schlag seinen Kopf vom Rumpf.
Erschöpft ließ sie die Waffe fallen, holte tief Luft und ging zur letzten Reihe der Kirchenbänke. Sie setzte sich, strich ein paar Locken aus dem Gesicht und schaute den Überresten des Vampirs dabei zu, wie sie im Zeitraffer verwesten.
Sie wusste, dass sie so schnell wie möglich verschwinden musste. Nicht nur, weil irgendjemand sich auf die Suche nach diesem Polizisten begeben würde. Vampire waren eine rachsüchtige Spezies. Wer sie jagte und tötete, musste umgekehrt mit der gleichen Unerbittlichkeit rechnen. Diese Wesen lebten in Gruppen, deren Mitglieder in direkter Linie voneinander abstammten. Die Älteren jeder Gruppe fühlten sich für die Jungen verantwortlich. Geraldine kannte Laszlos Schöpfer nicht, aber sie konnte gewiss sein, dieser würde versuchen, seinen Nachkommen zu rächen.
Ältere Vampire besaßen mehr Erfahrung. Sie hatten über Jahrzehnte, gar Jahrhunderte bewiesen, dass sie den Jägern überlegen waren. Außerdem benötigte man das Überraschungsmoment, wenn man es mit einem Vampir aufnehmen wollte. Niemand konnte sich ihnen stellen, wenn sie vorbereitet und auf der Hut waren, und hoffen zu überleben. Sie sprachen gern von einem fairen Duell, aber ihre körperlichen Vorteile ließen das Wort ‚fair‘ zu einer Lüge verkommen, mit der sie den Gegner täuschten.
Wenn man also einen aus der Brut auslöschte, galt es zu allererst, in Deckung zu gehen. Für eine gewisse Zeit musste man die Augen überall haben, am besten tauchte man ein paar Monate unter.
Geraldine erinnerte sich an die Worte ihres Großvaters, die er ihr auf dem Sterbebett im Krankenhaus auf den Weg gab. „Sei auf der Hut, bis ihre Wut verraucht ist. Sie haben ein wildes, ungebärdiges Temperament. Ihr Hass ist schnell entfacht, kühlt aber ebenso rasch ab. Vermutlich fällt ihnen dann wieder ein, dass die Zeit auf ihrer Seite ist und die Rache übernimmt. Schau mich an.“ Er hustete krächzend. „Ich habe dreiundzwanzig Vampire getötet, dreiundzwanzig Mal musste ich in Deckung gehen. Und jetzt verrät mich der eigene Körper.“
Geraldine erinnerte sich daran, ihren Großvater umarmt und an seiner Schulter geweint zu haben.
„Wir können sie niemals alle töten“, sagte der alte Mann und fügte einen Satz hinzu, der ihr rätselhaft erschienen war. „Vielleicht ist das auch nicht unsere Aufgabe.“
Sie war davon überzeugt, genau das war die Aufgabe der Jäger, die Brut auszulöschen. Sie atmete entschlossen durch, stemmte sich aus der Bank und griff nach ihrer Waffe.
Im Vorraum, wo der junge Polizeibeamte gefesselt auf dem Boden lag, verstaute sie die Streitaxt in der Sporttasche, die achtlos hingeworfen hinter einer Säule lag, schulterte sie und lief, immer schneller werdend, hinaus.
Zur gleichen Zeit stand eine junge, etwas füllige Frau in der Bahnhofsbuchhandlung des Dresdner Hauptbahnhofes und blickte auf die Taschenbücher im Regal, nicht wissend, dass sie selbst Ziel eines aufmerksamen Beobachters war. Dieser stand müßig mit einer Sportzeitschrift in der Hand da, gab vor, darin zu blättern, widmete in Wirklichkeit aber ihr einen großen Teil seiner Aufmerksamkeit. Er bewunderte ihren schlanken, weißen Hals mehr als ihren ausladenden Busen oder die Beine, die unter dem gewagt kurzen Rock herausragten.
Die junge Frau entschied sich für ein Taschenbuch mit einem Einband in Rot und Schwarz. Vor dem Hintergrund eines düsteren Schlosses hielt ein junger Mann mit lockigem Haar und feurigem Blick eine schlanke Blondine in einem Ballkleid im Arm und lächelte sie an, vermutlich verführerisch nach Ansicht des Gestalters. Der Gesichtsausdruck der Maid lag irgendwo zwischen naiv verliebt und schwachsinnig. Eine Fledermaus flatterte über dem Paar.
Toralf Mahnstein hätte am liebsten laut aufgelacht, konnte es sich aber im letzten Augenblick verkneifen. Ausgerechnet eine dieser neumodischen Vampirschmonzetten hatte sich die junge Frau ausgesucht. Sie würde noch heute die Erfahrung machen, dass die Geschichten in diesen Büchern und die Wahrheit zwei verschiedene Paar Schuhe darstellten. Mochte sein, sie träumte sogar davon, eines Tages so einen schlanken, männlichen, kraftvollen und völlig abstinenten Vampir persönlich kennenzulernen. Seltsam, wie verdreht Menschen dachten. Das wäre so, als träumte sie davon, sich einen veganen Löwen zu halten.
Er klappte die Zeitschrift zu und stellte sie ins Regal zurück, während sein Blick der jungen Frau zur Kasse folgte. Als sie sich zum Ausgang wandte, setzte auch er sich in Bewegung.
Ein schneller Blick nach links und rechts, da entdeckte er sie wieder. Sie strebte dem Hinterausgang zu. Er folgte ihr, seit sie den Zug aus Richtung Elbsandsteingebirge verlassen hatte. Es freute ihn, dass sie sich nicht in Richtung Innenstadt wandte. Dorthin wäre er ihr vermutlich nicht gefolgt, auch wenn sie ihm ein ideales Opfer erschien. Seine Blutgruppe, sein Rhesusfaktor, keine Drogen, der Zyklus nicht in der blutigen Phase – all das hatte er wahrgenommen, als sie auf dem Bahnsteig an ihm vorbeiging. Dies und den schlanken Hals, der nicht zu ihrer ansonsten eher pummeligen Erscheinung passte. Ein Schwanenhals auf einem Drontenkörper.
Er folgte ihr in das beschauliche Wohnviertel hinter dem Bahnhof. Die Straße führte leicht bergan an einem fast fertigen Neubau und einer Schule vorbei. Kinder spielten auf einer Wiese davor Fangen. Toralf nahm dies alles wahr und noch viel mehr – den Herzschlag der Vögel in den Bäumen und auch den zweier Hasen, die sich irgendwo in einem Gebüsch verbargen, die Ausdünstungen der Stadt in ihrer Betriebsamkeit, den Sommerwind, der sanft über sein ebenmäßiges Antlitz strich. Er blickte flüchtig zu den Fenstern auf der linken Seite. Die Menschen, die dort ihren alltäglichen Verrichtungen nachgingen, ahnten gewiss nicht, was sich da durch ihre Straße bewegte. Genauso wenig wie die junge Frau ein paar Schritte vor ihm nicht ahnte, dass sich ihr vermutlicher Wunsch, einen Vampir kennenzulernen, in Kürze erfüllen würde.
Er rieb die Eckzähne leicht gegeneinander, um sie noch einmal zu schleifen. Eine jener Tatsachen, die er bisher nie in einem dieser albernen Bücher gelesen hatte, die seine Art als Kuscheltiere darstellten. Schön, elegant, weltgewandt und geradezu lächerlich ungefährlich. Aus Wölfen hatten die Menschen Hunde geformt, erst um die Herden und das Heim zu bewachen, später zu ihrem reinen Vergnügen. Jetzt glaubten sie, aus Vampiren eine ganze Brut von Casanovas erschaffen zu können. Sie verdienten einfach, was ihnen zustieß, wenn sie so etwas dachten.
Die junge Frau passierte das leerstehende Gymnasium. Eine Tafel verkündete, was das Land mit dem Gebäude vorhatte, das aus leeren Fensterhöhlen auf die Straße glotzte. Ein Zaun sicherte das Gelände, das einstmals der Schulhof gewesen war. Baumaterial türmte sich dort, wo zuvor Kinder gespielt und Schüler höherer Klassenstufen heimlich geraucht hatten.
Mit drei schnellen, weiten Sprüngen war Toralf an der Seite der jungen Frau.
„Guten Abend“, sagte er mit weicher, gutturaler Stimme. „Wie ich sehe, interessieren Sie sich für Vampire.“
Sie blieb stehen, fuhr herum und starrte ihn mit großen, dunklen Augen an. Angst und Überraschung kämpften in ihrem Gesicht und strömten aus ihren Poren. Er hörte, wie ihr Herzschlag sich beschleunigte, die Atmung heftiger wurde, der Körper sich auf Flucht oder Kampf vorbereitete. Uralte Instinkte übernahmen die Kontrolle der Vitalfunktionen.
Er lächelte sie an und versenkte seinen Blick in ihren. „Sie müssen keine Angst haben“, sagte er.
Er spürte, dass ihr Körper sie dazu drängte, weiterzugehen, Raum zwischen sich und diesen Fremden zu bringen, der sie mit makellosen Zähnen anlächelte. Der Körper wusste besser als der Verstand, was richtig war in jenem Augenblick. Aber die Gedanken irrten ab, blockierten die Reflexe, gefangen genommen von seinem Blick.
„Geben Sie mir das Buch“, forderte er und hielt ihr eine Hand offen hin. Wortlos gehorchte sie. Er schaute auf den Titel. Abscheu durchflutete seine Gedanken.
„Wissen Sie“, sagte er in dem leichten Singsang, den er als seine Jungfernansprache bezeichnete, „das ist alles nicht wahr. Vampire sind nicht so.“
„Wie sind sie dann?“, fragte sie mechanisch, als sage sie auswendig gelernten Text auf.
„Ich zeige es Ihnen.“ Er entblößte seine Eckzähne. „Kommen Sie.“ Er nahm sie an der Hand und führte sie in die Seitenstraße an dem Bauzaun vorbei. Sie folgte ihm willenlos.
Nachdem sie sich weit genug von der Hauptstraße entfernt hatten, packte er sie von hinten um die Hüfte und sprang. Mit einem einzigen Satz überwand er den zwei Meter hohen Zaun, ihr Gewicht im Arm nicht mehr als eine Feder für ihn. In diesem Augenblick fiel der Zauber von ihr ab. Noch ehe sie auf der anderen Seite landeten, begann sie zu treten und nach ihm zu schlagen.
„Lassen Sie mich los! Hilfe! Hilfe!“ Ihre Schreie gellten durch das Viertel und würden Passanten auf den Plan rufen. Er musste sich beeilen.
Er presste ihr eine Hand auf den Mund und bleckte seine Zähne. „Wolltest du nicht schon immer einem echten Vampir begegnen?“
Sie grummelte etwas aus den verschlossenen Lippen, anschließend versuchte sie, den Mund zu öffnen und ihn zu beißen. Sie – ihn beißen! Er presste die Hand fester auf ihren Mund, versuchte gleichzeitig, mit den Fingern eine Nasenklammer zu formen, um ihr jegliche Luft zu rauben.
„Du kannst leben“, raunte er ihr ins Ohr. „Aber nur, wenn du mir meine Mahlzeit nicht länger verweigerst. Ich mag es gar nicht, wenn mein Essen wie am Spieß schreit.“
Sie grunzte erneut und er gab ihr eine Chance. Er entließ ihre Nase aus der Umklammerung seines Zeige- und Mittelfingers der Rechten. Danach senkte er seine Zähne in ihren Hals. Sie wollte sich erneut befreien, als sie den Biss spürte, aber die Wirkung des betäubenden Speichels setzte Augenblicke später ein. Das wenige Blut, das er nicht trank, förderte ihn sofort Richtung Hirn und ließ sie in seinen Armen schlaff werden.
Gesättigt ließ er sie schließlich zu Boden gleiten. Es befand sich noch genug Leben in ihr. Sie würde mit einem Brummschädel erwachen, sich fühlen wie bei einer schweren Grippe und diese seltsamen Stiche am Hals finden. Wenn sie aus ihren Büchern genug gelernt hatte, würde sie wissen, was ihr geschehen war.
Er nahm ihr das Buch aus der schlaffen Hand, betrachtete den Einband und schüttelte den Kopf über so viel Dummheit. Über keine andere Spezies gab es mehr wirre Theorien und falsche Behauptungen wie über Vampire. Früher glaubten die Menschen, sie könnten sich in Fledermäuse oder Wölfe verwandeln – ausgerechnet in Wölfe! Aber diese uralte Feindschaft mit den Werwölfen war auch nur herbeigeredet und entbehrte eigentlich jeder Grundlage. Dann die Mär, sie würden unter dem Einfluss von Sonnenlicht zerfallen oder Knoblauch meiden, oder man müsse Reis ausschütten, und sie würden diesen unbedingt zählen müssen. Als wären sie autistische Kinder.
Ja, sie waren Wesen der Nacht, weil sie dort die Vorteile ihres feinen Gehörs und Geruchsinns besser ausnutzen konnten, aber schon der erste Vampirjäger hatte richtig erkannt, dass sie auch bei Tage durchaus ihren Geschäften nachgehen konnten. Sie litten unter einem Mangel an Melanin, aber dieser war keineswegs tödlich, wenn sie sich nicht nackt am Strand stundenlang in der Sonne brieten, wie die Menschen es so gern taten.
Ja, sie konnten aus dem Stand bis zu drei Meter hoch springen, aber keineswegs konnten sie fliegen oder sich in ein fliegendes Wesen verwandeln. Und heutzutage trugen sie zumeist auch keine weiten Umhänge mehr, die sie tatsächlich wie zu groß geratene Fledermäuse aussehen ließen.
Früher, in jener Zeit, als er sich verwandelte, hielt man sie für Ausgeburten der Hölle, Geschöpfe des Teufels. Man glaubte, es mit blutrünstigen Bestien zu tun zu haben, die nicht eher ruhten, bevor ihre Opfer nicht vollständig entleert waren. Das war genauso unsinnig wie der aktuelle Trend, sie allesamt für großartige Liebhaber mit ungewöhnlicher Ernährungsweise zu halten.
Nach seiner Erfahrung gab es genau zwei Arten von Vampiren. Die, die sich mit ihrem Schicksal abgefunden hatten, und jene, die dagegen rebellierten. Er selbst zählte sich zur ersten Gruppe.
Bei den anderen äußerte sich die Ablehnung des eigenen Daseins auf zwei sehr gegensätzliche Arten und Weisen. Die einen verhielten sich introvertiert, zogen sich mehr und mehr zurück, hungerten oft wochenlang, sie waren es, die die Mär vom Vampir prägten, der in einem Sarg schlief, blass und ausgemergelt aussah und sich vor Kruzifixen, Knoblauch und allem möglichen anderen Unsinn fürchtete. Sie schlichen bei Nacht und Nebel durch die Stadt und bettelten um Blut, statt es sich zu nehmen, wie es einem Raubtier geziemte.
Die anderen lebten ihr Vampirdasein auf der Überholspur mit viel zu großem Tempo. Sie wollten einem Vampirjäger in die Hände fallen, um im Kampf auf Leben und Tod zu sterben. Sie ließen keine Gelegenheit aus, auf sich aufmerksam und sich außerdem unbeliebt zu machen. Sie ließen keine lebenden Opfer zurück, feierten Blutorgien, gaben sich tatsächlich als Kinder der Hölle. Ihnen verdankten die Vampire ihren üblen Ruf. Wo immer man von Vampiren als Bestien sprach, fand man ein paar von dieser Sorte in der Nähe. Und doch stellte ihr ganzes Tun einen einzigen Hilfeschrei dar.
Was es nach Toralfs Erfahrung, und diese reichte weit in die Vergangenheit, nicht gab, waren Vampire, die dem menschlichen Blut abgeschworen hatten. Der Grund dafür konnte gar nicht einfacher sein: Solche Vampire wären innerhalb von wenigen Tagen nur noch Staub. Es hieß nicht umsonst Blutdurst, denn so wie Durst schneller als Hunger tötete, ließ auch das Ausbleiben des menschlichen Lebenssaftes Vampire in kurzer Zeit verblühen.
Er warf das Buch mit einer lässigen Bewegung des Handgelenks auf den Boden neben die junge Frau, wischte sich erneut über den Mund und sprang über den Zaun zurück auf die Straße. Mit elastischem Schritt machte er sich auf den Weg zum Hotel.
Der Schlag traf Toralf, wenige Minuten nachdem er sein Zimmer betreten hatte. Gerade stand er noch vor dem Spiegel und glättete sein schwarzes Haar und im nächsten Augenblick krümmte er sich auf dem Boden, mit Gefühlen im Leib, als würde ihm ein Pfahl hineingetrieben. Er wusste, was das bedeutete. Er hatte es schon mehr als einmal erleben müssen.
Jeder Vampir erzeugte in seinem Leben Vasallen. Vampire von seinem Blute im wahrsten Sinne des Wortes. Geboren aus dem Kuss des Vampirs. So, wie Menschen Kinder gebaren, diese aufzogen, ihnen ihr Wissen und ihre Werte vermittelten, kümmerte sich ein Vampir um seinen Vasallen, lehrte ihn, was es bedeutete, Vampir zu sein. Bis dieser eines Tages ein eigenes Revier suchte. Aber der Schöpfer blieb mit seinem Vasallen ewig durch Blutsbande verknüpft, spürte dessen Freude und seinen Schmerz und ganz besonders heftig seinen Tod.
Toralf besaß mehr als einen Vasallen, wusste nicht genau, welchen von ihnen das Schicksal getroffen haben musste. Aber er besaß eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wer am ehesten als Opfer in Frage kam. Laszlo! Als junger Vampir voller Ehrgeiz und Begeisterung, packte ihn schon bald der Übermut. Er langweilte sich und füllte diese Langeweile mit Schlachtfesten. Er zelebrierte seine Mahlzeiten auf eine Art und Weise, die manche Menschen in Büchern schilderten, die man als Horrorromane bezeichnete. Laszlo saugte nicht einfach Menschen aus, er suchte sich solche, die irgendeinem Glauben anhingen. Erst zerstörte er ihren Glauben, anschließend ihren Körper.
Das Kreuz sollte Vampire abhalten, sollte sich wie ein feuriges Schwert in ihren Körper fressen. Eine lachhafte Idee, so lachhaft wie alles, was man über sie erzählte oder niederschrieb. Halbwahrheiten, Legenden, Aberglauben. Niemand gab sich die Mühe, sie wirklich begreifen zu wollen. Bestenfalls gab es Menschen wie Van Helsing und seine Brut, die mit seinesgleichen in einer Art ewigem Krieg lagen. Menschen, die das eigene Leben dem Tod der Vampire gewidmet hatten. Weshalb, das mochten die Götter wissen, wenn sie tatsächlich existierten. Aber diese Jäger versuchten zumindest mehr über ihre Beute herauszufinden, als all die anderen Menschen, die tatsächlich nicht viel mehr Geist versprühten als wandelnde Blutbeutel.
Van Helsing hatte mit einer ganzen Reihe von Irrglauben aufgeräumt, allerdings auch mit einer ganzen Reihe von Vampiren, und seine Nachfahren taten es ihm gleich.
Langsam zog der Schmerz sich zurück, Toralfs Blick klärte sich. Kalter Schweiß bedeckte seinen Körper, ein Gefühl, das ihm Ekel bereitete. Er richtete sich wieder auf, schwerfällig, als lasteten tatsächlich all die Jahre auf ihm, die er auf dieser Welt zugebracht hatte. Dann entledigte er sich seiner Kleider in fieberhafter Eile. Keine überflüssige Sekunde ertrug er diese feuchten Zeichen ehemaliger Menschlichkeit. Er benötigte eine Dusche dringender als ein Wüstenwanderer am Ziel der Reise. Wenn er gereinigt war, war er wieder er selbst, konnte wieder klar denken. Danach stünde er bereit, zu überlegen, wie er diesem Frevel gegen einen seiner Abkömmlinge begegnen wollte. Er hob den Kopf, blickte erneut in den Spiegel. Auch so ein Irrglaube! Vampire sähen sich nicht im Spiegel. Als ob die Gesetze der Physik sich darum scherten, welche Lebensform man darstellte. Ebenso gut konnte man vermuten, Frösche oder Hamster würfen kein Spiegelbild. Er bleckte die Zähne, nickte sich zu und ging ins Bad.
Er kehrte dampfend und mit nassem Haar zurück, verschnürte seine Kleider mit Ärmeln und Hosenbeinen zu einem Bündel, das er so schnell es ging entsorgen würde. Er trat an den Schrank, wählte frische Unterwäsche, ein gestärktes weißes Hemd und eine dezente Krawatte. Er zog diese Kleidung an, kehrte zurück, nahm eine dunkle Hose vom Bügel, schlüpfte hinein, trat an den Spiegel, richtete die Krawatte und stellte für sich fest, sich endlich wieder wie ein Vampir zu fühlen.
Er musste mit seinen Vasallen sprechen. Einer würde sich nicht melden, einer wäre nicht mehr in der Lage zu antworten. In alter Zeit war es ein schwieriges Unterfangen gewesen, herauszubekommen, wen er verloren hatte. Man reiste mit einer Kutsche herum und suchte jeden einzeln auf. Manchem jagte man wochenlang hinterher, ehe sich am Ende herausstelle, genau dieser fehlte. Heute genügten ein paar Telefonate.
Er ging zum Nachtschränkchen, zog die Schublade auf und nahm das Smartphone heraus, das neben der Bibel lag. Die Nummern all seiner Vasallen fanden sich eingespeichert. Eine würde er löschen können.
Obwohl er sich im Grunde sicher war, dass es sich um Laszlo handelte, wählte er erst einige andere. Er hätte nicht sagen können warum, fragte ihn jemand in diesem Moment. Ein Gefühl der Verwundbarkeit, der Hilflosigkeit, das dem Wesen des Vampirs diametral entgegengesetzt stand, saß in seinem Hinterkopf und quälte ihn. Nicht zu wissen schien so viel leichter als zu wissen. Dennoch wählte er die erste gespeicherte Nummer aus. Er lauschte, eine leise, leicht verrauschte Stimme antwortete ihm aus einem fernen Land.
„Wo steckst du gerade? – Ah! – Na, dann viel Spaß mit den dunkelhäutigen Schönheiten.“
Marques entsprach am ehesten den Vorstellungen der Zeit von einem Vampir. Toralf trennte die Verbindung und wählte die nächste Nummer. So arbeitete er sich durch das Verzeichnis. Zwei seiner Vasallen meldeten sich nicht: Laszlo und Gerlinde. Er hinterließ eine Nachricht, in der er um umgehenden Rückruf bat.
Unruhig wie ein gefangenes Tier lief er durch den Raum. Die Ungewissheit fraß an ihm. Er trat ans Fenster, zerrte die Gardine zur Seite und riss einen Flügel auf. Er spürte die einströmende kühlende Luft auf seinen Wangen. Er musste sich beruhigen, die Unruhe zügeln, die ihn so plötzlich befallen hatte, wie Übelkeit nach einer Vergiftung. Er musste sich gedulden, später noch einmal anrufen.
Wenn er wusste, wen von seinen Vasallen das Schicksal ereilt hatte, würde er den nächsten Schritt gehen. Er würde den Mörder herausfinden. Die Zahl der Vampirjäger ließ sich an einer Hand abzählen, ihre große Zeit lag lange zurück. Heute, in einer Epoche, da die meisten Menschen Vampire für einen Aberglauben hielten, da Wissenschaftler alle möglichen Krankheiten als Ursache für diese Legende anführten, heute zogen lediglich ein paar Wissende mit Axt, Feuer und Pflock herum, um Vampiren das Leben zu nehmen. Da gab es Dick Jefferson, der sein Wissen über viele Generation hinweg auf seinen Urahn Thomas zurückführen konnte. Im Osten lag Jewgeni Aljechin auf der Lauer. Und ja, auch der hatte einen berühmten Verwandten, der allerdings die Jagd auf Vampire vernachlässigt und stattdessen Könige über ein Holzbrett getrieben hatte. Und in Europa agierte Geraldine Silvestri. Der letzte Spross der Van Helsings. Sie hieß nicht einmal mehr so. Sie arbeitete in einem Beruf, der es ihr erlaubte, mal hier mal dort aufzutauchen und ihrer eigentlichen Berufung nachzugehen. Er hatte darüber recherchiert. Die Fotojournalistin tarnte die Vampirjägerin.
Er schloss das Fenster, sah auf die Uhr. Nicht einmal fünf Minuten waren vergangen. Er würde sich die Beine vertreten, einen kurzen Spaziergang um den Block machen. Anschließend konnte er die Anrufe wiederholen, die zuvor ohne Antwort geblieben waren.
Als er etwa eine halbe Stunde später wieder das Hotelzimmer betrat, zeigten sich bereits die ersten Sterne am Himmel. Venus leuchtete zum Fenster herein.
Toralf griff zum Smartphone, setzte sich auf das Bett und wählte Laszlos Nummer.
„Hallo, wer spricht da?“ Eine fremde Männerstimme meldete sich. Toralf musste sich bezähmen, nicht einfach das Gespräch zu beenden. Unwahrscheinlich, dass Laszlo jemand fremden sein Handy benutzen ließ, wenn er angerufen wurde. Jedenfalls, wenn er selbst in der Nähe und in der Lage war, ein Telefongespräch zu führen.
„Toralf Mahnstein, ich möchte mit Laszlo von Ödermark sprechen. Wer sind Sie eigentlich? Wie kommen Sie zu seinem Handy?“
„Laszlo von Ödermark heißt der Besitzer dieses Handys? Kannten Sie ihn?“
„Wer sind Sie?“, schrie Toralf statt einer Antwort.
„Hennig Jensen, Kriminalpolizei Jülich“, sagte die Männerstimme sehr ruhig. „Es ist zu befürchten, dass ihr Bekannter Opfer eines Verbrechens wurde.“
„Was soll das heißen?“, fragte Toralf, obwohl er ziemlich gut wusste, was dies bedeutete.
„Nun, in einer Dorfkirche hier in der Nähe hat es einen Zwischenfall gegeben.“
„Zwischenfall?“
„Ich könnte Ihnen mehr darüber sagen, aber nicht am Telefon. Wo befinden Sie sich? In der Nähe? Könnten Sie nach Jülich kommen?“
„Ich wohne zurzeit in Dresden“, sagte Toralf.
„Mmh.“ Sein Gesprächspartner gab ein missmutiges Grunzen von sich.
„Ich könnte morgen nach Jülich kommen, wenn es wichtig ist.“
„Ja, es ist wichtig. Sehen Sie, der Besitzer dieses Handys ist verschwunden. Allerdings ist etwas merkwürdig.“
„Was?“
„Er hat seine Kleidung zurückgelassen. Ich meine, selbst in einem Dorf sollte ein nackter Mann auffallen, der durch die Straßen läuft.“
Dieser Satz bestätigte Toralf Laszlos Ende. Er benötigte keine Kleider mehr, nicht das winzige Häufchen Staub, das lediglich von ihm geblieben sein sollte. Ein Detail, das der Beamte am Telefon nicht preisgab. Dessen Stimme klang auch so, als sei Laszlos Verschwinden nicht das einzige Problem bei diesem Fall. Und auch da besaß Toralf eine gute Vorstellung davon, was sein Gesprächspartner verschwieg. Es gab eine Leiche in dieser Kirche – eine blutleere Leiche.
Toralf bestätigte noch einmal, dass er am nächsten Tag nach Jülich kommen und sich auf der Polizeistation melden würde. Er gab dem Beamten seinen Namen und seine derzeitige Adresse durch und trennte die Verbindung.
Er würde nach Jülich fahren. Er würde herausbekommen, wer Laszlo getötet hatte. Danach käme die Abrechnung.
2
Am nächsten Nachmittag fuhr Toralf mit seinem Mercedes E-Klasse an der Polizeistation in Jülich vor, parkte ordnungsgemäß, schälte sich aus den dunklen Ledersitzen und blickte zu dem langweiligen, dreigeschossigen Bau mit Klinkerfassade hinüber. Wer immer dieses Gebäude entworfen hatte, wollte jedem Menschen offenbar das Gefühl vermitteln: Bleib draußen und du bist besser dran. Wenn man Langeweile eine Gestalt geben wollte, kam man zu dieser architektonischen Darstellung.
Er schloss sein Auto ab und ging zum Eingang. Dort meldete er sich beim Pförtner und sagte, er wolle zu Herrn Jensen. Der Mann hinter der Scheibe wies ihm den Weg, nachdem er seine Personalien registriert hatte. „Zweiter Stock, erst links, dann rechts, dritte Tür.“
Toralf fand den Raum ohne Probleme und klopfte.
„Herein!“, scholl es von drinnen.
Er folgte dem Aufruf und trat ein. Ein Mann in mittleren Jahren mit ganz eindeutig gefärbtem Haar, einem breiten Schädel und Blutgruppe B positiv sah ihn an und fragte, wer er sei und was er wolle.