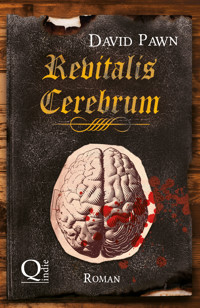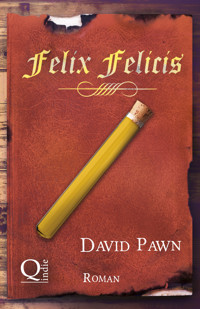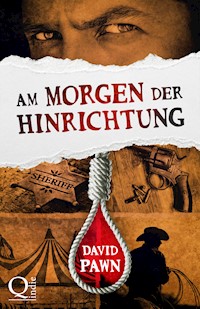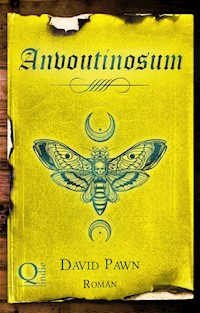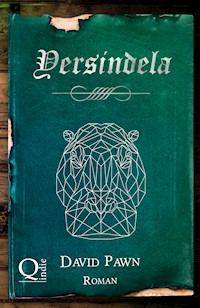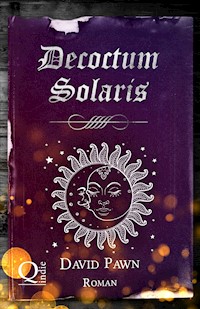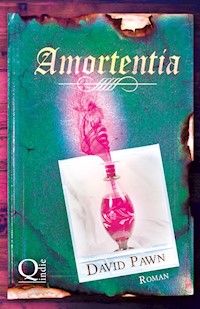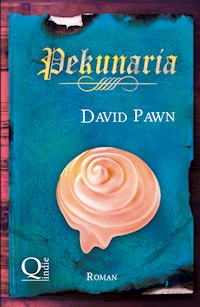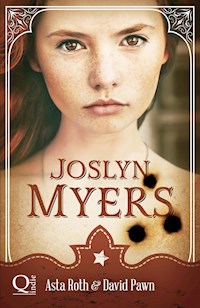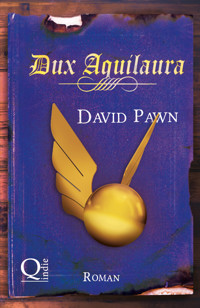
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
„Meine Güte, eine Schlacht, eine richtige Schlacht. Wenn ich das meiner Frau erzähle, glaubt sie mir kein Wort.“ Nicht nur der Chef der Aurorenwache an der Steinernen Renne staunt über die Entwicklungen, die dem Absturz des gefeierten Suchers der „Werwölfe Wernigerode“ beim Eröffnungsspiel folgen. Denn als man an der Heilerstation einen unerlaubten Trank im Blut des Suchers nachweist, und diese Information an die Presse durchsickert, bereiten einige sogenannte Fans den Heilern Probleme. Nichtsdestotrotz ringen diese um das Leben des jungen Mannes, dessen Organe ein ums andere Mal versagen. Sophus Schlosser aber muss erfahren, dass es im Harz Magier gibt, die es nicht ertragen, wenn unliebsame Wahrheiten ausgesprochen werden, erst recht nicht, wenn Menschen diese aussprechen, die nicht im Harz geboren wurden. So kommt es, dass seine Geliebte in die Schusslinie gerät, nur weil sie zu ihrem Verständnis von Fairness steht. Der vierte Band der Zaubertränke-Reihe erzählt eine neue spannende Geschichte um Magie, Liebe, Heilkunst und Fairness in einem Harz voller Zauberei. Für alle, die wissen wollen wie es mit Sophus, Lyra und deren Kollegen an der Heilerstation weitergeht oder in eine bekannte und doch ganz andere Welt der Magie eintreten möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Dux Aquilaura
David Pawn
Ich entschuldige mich bei allen Fans von Harry Potter, dass ich Ideen und Grundannahmen aus den Büchern von Minerva Mc…, sorry, J. K. Rowling in dieser Geschichte verwendet habe, denn Sophus gibt keine Ruhe. Endlich scheinen alle Probleme beseitigt, er könnte auf den Schwingen des Adlers ins Glück fliegen, aber Heiler haben niemals wirklich Pause.
Mein besonderer Dank gilt Tamara Hayessen für ihre Unterstützung in der finalen Phase der Umsetzung dieser Geschichte.
Copyright © 2015 David Pawn
Michael Siedentopf
Schweizer Str. 40
01069 Dresden
Umschlaggestaltung: Casandra Krammer
Umschlagmotive: © Shutterstock / lanych - 170428316, Kostenko Maxim – 108920759, Maria Kazanova - 95940892 und desertfox99 - 65943484All rights reserved
ISBN-13: 978-3754604069
Wie Sophus zum Quidditch geht
Sophus Schlosser, nach eigener Aussage Besenbinder, Hobby-Tränkebrauer und Weiberheld, inzwischen jedoch Mitarbeiter im Tränkelabor der Heilerstation „Drei Annen“, fühlte sich glücklich. Mit dem Flugbesen in der Hand stand er am Startplatz im Garten seiner Geliebten Lyra Bascomb, schaute in den Himmel und konstatierte ausgezeichnetes Flugwetter.
Heute, am Vorabend des ersten Tages im Mai, jenem Tag, der in den Gedanken jener Menschen, die nicht mit der Gabe der Zauberei gesegnet waren, fest mit dem Tanz der Hexen und des Teufels oben auf dem Blocksberg verknüpft bleibt, selbst in einer Zeit, da die meisten nichtmagisch Begabten Hexen, Zauberer und den Teufel für Gebilde aus gut verkäuflichen Büchern halten, begann traditionell die Quidditch-Saison im Harz. Sophus stand bereit, um mit Lyra zum Eröffnungsspiel der „Werwölfe Wernigerode“ zu fliegen. Das Stadion der Werwölfe befand sich seit über zwanzig Jahren auf der Westseite des Brockens in der Nähe einer kleinen Ansammlung von Häusern mit dem Namen Torfhaus. Seit der Einrichtung eines großen Touristenrefugiums mussten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, denn schließlich durften die nichtmagisch Begabten, ehemals und von vielen Zauberern immer noch Muggel genannt, nichts von dem magischen Sport wissen, der da vor ihrer Nase betrieben wurde.
„Accio weiß-roter Schal!“, hörte Sophus durch die offene Tür zum Garten Lyra zum dritten Mal intonieren. Sie hatte nach eigener Aussage das gute Stück im Herbst, bevor sie Opfer eines heimtückischen Zaubertrankes wurde, zum letzten Mal gesehen. Entweder erwies sich der Aufrufzauber als nicht stark genug oder der Schal befand sich nicht im Haus.
„Vielleicht liegt er auf der Heilerstation“, rief Sophus nach drinnen. Er wollte endlich aufbrechen, sonst bekamen sie lediglich Plätze auf einer der Schmalseiten des Stadions. Anders als beim bei nichtmagisch Begabten so überaus beliebten Fußball, wo Fans am liebsten im Halbrund hinter dem Tor saßen, konnte man eine Partie Quidditch am besten verfolgen, wenn man in der Mitte der Längsseite saß, vorzugsweise weit oben, schließlich fanden alle halsbrecherischen Eskapaden der Spieler in der Luft statt.
„Transvisio!“ Lyra wollte offenbar einen der verschlossenen Schränke inspizieren. Ein, zwei Sekunden Stille, dann ein triumphierender Ausruf: „Ha!!“ Sophus konnte das zweite Ausrufezeichen deutlich hören.
Ein schwerer Eichenholzdeckel schlug gegen eine Wand. Sophus wusste, dass die dazugehörige Truhe in Lyras Arbeitszimmer neben der Tür stand. Wenige Augenblicke später erschien Lyra mit dem Besen in der Hand an seiner Seite. Sie sah wie immer atemberaubend aus, fand er. Ihre milchkaffeebraunen Wangen zeigten einen leicht rötlichen Schimmer als Folge der hektischen Suche. Ihre grünen Augen strahlten wie Türkise magischer Ringe, ihre vollen Lippen lächelten ihn an. Er wollte sie küssen, doch sie streckte die freie Hand aus und sagte: „Jetzt nicht Sophus, sonst kommen wir zu spät. Wir müssen uns ohnehin sputen.“
‚So sind die Frauen‘, dachte er, als er zum Startplatz trabte. ‚Erst brauchen sie ewig, um fertig zu werden und dann drängeln sie.‘ Aber er wusste auch, wenn er überhaupt bereit war, auf eine Frau zu warten, so auf Lyra.
Obwohl kein ganzes Jahr vergangen war, seit er die in Schottland geborene Heilerin in einer Bar in Wernigerode kennengelernt hatte und bei dem Versuch gescheitert war, ihr einen Liebestrank in den Cocktail zu mixen, um sie gefügig zu machen, schien ihm, er würde sie bereits seit Ewigkeiten kennen. Vom ersten Augenblick an war er in heißer Liebe zu ihr entbrannt, eine Liebe, die ein Zaubertrank, den man ihm als Strafe verabreicht hatte, angeblich ins Unermessliche verstärkt hatte. Doch daran zweifelte Sophus, vielmehr blieb es seine unerschütterliche Überzeugung, dieser Trank könne nichts mehr verstärkt haben, zu groß seien seine natürlichen Gefühle gewesen. Inzwischen hatte er für seine Liebe drei Monate auf der stählernen Gefängnisinsel Sylt II verbracht, war zwei Mal mit dem Besen auf den felsigen Boden des Harzes gestürzt, hatte in den Tropfsteinhöhlen von Rübeland gefährliche Tierwesen gejagt und mit angesehen, wie die gesamte Heilerstation, wie von einem Erdbeben gebeutelt, erzitterte.
Seit etwas weniger als vier Monaten arbeitete er nicht mehr als einfacher Besenbinder in einer Werkstatt in Wernigerode, sondern als Laborant in der Tränkeabteilung der Heilerstation. Mit seiner Hilfe war es gelungen, die derzeitige Leiterin dieser Abteilung von einer heimtückischen Krankheit zu heilen. Der Leiter der Abteilung für Verletzungen durch Tierwesen, Gregorius Katenbauer, verfasste drei Artikel für die Fachpresse zu diesem Thema, von denen einer diesem vermutlich einen Preis des Bundesamtes für magische Angelegenheiten eintragen würde. Außerdem hieß es, er habe der Leiterin der Tränkeabteilung, Stephanie Simon, einen Heiratsantrag gemacht. Aber das mochte nur ein Gerücht sein, denn nirgendwo blühten Gerüchte so vielfältig wie in einer Heilerstation.
Als sie am magisch gesicherten Startplatz standen, der ihren Aufstieg vor neugierigen Blicken nichtmagisch Begabter verbarg, legte Lyra plötzlich ihren Besen zur Seite. Sophus schaute verblüfft.
„Ich glaube“, sagte sie, „wir apparieren besser. Sonst bekommen wir wirklich keine guten Plätze mehr.“
Sophus blickte skeptisch. Er apparierte nicht gern außerhalb von Wernigerode. Seiner magischen Fähigkeiten grundsätzlich unsicher zog er die langsame, aber relativ sichere Reise mit dem Besen vor.
Lyra breitete die Arme aus. „Komm her“, sagte sie. „Ich passe schon auf, dass du in einem Stück ankommst.“
Sophus zuckte die Schultern, legte den Besen zur Seite und ließ sich umfangen.
„Du weißt doch, wo das Stadion ist?“, fragte Lyra dicht neben seinem Ohr.
„Ja“, flüsterte er.
„Gut, konzentrier dich! Wir sind in Nullkommanix da.“
Sophus dachte an das Stadion, die drei hohen Torstangen mit dem kreisrunden Ziel auf jeder Seite, die Tribünen mit den Anfeuerungsrufe schreienden Magiern auf den vier Seiten des rechteckigen Platzes mitten im Wald. Er dachte an die zwölf durchtrainierten, fluggewandten Magier, sechs in jeder Mannschaft, die mit ihren Besen hoch in der Luft tollkühne Manöver flogen, einerseits um ein Tor am Hüter des Gegners vorbei zu erzielen, andererseits um einem der gefährlichen, als Klatscher bezeichneten Bälle auszuweichen, die die gegnerischen Treiber auf einen abfeuerten und die zusätzlich selbsttätig Kurs auf einen unaufmerksamen Spieler nahmen.
Sophus hatte davon gehört, dass nach dem Erscheinen der Memoiren des Helden des magischen Bürgerkrieges in England, Harry Potter, sogar die nichtmagisch Begabten Quidditch-Clubs gründeten, selbst wenn sie niemals auf einem Besen fliegen würden oder nur im Rahmen eines Unfalls, dessen Opfer sich anschließend in Lyras Obhut wiederfand, denn sie leitete die Muggelstation. Die meisten Muggel, oh, nichtmagisch Begabten, wussten um die Bedeutung von Quaffel, Klatscher und Schnatz und auch um die Rolle des Suchers – des ungekrönten Königs jeder Quidditch-Mannschaft.
Die finale Regel des Spiels, die jener Mannschaft zusätzliche hundertfünfzig Punkte zuerkannte, deren Sucher den kleinen, wendigen, sich selbständig verbergenden Ball namens Schnatz fing, sorgte dafür, dass ein exzellenter Spieler ein Spiel in der letzten Sekunde herumreißen konnte. Es hatte in den vergangenen zehn Jahren sogar Bestrebungen gegeben, eine Regeländerung zu erreichen und die Schnatzpunkte auf hundert zu reduzieren, wogegen die Puristen im Internationalen Quidditchverband Sturm liefen. Argumente, dass es ähnlich weitreichende Änderungen in Sportarten der nichtmagisch Begabten wie Volleyball und Tischtennis gegeben habe, wurden mit höhnischem Gelächter quittiert. Man könne sich doch kein Beispiel ausgerechnet an den Muggeln nehmen, hieß es. Auch das Argument, man würde damit die Bedeutung der übrigen Spieler, insbesondere der Jäger, anheben, ließen die Gegner einer Anpassung nicht gelten. Sicherlich lockte man einige erfolgreiche Jäger auf die Seite der Befürworter, aber dabei blieb es.
Sophus schloss die Augen, spürte Lyras Herzschlag an seiner Brust. Gemeinsam schwangen sie ihre Zauberstäbe, um wie ein Wesen aus Lyras Garten zu verschwinden und im nächsten Augenblick am Rand es Quidditchstadions von Torfhaus wieder aufzutauchen.
Sie erschienen mitten in einem Rudel von Fans der „Reisigreiter Rudolstadt“, die laut johlten, als sie der rotweißen Schals um ihre Hälse ansichtig wurden. Es gab zwar im Rahmen des magischen Sports keine Ausschreitungen, wie die nichtmagisch Begabten sie vom Fußball kannten, dennoch beeilten sich Sophus und Lyra aus der Traube von gegnerischen Anhängern herauszukommen, die ihnen Schmähungen der Art nachriefen, genauso würden die Werwölfe heute vom Platz fliehen.
Die Wahrheit würde vermutlich anders aussehen, denn die „Werwölfe Wernigerode“ waren seit vielen Jahren eine in der zweiten Liga etablierte Mannschaft, die im Vorjahr sogar an den Aufstiegsrängen gekratzt hatte. Aber drei Spiele vor Saisonende erkrankte ihr Star, der Sucher Franz Drescher. Das ließ sich nicht kompensieren.
Aber heute würde der junge Mann mit den semmelblonden Haaren wieder auf den Besen steigen. Ein Magier, zum Sucher geboren – klein, drahtig, fluggewandt wie ein Falke. Wenn er zu Beginn eines Spieles über den Platz lief, stets ein wenig breitbeinig, als hätte er einen Quaffel zwischen den Knien, kam man nicht auf den Gedanken einen begnadeten Sportsmann vor sich zu sehen. Die „Bild der Magie“ hatte Franz Drescher daher mit einem Albatros verglichen, am Boden tollpatschig, in der Luft unbezwingbar. Und bei diesem Spitznamen war es geblieben.
„Komm.“ Lyra nahm Sophus‘ Hand und zog ihn in Richtung zweier freier Plätze, die sie erspäht hatte, die dicht unter dem oberen Rand der Tribüne lagen. Von dort würden sie einen hervorragenden Blick auf das Geschehen haben.
Links und rechts von ihnen wogte das Stadion in Rot und Weiß, während sich auf der gegenüberliegenden Seite die Rudolstädter Farben Blau und Gelb konzentrierten. Immer wieder donnerte von dort her „Ru-Ru-Rudolstadt“ über den Platz, ein Ruf, den die Wernigeröder Anhänger mit lautem Wolfsgeheul beantworteten. Schaurig klang es über die Berge des Harzes hinweg. Würden die Rufe nicht an den Grenzen des Stadions durch schallschluckende Zauber abgefangen, müssten sie friedliche Wanderer im Umkreis in Angst und Schrecken versetzen. Plötzlich käme es ihnen gewiss so vor, als entsprächen die Legenden um die Walpurgisnacht der Wahrheit.
Es schien kaum möglich, aber als die beiden Teams von ihren Trainern und den beiden Schiedsrichtern angeführt auf den Platz liefen, steigerte sich der Lärm noch einmal. Von einigen Zauberstäben stiegen leuchtende Funken in den Abendhimmel über dem Brocken.
Der berühmte magisch nicht, aber ansonsten umso mehr begabte Dichter Goethe hatte die Walpurgisnacht in einem seiner Theaterstücke geschildert. Die Wirklichkeit im Stadion hätte seiner Schilderung Recht gegeben. Wer dieses Tosen unzähliger Stimmen, rhythmische Klatschen, Trampeln, Abfeuern magischer Raketen miterlebt hatte, wusste, weshalb die nichtmagisch Begabten bei einem Tumult von einem Hexenkessel sprachen, wenngleich sie selbst die Bedeutung des Ausdrucks gewiss nicht von den jubelnden Massen eines Quidditchspiels abgeleitet hatten.
Alle Spieler nahmen in einer Reihe in der Mitte des Spielfeldes Aufstellung, jede Mannschaft mit Blick auf ihren Fanblock. Ein jeder erhob sich von seinem Platz. Auf magische Weise erklang „Follow the broom trail“ über dem Platz. Tausende Zauberstäbe wurden simultan in die Luft gereckt und illuminiert. Ebenso viele Kehlen stimmten in die Quidditchhymne ein. Wer in diesem Augenblick keine Gänsehaut über seine Arme laufen fühlte, musste tot sein.
Anschließend stiegen die Spieler auf ihre Besen und in die Höhe auf. Der Oberschiedsrichter gab die Bälle frei. Das Spiel begann.
Während in Höhe der Torkreise Jäger und Treiber um den Besitz des Quaffels kämpften, taktische Manöver ausführten, um die Abwehr und den Hüter des Gegners zu verwirren, mal die eine, mal die andere Mannschaft leichte Vorteile geltend machen konnte, befanden sich der Albatros und der Sucher der Rudolstädter annähernd zwanzig Meter über dem eigentlichen Geschehen und hielten nach dem kleinen goldenen Ball Ausschau, der in achtzig Prozent aller Fälle das Spiel entschied.
Als die Rudolstädter nach anfänglicher Führung Wernigerodes plötzlich auf dreißig Punkte in Front zogen, setzten deren Anhänger zu lauten Jubelchören an. Jeder Schlag eines Rudolstädter Treibers an einen Klatscher wurde mit einem lauten „Hauruck“ begleitet.
Eine junge Frau mit einem Bauchladen ging durch die Reihen und versuchte Süßigkeiten und Getränke an Zauberer oder Hexe zu bringen, wurde jedoch nur immer wieder unwillig zu Seite gewedelt, wenn sie die Sicht versperrte.
Plötzlich ließ sich Franz Drescher seitlich aus der Höhe in Richtung der eigenen Torstangen fallen. In einem einzigen Schwenk senkte er den Besen, sauste dem felsigen Untergrund des Harzes zu.
„Das ist nur ein Bluff“, kommentierte Lyra. „Macht er gern mal.“
„Ich denke nicht“, erwiderte Sophus. „Ich habe da auch was blinken sehen.“
„Adlerauge Sophus“, frotzelte Lyra, denn als Drescher bemerkte, dass der gegnerische Sucher ihm keineswegs in die Tiefe folgte, zog er den Besen in eine Gerade und stieg anschließend in sanften Spiralen wieder auf, zwei Klatschern ausweichend, die ihn links und rechts passierten.
Gerade als er seine Position in luftiger Höhe wieder erreichte, brachen die Rudolstädter in erneuten Torjubel aus. Sie führten inzwischen mit fünfzig Zählern. Unter den Fans aus Wernigerode machte sich leichte Verstimmung breit. Die Anfeuerungsrufe wurden spärlicher, die Gesänge leiser. Umso lauter war der gegenüberliegende Fanblock zu hören.
Der Trainer der „Reisigreiter“ hatte seinen Mannen offenbar eingebläut, dass sie nur eine Chance besaßen, wenn sie sich über Quaffeltore einen ausreichenden Vorsprung sicherten. Außerdem legte seine Strategie eine Schwäche des Wernigeröder Teams offen – den Treiber auf der linken Seite. Der junge Mann, Sebastian Eisler, sah immer wieder schlecht aus, wenn er, statt einen Klatscher zu schlagen, scheinbar Fliegen verscheuchte. Dadurch kam der Jäger auf dieser Seite immer wieder in Bedrängnis, wenn er zwischen den aggressiven Ball und den Jäger des Gegners geriet. Viele Quaffelverluste waren die logische Folge.
Der Albatros zog eine lange Schleife, ließ seinen Besen um zehn Meter absacken und hing direkt über den Torstangen der eigenen Mannschaft.
Lyra packte Sophus Arm, quetschte ihn und rief: „Ich sehe ihn. Ich sehe den Schnatz.“
„Wo ist er?“
„Hinter dem mittleren Torkreis von Rudolstadt.“
„Aber dann ist Drescher in die völlig falsche Richtung geflogen“, sagte Sophus. „Und Pavlovitsch ist näher dran. Er muss sich nur fallen lassen.“
Kaum hatte Sophus die Worte ausgesprochen, stürzte sich der Sucher der Rudolstädter wie ein Raubvogel von seiner Aussichtsposition in die Tiefe. Flach auf dem Besen liegend reckte er die linke Hand, seine Fanghand, vor.
Ein Stöhnen ging durch den Fanblock, als ein Klatscher ihn seitlich traf und aus der Bahn warf. Der Schnatz schnellte um die Torstange herum, flog in Richtung der Stadionmitte und sauste gleichzeitig in die Tiefe. Pavlovitsch bekam seinen Besen wieder unter Kontrolle, meisterte ein riskantes Wendemanöver und wich seinem Hüter aus, der gerade einen Wurf der Wernigeröder Jäger parierte. Inzwischen näherte sich Franz Drescher, ebenfalls lang auf seinem Fluggerät ausgestreckt, dem Punkt mitten im Spielfeld, den der Schnatz ansteuerte.
Sebastian Eisler verfehlte auf der linken Seite erneut einen Klatscher, den der hinter ihm lauernde Treiber der Rudolstädter dankbar annahm und direkt in Dreschers Flugbahn sandte. Geschickt visierte er dabei einen Punkt vor dem anfliegenden Sucher an, so dass dieser direkt in den Klatscher hineinfliegen würde, behielte er seine Richtung bei.
Drescher erkannte das Manöver wohl aus den Augenwinkeln, denn er zügelte seinen Besen wie ein Reiter ein scheuendes Pferd, stieg steil auf und konnte so beobachten, wie der Klatscher unter seinen Beinen vorbeischoss. Diesen Aufenthalt hatte jedoch der Sucher Pavlovitsch nutzen können, um bei der Jagd nach dem Schnatz aufzuschließen. Beide Sucher näherten sich nun aus etwa gleichem Abstand der Mitte des Stadions, wo der goldene Ball wie ein verängstigtes Küken auf der Stelle flatterte. Unter diesen Umständen musste der kleinere Drescher der Unterlegene sein.
Kurz bevor Pavlovitsch zugriff, riskierte Drescher ein wahrhaft unglaubliches Manöver. Er ließ mit beiden Händen den Stiel los, sprang wie ein Frosch in einem großen Satz auf das vordere Ende des Besens und umklammerte diesen sofort mit den Füßen, ehe sein Körpergewicht ihn über das Ende des Besens werfen konnte. In einer fließenden Bewegung riss er die Hände nach vorn, griff sich den Schnatz, klappte wie ein Taschenmesser zusammen, scheinbar in die Tiefe stürzend. Doch mit einer blitzschnellen Bewegung fasste er im Fallen mit der freien Hand den Besenstiel und reckte den anderen Arm jubelnd in den Himmel.
Dies war der Moment, da die Wernigeröder Fans in ausgelassenen Jubel ausbrachen. Ihr Held hatte das Ruder wieder einmal herumgerissen. Er hatte ihnen sogar den Drescher-Hecht gezeigt, den nach ihm benannten Sprung vom fliegenden Besen nach dem Schnatz.
Der Schlusspfiff ertönte. Die Werwölfe Wernigerode blieben siegreich. Während seine Mannschaftskameraden ihre Besen zur Landung absenkten, ließ Drescher den Schnatz los und zog sich auf sein Fluggerät zurück. Anschließend stieg er erneut weit über dem Stadion auf und drehte eine Ehrenrunde, vom Jubel der Massen begleitet.
„Das war unglaublich“, sagte Sophus.
„Seine Spezialität“, sagte ein älterer Magier zu seiner Rechten. „Führt er zumindest in jedem zweiten Spiel vor. Gibt auch genug Interessenten an ihm.“
Davon hatte Sophus auch gelesen. Wenigstens zwei Mannschaften der Europaliga bekundeten Interesse an dem jungen Star. Unter ihnen der amtierende europäische Meister, die „Galway Leprechauns“.
Plötzlich gellten entsetzte Schreie durch das Stadion. Alle starrten gebannt nach oben, wo eben noch der Albatros seine Runden gedreht hatte. Jetzt wies sein Besen mit der Spitze nach unten, der junge Mann lag mit dem Kopf auf dem Stiel, die Arme baumelten links und rechts herunter. Langsam rutschte er auf dem geneigten Stock immer weiter nach vorn, konnte sich schließlich nicht mehr halten und stürzte seinem Besen voran dem Stadiongrund entgegen.
Mit schreckgeweiteten Augen sahen Mannschaftskameraden und Fans, wie der Star der „Werwölfe Wernigerode“ als lebloses Bündel auf dem Boden aufschlug.
Lyra war bereits aufgesprungen, während sich Franz Drescher auf dem Weg nach unten befand. Sie packte Sophus‘ Hand und zerrte ihn mit sich an konfusen Fans vorbei, die wie Schafe umherstanden und dorthin starrten, wo sich inzwischen alle Spieler, Mannschaftskameraden, wie Gegner um den gewiss schwerverletzten Sucher der Werwölfe scharten. Aus den Augenwinkeln sah Sophus zwei Zauberer in grünen Umhängen von der Seite zur Stadionmitte eilen. Heiler, die bei jedem Quidditchmatch bereitstanden, um in Fällen wie diesem sogleich zur Stelle zu sein.
Während er versuchte, mit Lyra Schritt zu halten, die sich rücksichtslos durch die Reihe drängte und auf der Treppe mit dem immer wieder erneuerten Ruf: „Lassen Sie mich durch!“ abwärts stürmte, fragte sich Sophus, wie ein so begnadeter Flieger wie der Albatros einfach so abstürzen konnte. Wäre er während des Spiels von einem Klatscher vom Besen gefegt worden, hätte dies als Erklärung herhalten können, aber der junge Mann war nach dem Spiel offenbar auf dem Besen zusammengebrochen, der danach führerlos abwärts rauschte.
„Lyra“, rief Sophus in ihrem Schlepptau, „es sind bereits Heiler da unten. Glaubst du wirklich, die warten auf dich?“
„Der Albatros wird sowieso zu uns auf die Heilerstation gebracht. Darauf kannst du wetten. Da kann ich auch gleich die Formalitäten erledigen.“
„Aber das ist nicht dein Spezialgebiet“, wandte Sophus ein.
„Mensch ist Mensch. Der Junge ist gerade aus zehn Metern Höhe auf den Boden geklatscht. Wir können froh sein, wenn etwas übrig ist, was ein Heiler richten kann“, rief Lyra über die Schulter und rannte weiter.
Als sie den Innenraum des Stadions erreichten, bauten sich zwei Ordner vor ihnen auf.
„Ich bin Heilerin“, erklärte Lyra, schwenkte den Zauberstab und ließ ihre Legitimation erscheinen. Einige Augenblicke schwebte ein silberner Äskulapstab in der Luft und zerstob in einem Funkenschauer.
„Und der?“ Der Ordner zeigte auf Sophus.
„Mein Assistent“, log Lyra und drängte bereits an dem breitschultrigen Magier vorbei.
„Wir haben ausgebildete Heiler auf dem Platz“, insistierte der Ordner erneut und versuchte, Lyra festzuhalten. „Wir brauchen keine neugierigen Zaungäste.“
„Sie wissen genau“, fauchte Lyra, „dass sie nur Sportheiler vor Ort haben. Die können vielleicht schnell mal einen Knochen zusammenwachsen lassen, aber was ich da gerade gesehen habe, war etwas völlig anderes.“
„Ach?“ Der Ordner versuchte, so viel Verachtung in die eine Silbe zu legen wie möglich.
„Der Albatros ist da oben ohnmächtig geworden. Ich denke, das gehört nicht zu den normalen Unfällen auf einem Quidditch-Platz. Und jetzt lassen Sie mich endlich los. Meine Kollegen dort“, Lyra gestikulierte zu den Heilern, die neben dem Verunfallten hockten, „werden den Verletzten sicherlich auf unsere Heilerstation bringen. Ich werde einen Transport rufen. Aber ich muss erst wissen, wie schwer die Verletzungen sind.“
Wiederstrebend ließ der Ordner Lyra los und passieren. Vor Sophus baute er sich jedoch sofort wieder auf. „Sie bleiben hier!“, herrschte er ihn an. Lyra wandte sich kurz um, Sophus zuckte mit den Schultern und bedeutete ihr, sich nicht weiter um ihn zu kümmern. Er blieb an der Stadionumfriedung stehen und beobachtete mit den anderen Schaulustigen das Geschehen im Innenraum. Da wurden Zauberstäbe über dem Verletzten geschwenkt, wild gestikulierend diskutiert, eine Trage herbeigeschafft. Einer der Heiler trat zur Seite und sprach aufgeregt in seinen Zauberstab. Lyra beugte sich zu dem jungen Mann am Boden, besah sich nach Sophus‘ Meinung intensiv seinen Kopf und untersuchte diesen anschließend auch mit den Händen und dem Stab. Er sah, dass sie mit dem Finger vorsichtig die Augenlider hob.
Der Heiler, der nicht mit dem Zauberstab in der Hand abseitsstand, offenbar mit einer in der Ferne befindlichen Person diskutierend, untersuchte Arme und Beine des Verletzten.
Schließlich richtete Lyra sich auf. Die drei Heiler traten zusammen, diskutierten wiederholt kurz miteinander, anschließend sprach Lyra in ihren Zauberstab, wohl mit der Heilerstation. Schließlich kehrte sie zu Sophus zurück.
„Kommst du allein nach Wernigerode zurück?“, fragte sie. „Ich bleibe hier und begleite den Verletzten und seinen betreuenden Heiler auf die Heilerstation. Sie schicken drei Flazebs. Ist schließlich ein Heiler vor Ort.“ Sie deutete flüchtig auf sich selbst.
„Ich komme schon klar. Wie geht es ihm?“, reagierte Sophus mit einer Gegenfrage.
„Hat Glück gehabt. Beide Arme sind natürlich mehrfach gebrochen. Die haben den größten Teil des Sturzes abgefangen. Ein oder zwei Rippen werden wohl zumindest geprellt sein. Aber sein Schädel und seine Wirbelsäule sind unverletzt. Das wäre nicht so leicht zu kitten. Aber es macht mir Sorgen, dass er immer noch bewusstlos ist. Wenn ich den Kopf nicht intensiv untersucht hätte, würde ich eine Schädelverletzung vermuten nach so einem Absturz. Aber da ist nichts. Außerdem war er natürlich auch schon weggetreten, bevor er vom Besen gekippt ist.“
„Weißt du, ich versuche auf der Heilerstation zu apparieren“, sagte Sophus. „Das ist nicht so weit wie ganz über den Brocken. Außerdem bin ich so oft da oben mit dem Besen gelandet, ich kenne den Apparierplatz wirklich wie meine Westentasche.“
„Komm auf die Vierte – nichtmagische Verletzungen“, sagte Lyra.
„Cleos Reich“, erwiderte Sophus lachend. „Die wird richtig enttäuscht sein, dass ich diesmal auf meinen zwei Beinen gesund zu ihr auf die Station komme.“
„Sie hat schon nach dir gefragt“, sagte Lyra. „Ob du Schäden davongetragen hast, nachdem du zwei Mal den Boden des Harzes im Sturzflug eingenommen hast. Ich konnte ihr berichten, dass alle Körperteile so funktionieren, wie sie sollen.“
Sophus spürte, wie ihm die Röte ins Gesicht schoss und Lyra lachte. „Seit wann bist du so prüde?“, fragte sie.
„Seit ich mit einer Heilerin liiert bin“, antwortete Sophus.
Die drei angekündigten Flamingozebras, in rot-weiß gestreifte Umhänge gekleidete Helfer von der Heilerstation, apparierten gerade mitten im Stadion. In ihrem Gepäck führten sie eine spezielle Trage mit, um den Verletzten während des Rückweges stabil und sicher durch die magischen Sphären transportieren zu können.
„Ich appariere mit den Flazebs“, sagte Lyra, drückte Sophus einen Schmatz auf die Wange und kehrte zu dem Verletzten zurück.
Sophus konzentrierte sich. Er dachte intensiv an den klotzigen, grauen Bau der Heilerstation, an die grünen Vorhänge vor den Fenstern und die in der gleichen Farbe gestrichenen Korridore, an die mit einem großen roten Kreuz gekennzeichnete Fläche auf dem Dach, die als Besenlande- und Apparierplatz ausgewiesen war. Dorthin sollte ihn der Zauber bringen, dort wollte er wieder erscheinen, nachdem er aus dem Stadion verschwunden war. Als seine Gedanken sich an diesem Punkt trafen, schwenkte er den Zauberstab und disapparierte.
Wie Sophus eine wütende Lyra erlebt
Statt auf dem roten Kreuz des Apparierplatzes erschien er an der Dachkante neben dem Eingang zu den unteren Räumen der Heilerstation. Ein Schritt weiter vorn und er wäre mitten im Besenregal wieder aufgetaucht. Jetzt wusste er wieder, warum er das Apparieren über größere Strecken mied. Falls Lyra ihn auf dem Heimweg nicht begleiten konnte, musste er sich in mehreren kurzen Sprüngen an ihre gemeinsame Wohnung herantasten. Vielleicht konnte er sich auch einen Besen leihen, überlegte er, ehe er in die Tiefen der Heilerstation hinabstieg.
Auf der Treppe lief er Elf über den Weg, einer jungen Heilerin, die sich ihren Spitznamen mit ihrer meist ungewöhnlichen Kleidungsauswahl verdient hatte. Heute trug sie eine Rüschenbluse in grellem Gelb über einem grasgrünen Rock, unter dem ihre Beine in roten Leggings hervorragten. Elf hatte Sophus im Januar in die magisch-technischen Geheimnisse des Labors der Heilerstation eingewiesen, nachdem dieser seine Stelle dort frisch angetreten hatte. Sie arbeitete gemeinsam mit dem Heiler Paul Renner in der fünften Etage auf der Station für Verletzungen durch Tierwesen unter der Leitung Gregorius Katenbauers. Da es in Deutschland nur noch wenige magische Tierwesen gab, Verletzungen durch diese naturgemäß also außerordentlich selten waren, wurden die Mitarbeiter dieser Abteilung immer wieder herangezogen, wenn anderswo an der Heilerstation ein helfender Zauberstab benötigt wurde.
Katenbauer, Elfs Chef, galt als Genie und Hans Dampf in allen Gassen der Heilkunst. Er hatte seine Abschlussarbeit nach dem Studium auf dem Gebiet der Geisteszauber geschrieben, sich anschließend aber der Erforschung von magischen Tierwesen verschrieben. Während einer Expedition waren er und seine Begleiter von einem Rudel Werwölfe überfallen und verletzt worden. Katenbauer konnte verhindern, selbst zum Werwolf zu werden, indem er seine beiden Unterschenkel verholzen ließ. Seit jenem Zwischenfall stakte er mit grimmiger Miene und einem Schritt wie ein Pirat auf den wurmzerfressenen Planken eines Schoners durch die Gänge der Heilerstation und verschoss die Giftpfeile seiner Worte. Zeitweise übernahm er auch die Leitung der Tränkeabteilung, gab diese jedoch an eine junge Heilerin ab, als die ihre Ausbildung bei ihm abgeschlossen hatte. Jetzt leitete er wieder die Abteilung für Verletzungen durch Tierwesen und mischte sich als solcher in jeden Fall ein, der ihm interessant genug erschien.
Aus diesem Grunde war Sophus auch nicht allzu verwundert, als er Katenbauer auf dem Gang der vierten Etage entlangstaken sah. Er musste aus einem der Krankenzimmer gekommen sein, sagte sich Sophus.
In diesem Moment sprang eine Tür ziemlich am Ende des Ganges auf der linken Seite auf und ein grauhaariger Kopf erschien. „Kommen Sie zurück, Katenbauer“, rief der Mann dem Heiler nach, aber dieser wandte sich weder um, noch verhielt er den Schritt. Der Kopf verschwand mit einem unwilligen Grunzgeräusch.
„Ah, Besenbinder“, sagte er, als er Sophus bemerkte. „Wollen Sie sich auch den Quidditch-Star ansehen, der uns zugeflogen ist?“
„Ich war dabei, als es passierte“, sagte Sophus. „Ich will nur Lyra abholen.“
Katenbauer blieb vor Sophus stehen. „Erzählen Sie mir, was Sie gesehen haben.“
Sophus gehorchte, aber er musste eingestehen, dass er nicht wirklich etwas Besonderes bemerkt hatte. Der junge Mann war einfach plötzlich auf seinem Besen nach vorn gesackt und anschließend abgestürzt.
„Genau das hat ihre Geliebte auch berichtet“, sagte Katenbauer. „Und Willemsen, dieser Idiot, sucht nach einer Schädelverletzung. Lässt keine Zungenprobe zu, weil ich ja den wertvollen Kopf des Patienten berühren müsste. Dabei handelt es sich um einen Profisportler. Wann hätte man je gehört, dass die ihren Kopf benützen.“
„So ein Sucher muss durchaus kluge Entscheidungen treffen“, wandte Sophus ein. Katenbauer winkte ab.
„Wir benötigen eine Zungenprobe. Das ist so sicher eine Vergiftung, wie ich zwei Holzbeine habe.“
„Kein Werwolfbiss diesmal?“, spöttelte Sophus, denn dies galt an der Heilerstation als Katenbauers sichere erste Diagnose in jedem Fall.
„Zwanzig Meter über dem Boden? Haben Sie fliegende Werwölfe im Stadion bemerkt?“, fragte Katenbauer spöttisch.
„Sechs Stück“, erwiderte Sophus.
Katenbauer riss die Augen auf. „Was soll das heißen?“
„Dass da die ‚Werwölfe Wernigerode‘ gespielt haben“, sagte Sophus und lachte.
Für einen Augenblick sah Katenbauer aus, als wolle er Sophus einen Fluch auf den Pelz brennen, plötzlich jedoch grinste er. „Sie lernen, Besenbinder, Sie lernen“, sagte er. „Aber bis Sie mit mir mithalten können, wird hoffentlich noch ein wenig Zeit verstreichen. Bis es so weit ist, besorgen Sie mir eine Zungenprobe von diesem Patienten. Wenn es sein muss, schleichen Sie sich heimlich in das Krankenzimmer, wenn Willemsen und seine Bande von Dilettanten gegangen sind.“
„Ich bin kein Heiler“, sagte Sophus. „Ich darf keine Zungenprobe nehmen.“
„Fragen Sie einfach Ihre Geliebte, ob die Ihnen hilft. Die ist ja auch der Meinung, der junge Mann wäre nicht so mir nichts, dir nichts vom Besen gekippt.“ Nach diesen Worten fuhr Katenbauer in einer exakten Kehrtwende herum und stakte davon.
Sophus ging den Gang entlang und betrat das Krankenzimmer, aus dem der grauhaarige Heiler geblickt und nach Katenbauer gerufen hatte. Der Mann stand neben Lyra am Bett des Kranken und diskutierte mit dieser in gedämpftem Ton.
„… schauen wir uns den Schädel an“, hörte Sophus den Mann sagen, als er näher gekommen war. Der Heiler blickte von Lyra zu Sophus und fragte: „Und wer sind Sie? Fans können wir jetzt nicht gebrauchen. Sie dürfen Ihr Idol wieder besuchen, wenn es zusammengeflickt ist.“
Sophus erklärte, er wäre Mitarbeiter der Heilerstation und wolle zu Heilerin Bascomb. Er bräuchte eine Zungenprobe zur Analyse.
„Hat Katenbauer Sie geschickt?“ Das graue Haar wogte um den Kopf, als der Heiler diesen vehement schüttelte. „Bevor ich nicht da reingeschaut habe“, er zeigte auf den Schädel des Patienten, „rührt mir keiner das gute Stück an. Dieser Mann liegt auf meiner Station. Das bedeutet, ich bin für sein Wohl verantwortlich. Deshalb werde ich auch entscheiden, was ich für dieses als wichtig erachte. Und darum schaue ich mir jetzt an, wie schlimm es wirklich ist. Sie können hier warten, aber rühren Sie den Patienten nicht an.“ Er wandte sich um, deutete mit dem Finger auf Lyra. „Sie auch nicht, Frau Kollegin.“ Eilig verließ er das Zimmer.
Lyra lächelte, zuckte mit den Schultern und sagte: „Ich konnte gerade noch verhindern, dass es zu einem Duell kommt. Katenbauer wollte mal wieder den Peasantius-Zauber anwenden, um den Patienten auf Zaubersprüche zu untersuchen. Willemsen hat ihm im letzten Augenblick den Zauberstab nach oben reißen können. Als Katenbauer anschließend eine Zungenprobe verlangt hat, musste ich mich zwischen die beiden stellen, sonst längen jetzt hier drei Patienten.“
„Katenbauer meinte, du wärst auch überzeugt, es läge nicht nur eine Kopfverletzung vor“, sagte Sophus.
„Naja, ganz ausschließen kann man es nicht, so wie Franz Drescher Bruch gemacht hat, aber er war bereits ohnmächtig, als der Sturz begann, davon bin ich überzeugt.“
In diesem Moment öffnete sich die Tür, der Heiler kam zurück und schwenkte einen Gegenstand in seiner Hand, der für Sophus nach einem alten Bettlaken aussah. In Willemsens Gefolge betraten zwei Helfer in rosa-weiß gestreiften Umhängen den Raum.
„Gehen Sie mal zur Seite.“ Willemsen wedelte Lyra und Sophus vom Bett des Patienten weg.
Die Flazebs entfalteten das Laken, nahmen jeweils zwei Ecken in ihre Hände und stellten sich mit dem Tuch in der Hand links und rechts so auf, dass der Patient unter dem weißen Stoff verschwand. Heiler Willemsen schaute darunter, rückte, soweit Sophus es erkennen konnte, vorsichtig Arme und Beine des Patienten zurecht und richtete sich wieder auf.
„Straff halten!“, kommandierte er. Anschließend bewegte er seinen Zauberstab zügig über dem Laken vom Kopf- zum Fußende unentwegt Zaubersprüche murmelnd, die Sophus nicht verstand. Als er am Fußende angekommen war, wandte er sich um, schwenkte den Zauberstab in einer ausladenden Geste, die an einen Dirigenten erinnerte, und intonierte laut und deutlich: „Lumiscare interio!“
Das Laken leuchtete auf und ein Bild wurde darauf sichtbar. Sophus staunte. Das Innenleben des Patienten zeichnete sich vollständig auf dem weißen Tuch ab. Schwach konnte er die Konturen innerer Organe erkennen, die zwischen den deutlichen Linien, die von den Knochen gebildet wurden, eingebettet lagen.
„Schön ruhig halten“, wies Willemsen die Helfer an, während er mit der Nase beinahe das Tuch berührend das Bild studierte.
Sophus konnte erkennen, wie das Herz des Patienten in gleichmäßigem Takt pulsierte und so den Blutstrom aufrechterhielt. Er sah die Lunge sich dehnen und wieder zusammenziehen, wenn ein Atemstoß Luft einsog und wieder ausstieß. Wie ein äußerst komplexes Uhrwerk arbeiteten alle Teile dieses Menschen zusammen, um das Wunder zu vollbringen, das sich Leben nannte.
Am Kopfende des Patienten hielt Willemsen sich besonders lang auf. Er sah sich den Schädel aus allen denkbaren Winkeln an, sprang urplötzlich einen Schritt zurück und näherte sich dann erneut, als befände er sich auf der Pirsch nach einem seltenen und scheuen magischen Wesen, einem Neuseeländischen Zwergdrachenuhu, zum Beispiel. Schließlich richtete er sich auf und erklärte: „Mehrfache komplizierte Brüche an beiden Armen. Der linke Oberschenkel ist angerissen. Die zweite und dritte Rippe sind geprellt, die Lunge gestaucht, aber intakt. Der Schädel weist keine Verletzungen auf. Der Herzschlag ist leicht verlangsamt und ein wenig aus dem Takt. Jetzt kann ich es verantworten, dass eine Zungenprobe entnommen wird.“ Er wandte sich an die Flazebs. „Bringen Sie das Bild zu Meinradt, er soll es fixieren und zur Akte Drescher ablegen. Außerdem brauche ich Skele-Gro, zwei Einheiten, dazu den Instomator, Basilius-Salbe, eine Einheit und den Schokoladentropf, in zehn Minuten ist das alles hier. Husch, husch.“
Die Flazebs legten das Laken zusammen und verließen eilig den Raum. Willemsen trat zum Kopf des Patienten und drückte den Unterkiefer auf. „Frau Kollegin“, wandte er sich an Lyra. „Ihr Einsatz.“
Lyra zog eine Phiole aus dem Umhang, schwenkte den Zauberstab über dem Kopf des Patienten und füllte die sich von der Zunge lösenden roten und grünen Fäden in das Gefäß. Ihr Blick wurde zunehmend unwilliger, je mehr sich von der Substanz in dem Glasröhrchen sammelte.
Mit verkniffenem Gesicht drückte sie Sophus schließlich die Probe in die Hand. „Das hätte ich niemals geglaubt“, sagte sie.
„Du weißt bereits, was das ist?“, fragte Sophus.
„Nicht hundertprozentig, aber ich habe eine böse Ahnung.“ Sie schüttelte den Kopf. „Wenn es stimmt, dürfte die Karriere dieses Stars“, sie sprach das Wort aus, als wolle sie stattdessen lieber eine Beleidigung verwenden, „beendet sein.“
Sophus schaute nur ratlos drein.
„Hast du das Wort ‚Doping‘ schon einmal gehört?“, fragte Lyra.
Sophus nickte. „Mug… nichtmagisch begabte Sportler verwenden Mittel, um schneller oder stärker oder auf andere Art besser als ihre Konkurrenten zu sein. Sie betrügen ihre Gegner.“ Man las und hörte immer wieder davon. Offenbar gehörte es zum Sport der nichtmagisch Begabten dazu.
„Wenn mich nicht alles täuscht, hat unser Sucher Dux Aquilaura genommen.“
„Nein“, Sophus schüttelte energisch den Kopf, „das glaube ich einfach nicht. Das will ich nicht glauben. Der Junge ist ein perfekter Flieger, warum sollte er so etwas Verrücktes tun?“
„Aus dem gleichen Grund, aus dem auch andere betrügen, um schneller und leichter das zu erreichen, wofür andere Zeit, Schweiß und Ehrgeiz aufwenden. Er ist gewiss begabt, aber er wird sich gedacht haben: Was ist dabei, wenn ich ein wenig nachhelfe, um noch besser zu sein?“
Sophus konnte gar nicht mehr aufhören den Kopf hin und her zu drehen, so sehr wehrte sich jede Zelle seines Gehirns dagegen, die Informationen aufzunehmen, die Lyra ihm mitteilte.
„Ich werde das mit Stephanie Simon gemeinsam analysieren. Es muss etwas anderes sein“, sagte er, betrachtete die Probe erneut und steckte sie schließlich in seinen Umhang.
„Ich würde mich freuen, wenn ich mich irrte“, sagte Lyra.
Zwei Stunden später hämmerte Sophus mit der rechten Faust auf den Labortisch neben dem Drachenherz-Chromatographen und wiederholte: „Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Der Apparat muss kaputt sein.“
„Sophus“, sagte die Leiterin des Labors, die an seiner Seite stand, sanft. „Lyra hat es vermutet, ich habe es dir gesagt und jetzt bestätigt es die Analyse. Du wirst es also glauben müssen.“
Seit Stephanie Simon wieder das Labor leitete, duzten sie und Sophus einander. Die junge Heilerin meinte, dies wäre das Mindeste, was sie ihm schulde.
Sie fuhr mit ihrer Rede fort: „Da gibt es nicht zu deuteln. Der gefeierte Sucher der ‚Werwölfe Wernigerode‘ war zum heutigen Spiel voller Dux Aquilaura. Die Heilerstation muss das melden, auch wenn sein Flug mit einer totalen Bruchlandung endete. Allerdings erklärt dieser Trank nicht den Absturz, eher im Gegenteil. Der junge Mann sollte wie mit Adlerschwingen fliegen und wie mit Adleraugen sehen, keinesfalls sollte er wie ein Stein vom Himmel fallen.“
„Wieder mal irgendwelche Wechselwirkungen?“, fragte Sophus. „Ist schließlich die häufigste Ursache, wenn Zaubertränke im Spiel sind.“
„Oder Überdosierung“, bestätigte Stephanie nickend. „Ich werde das Untersuchungsergebnis an den behandelnden Heiler weitergeben. Wer ist es?"
„Willemsen“, sagte Sophus.
„Der alte Knochenflicker kann mit Zaubertränken so viel anfangen wie ein Hippogreif mit Flossen. Wie ich hörte, hat sich Katenbauer schon eingemischt.“
„War er hier?“
„Hat geschimpft wie ein Kobold, dem das Gold abhandengekommen ist.