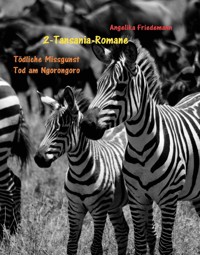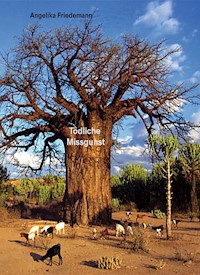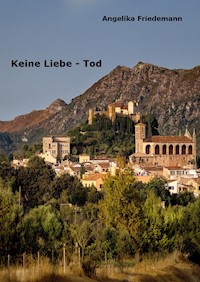3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kenya
- Sprache: Deutsch
Es ist der erfundene Lebensablauf von drei Generationen weißer Siedler in Kenia, vermischt mit wahren geschichtlichen Begebenheiten. William Shrimes kam 1939 in die Britische Kronkolonie und hat in schwieriger Kleinarbeit eine Farm aufgebaut. Sein Sohn James baute in den 70er und 80er Jahren ein Safariunternehmen auf. Sein Ziel, Touristen die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt zu zeigen, ihnen zu vermitteln, dass man diese Wildnis erhalten sollte. Williams Enkel Erik arbeitet für den Kenya Wildlife Service. In diesem Umfeld gerät die Ärztin Ariane Niebert, die mit hochgesteckten Plänen, bepackt mit einem Kopf voller Träume für ein Jahr in das Land kommt, um zu helfen. Bereits nach kurzer Zeit steht sie vor einem Scherbenhaufen, da sie infolge von Ignoranz, Arroganz, gepaart mit Unwissenheit Fehler begeht. Erst als alle Illusionen zerplatzt sind, bekommt sie eine neue Chance durch Erik Shrimes, nicht ahnend, was er damit bezweckt. Ariane wird in ein, durch perfide Intrigen, Netzwerk von Medikamentenschwindel und Wilderei hineingezogen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1006
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
3 Diskriminierung der Farbe
TitelseiteImpressumJambo usilolijua ni kama usiku wa giza.
Ignoranz ist wie dunkles Licht.
Wenn der letzte Elefant stirbt,
wird die Erde verdorren!
*
Einsam stand er vor dem Grab, schaute auf das Blumenmeer und ließ seiner Trauer freien Lauf.
„Ich hatte 49 wunderschöne Jahre mit dir, malaika, und ich habe keine Sekunde bereut, dass du meine Frau warst. Wenn du mich allein gelassen hast, in meinem Herzen wirst du immer tief verankert sein. Ninakutamani. Njiwa peleka salamu kwa yule wangu muhibu. Umueleze afahamu kwamba napata taabu. Taabani mahamumu Maradhi yamenisibu. Usiku kucha nakesha. Na yeye ndiye sa Dad, Iwapo haji maisha. Hanifika aibu. Pendo langu halijesha. Ndilio liloniadhibu. Njiwa usiajizike. Nenda ulete majibu. Nenda upesi ufike. Mkimbilie sahibu. Mbele yake utamke. Ni yeye wa kunitibu. Ukifika tafadhali. Sema naye taratibu. Ukisema kwa ukali. Mambo utayaharibu. Kamwambie sina hali kufariki si ajabu. Ninakupenda sana malaika yangu“, flüsterte er, und für einen Moment sah er sie vor sich, hörte ihre leise, sanfte Stimme. „Ninakupenda sana, mpenzi.“
Erst eine halbe Stunde später schlenderte er langsam zu seinem Haus zurück, durchquerte den Garten, den sie in all den Jahren so hingebungsvoll angelegt, vergrößert hatte. Heute hatte er keinen Blick für die blühenden Büsche und Blumen. Aus dem Ahornbaum klang aufgeregtes Kreischen von den ndege wadogo, den Kikuyubrillenvögeln. Das hörte er heute nicht, obwohl er sonst, über deren lautes Krakeelen meckerte.
Er bog um die Veranda, betrachtete seine Familie: seinen Sohn, die Schwiegertochter, seine beiden Enkelkinder, die Freunde. Nur seine Schwägerin Charlotte fehlte. Sie war vorhin weinend weggerannt.
Erik, sein jüngster Enkelsohn erhob sich. „Geht es Babu?“, erkundigte er sich liebevoll.
„Ist gut. Ich gehe hoch und möchte allein sein. Zum Essen sagt ihr mir bitte Bescheid.“
William Shrimes betrat das Haus, holte eine Flasche Tusker, stieg mühsam die Treppe empor. Heute fiel ihm jeder Schritt schwer, obwohl er noch sehr rüstig für seine knapp 79 Jahre war. Der Tod seiner geliebten Frau war zu unerwartet eingetroffen, diesen Schicksalsschlag musste er verkraften. Er schloss die Tür zum Schlafzimmer hinter sich und roch sofort den Veilchenduft von ihr. Es sah aus, als wenn sie leben und gleich hereinkommen würde. Er hatte vorgestern, nach ihrem plötzlichen Einschlafen verboten, dass jemand den Raum betrat. Es sollte nichts verändert werden. Er setzte sich an ihren Schminktisch, wie sie diesen Platz genannt hatte. Er hatte gelacht, „du schminkst dich nie.“ „Ich könnte. Siehst du, ein Spiegel, eine Stelle für all den Kram wäre da.“ „Malaika, du bist süß. Du benötigst keine Schminke, weil du ohne wunderschön bist.“ Er schaute die Haarbürste, den Kamm an, ergriff einige Haarspangen. Diese Goldene hatte er ihr vor vielen Jahren in Malindi gekauft. Die aus Holz hatte ihr James zum 36. Geburtstag geschenkt. Er hatte sie damals allein geschnitzt. Diese war aus Mombasa. Sie hatten auf dem Markt eingekauft und die Spange hatte es ihr sofort angetan. Er öffnete das Parfümflakon, schnupperte daran. Veilchenduft, den er so sehr liebte. Daneben Fläschchen Nagellack. Sie hatte sich häufig die Fußnägel lackiert und er fand das wahnsinnig erotisch, selbst nach fast fünfzig Jahren Ehe. Er zog die breite Schublade auf. Ihr Kruschfach hatte sie es bezeichnet. Darin lagen ordentlich geschichtet Briefe, Füller, Geburtstagskarten der Kinder, Fotos. An der einen Seite eine Mappe mit ihrem Briefpapier. Schmuck, den sie von den Kikuyufrauen bekommen, Schmuck, den sie in Nairobi oder Mombasa gekauft hatte. Er hob die kleine dunkelrote Schmuckschatulle aus Leder heraus und schaute hinein. Die Perlenkette hatte er ihr zum 60. Geburtstag geschenkt, das breite goldene Armband hatte sie zum 10. Hochzeitstag erhalten. Er konnte jedes Schmuckstück einem bestimmten Datum zuordnen. Er wusste sie alle noch. Er schloss den Deckel, stellte es hinein, entnahm einige Aufnahmen.
William trank hastig, weil er die Tränen spürte. Er legte die Bilder zurück, schob die Schublade zu. Das konnte er sich heute nicht ansehen. Alles erinnerte ihn an sie.
Richard Okawana fuhr mit dem Jeep vor, stieg die Treppe hoch.
„Ndemi und ich fahren morgen früh weg. Wie lange weiß ich nicht. Wenn du aus Nyeri retour bist, sollen sie bitte die Rohre verlegen und jemand soll sich um meinen Garten kümmern, damit er nicht verwildert. Es soll so bleiben, wie es Eve …“, er brach ab, räusperte sich. „Geld liegt drinnen. Wenn du mehr benötigst, gehe bitte zu Lokop oder Charlotte. Nimm dir einen der Jungs mit, da können sie beim Aufladen helfen. Asante! Ich brauche einen Brandy“, brummte William.
„Babu, erst essen, danach Brandy.“
„Schreib du Grünschnabel mir nicht vor, wann ich etwas trinke“, knurrte er gereizt und alle lachten, selbst er musste schmunzeln.
„Wo willst du hin, Dad?“
„Weg. Es ist zu plötzlich passiert und … Wir wollten in einigen Wochen nach Majimoto zu den heißen Quellen fahren. Anschließend wollten wir uns den Grabenbruch genauer ansehen, das Gebiet des Rift Valley. Es hat ihr so sehr gefallen, als wir es mit dem Ballon überquert haben. Wir wollten …“ Er brach ab und kippte den Brandy hinter und James trank ebenfalls. Für ihn war das ein schwerer Schicksalsschlag. Sie war nie ernsthaft krank gewesen und nun der völlig überraschende Tod seiner über alles geliebten Mutter. Alle benötigten Zeit, das zu verarbeiten. Es war zu irreal.
„Wann seid ihr dort mit Ballon gefahren? Dad, das hast du nie erzählt?“
„Muss Karanja heimlich veranstaltet haben. Ist doch völlig unwichtig, so ein Mist!“
„Falsch! Eve und ich sind nur einmal mit Karanja und deinem Ballon geflogen, auf deine Einladung hin. Du hast es verboten. Es gibt andere Unternehmen, die so etwas anbieten. Wir haben da einen guten, sehr zuverlässigen Fahrer gefunden und waren öfter mit ihnen unterwegs. Eve hat es große Freude bereitet. Eve hat … Ich bin bei meinem Freund. Esst ohne mich. Kwa heri!“
„William, ich nehme Eves Schmuckschatulle mit, da der nun mir gehört. Wir wollen morgen Abend feiern gehen und da kann ich einiges davon tragen.“
William erstarrte für Sekunden zur Salzsäule, trat einen Schritt auf seine Schwiegertochter zu. „Wage es, dich an meinem Eigentum zu vergreifen und du siehst nie wieder die Sonne, du abscheuliches Weib. Dir gehören ein Berg Schulden, sonst nichts. Du bekommst nie ein Stück von meiner Frau. Nie!“
„Babu, sie ist tot und wir sind Nyanya Erben.“
„Ihr spinnt alle beide. Nie bekommt ihr von meiner Mamaye ein Stück“, meckerte James leise. Der Tonfall zeigte jedoch, jedes weitere Wort bedeutete, seine Wut spüren zu bekommen. „Habgierige Bande! Geh mit dieser Niete feiern, nur kann er das nicht bezahlen. Ich werde euch ...“
„Seit wann bist du mit meiner Frau verwandt, du infantiler, nichts könnender, einfältiger Bengel?“, redete William schnell dazwischen, warf seinem Sohn einen liebevollen Blick zu. „Packt eure Sachen und verschwindet alle drei von meiner shamba, und zwar sofort. Ihr seid ein habgieriges Pack.“ William holte tief Luft. „Richard, warte bitte kurz. Ich muss die Räume abschließen, sonst werde ich bestohlen. Wie die Aasgeier!“, schon verschwand er im Haus.
„Ihr seid widerlich. Kaum wurde sie beerdigt, da haltet ihr die Hand auf?“, Richard nun. „Vergessen, dass sie nicht mit euch verwandt war?“
„Richard, so kennt man sie seit Jahren. Es wurde sogar der eigene Sohn versucht zu ermorden, anknüpfend auf die Straße gejagt, nur weil man Geld einsparen wollte. Sie können den Hals nicht voll genug bekommen, weil sie selber nichts auf die Beine gestellt bringen“, wandte sich Scott McGimes ab. „Fahren wir. Gut, dass das mein Babu nicht mehr miterlebt hat. Er würde diese Verbrecher eigenhändig zur Polisi schleppen.“
„Abscheuliche Bagage“, fügte Morgan Sommerthen an, spuckte vor Erik aus.
Die Familien Wilder, Timpson, Raiders, Snasher, Masters, Sommerthen und Hendsen wandten sich ab, ohne sich zu verabschieden, umarmten stumm William.
Erik kochte vor Wut, als er die Tränen von seiner Stiefmutter erblickte. Sein Babu war senil, warf das Geld anderen in den Rachen, anstatt mit dem Ballon von ihrer Lodge zu fliegen, wenn es nun schon sein musste. Die hatten die alten Leute bestimmt so richtig ausgenommen. Wenn der so weiter machte, war bald sein gesamtes Erbe verschleudert.
„Haut endlich ab“, blaffte James seinen Sohn und seine Frau an. „Nimm sie mit nach Nyeri, da ich sie nicht sehen will.“
*
Hupend raste der große, staubige Jeep dem hospitali zu. Der Mann am Lenkrad fluchte laut, wenn er nicht schnell genug vorankam. Er sah bereits das Gebäude, warf einen kurzen Blick nach hinten, bevor er abermals hupend den Krankenhauskomplex ansteuerte. Er bog ab, erblickte die Menschen, die langsam zu dem Eingang schlenderten, und erneut erklang die Hupe. Wild gestikulierte er mit der linken Hand.
„Heia, heia“, brüllte er aus dem Fenster, während er den Wagen geschickt an einer Gruppe Frangipani vorbei lenkte. Nochmals hupte er mehrmals.
„Warum können die nicht auf dem Fußweg laufen?“, fluchte er. „Blöde Wogs!“
Kaum stand das Auto, da sprang er heraus und rannte dem Portal entgegen, schubste zwei Frauen leicht beiseite. Eine ältere Frau eilte auf ihn zu.
„Dokitari yupo wapi? Je, Dokitari McGimes yupo hapa. Upesi“, sprach er die Frau an.
„Hajupa! Waganga hawapo.“
„Wo sind sie? Ich habe einen Verletzten und benötige sofort eine Bahre. Upesi.“
Schon öffnete er eine Tür und zog selbst eine Bahre heraus, während die Frau davoneilte. Er öffnete hinten der Wagenklappe und hob vorsichtig den jungen, leblosen Mann heraus, legte ihn nieder, als er zwei Schwestern herbeieilen sah.
„Jambo, Meeka, wo ist Ian?“, sprach er eine der Frauen an. „Tom hat es erwischt.“
Die Frau blickte auf den Mann, der bewusstlos war. Das Hosenbein mit Blut getränkt, oberhalb ein breiter Verband.
„Wangari holt ihn. Beeilen wir uns. Ist er der Einzige?“
„Ndiyo. Dafür haben wir drei, denen man nicht mehr helfen kann.“
„Gute oder schlechte?“
„Abschaum!“
Sie drängten sich durch den Flur, wo überall Menschen wartend standen oder eiligst vorbei hasteten. Es war ein Geschnatter und Gelächter zu hören, das nahm Erik nicht wahr. Er war gedanklich bei dem jungen Kollegen, den sie zum Operationssaal schoben.
„Heute ist es besonders schlimm“, stellte die Krankenschwester fest. „Der Dokitari operiert seit fünf.“
„Kann er gleich weiter operieren“, brummte Erik, während er zu Tom blickte. „Muss jemand …“
Ein Mann hastete auf sie zu.
„Ian, er hat eine Schussverletzung am linken Bein. 405er. Ich habe das Übliche absolviert. Er hat sehr viel Blut verloren und ist seit ungefähr einer halben Stunde bewusstlos.“
„Wo kommst du her?“
„Vom Olorgasailie.“
Sie betraten einen Raum und der Doktor zog Handschuhe an. Erik entfernte bereits geschickt die restlichen Fetzen der Hose.
„Er muss operiert werden und wir haben voll“, erklärte er, während er den Mann untersuchte. Er wandte sich an die Schwester und gab schnell Anweisungen, während er nach einer Spritze griff, die ihm eine andere Frau reichte.
„Hat es noch einen von euch erwischt?“
„Hapana, nur Tom.“
„Nur? Fahren wir ihn in die Drei. Dort können sie ihn vorbereiten.“
„Muss ich helfen?“
„Ist Keith nicht dabei?“
„Hapana, der dope, könnte dir nun wirklich nicht helfen. Unwichtig“, lenkte er rasch ab, als er das böse Funkeln in den Augen des Dokitari erblickte.
„Sei vorsichtig, wie du über meinen Freund redest. Bleib in der Nähe. Diese neue Daktari ist vor zwei Tagen gekommen, vielleicht ist sie erreichbar. Heute geht es wieder einmal drunter und drüber.“
Erik holte ein Glas und schüttet etwas Wasser hinein und trank durstig. Er wusch Hände und Gesicht.
„Wir hatten sie, da rastet einer von den Gangstern aus und es trifft Tom.“
„Ist ja nichts Neues. Kleines Kaliber wäre mir lieber gewesen. Hoffen wir, dass keine Muskeln oder Knochen zu stark verletzt wurden. Wenn das der Fall ist, musst du Ndogo holen. Das Telefon funktioniert dort nicht.“
„Kein Problem oder ich rufe meinen Busenfreund an. Der Gangster hat da seine Pfoten drinstecken.“
„Den kriegt ihr, falls er etwas damit zu tun hatte.“
„Er hat, ich weiß es.“
Sie schoben den Verletzten hinaus und wenig später verschwand der Patient hinter der Tür des Operationssaals.
Doktor Ian McGimes stand im Flur und sprach mit Erik, als er die Frau kommen sah.
Erik, in khakifarbenen Sachen gekleidet, Hemd, Hosen, hohe, weiche, beige Wildlederstiefel, war einen Kopf größer als der Doktor. Dunkle Haare berührten hinten weit den Hemdkragen. Er war schlank, muskulös, wie sie an den Armen sah, und er erregt sofort ihre Aufmerksamkeit. Das jedoch nahm er nicht wahr, da er sich zu sehr um seinen Mitarbeiter sorgte.
Ian wandte sich der Frau zu. „Gut, dass Sie da sind. Ich benötige Ihre Hilfe. Es hat einen Unfall gegeben und wir müssen einen Mann operieren. Ich komme sofort. Sie können sich fertigmachen und uns assistieren. Nichts Kompliziertes, nur kleine Hilfestellungen. Wir hofften, dass Sie nicht einspringen müssen.“
Ariane Niebert nickte nur, versuchte, einen Blick von diesem gut aussehenden Mann zu erhaschen. Vergebens! So betrat sie wenig später das erste Mal einen afrikanischen Operationssaal.
„Hübsch! Eine Blondine hatte ich lange nicht. Eine neue Schwester?“
„Hapana, das ist diese deutsche Daktari, ich muss. Es dauert ungefähr eine Stunde. Du kannst ruhig Kaffee trinken gehen.“
„Ich will den Jungen gesund und heil wiedersehen, also gib dir Mühe und asante, Ian.“
Ian McGimes verschwand hinter der Tür, wusch sehr gründlich die Hände und er hoffte, dass es gut ausgehen würde. Er warf einen Blick zu der Frau, die irgendwie ratlos herumstand. Die Tür öffnete sich und ein junger Mann trat herein und schnell bereitete er sich vor, während Ian erzählte, was geschehen war.
Dann begann die Operation. Der Anästhesist überprüft die Apparatur. Ian operierte schnell und mühelos, jeder Handgriff sehr präzise. Dabei gab er nur wenig Anweisung und schließlich holte er die Kugel heraus. Als ihm Ariane nicht die Schale reichte, schaute er wütend kurz auf, da griff sein Kollege zu. Nochmals sagte er etwas und sie reichte ihm schnell das Geforderte.
„Damned, Sie müssen besser aufpassen! Es zählt jede Sekunde“, wies er sie grob zurecht. „Meeka, komm her und helfe der Daktari. So funktioniert das nicht. Sie hat keine Ahnung, ist völlig überfordert.“
Eine Schwester eilte herbei, stellte sich neben sie und nun verlief alles Weitere reibungslos.
Sie standen nebeneinander an dem Waschbecken und Ian musterte die Frau im Spiegel. Völlig nutzlos dachte er.
„Gehen wir einen Kaffee trinken“, forderte er sie schroff auf. Er gab dem Kollegen einige Instruktionen und schob sie aus dem Raum.
Ian holte zwei Kaffee und setzte sich zu der Frau und sie tranken schweigend.
Ariane musterte den Mann von der Seite. Seine hellen, leicht rötlichen Haare kurz geschnitten, zu einem bräunlichen, etwas kantigen Gesicht. Augenbrauen, die fast denselben Farbton hatten, buschig über grauen Augen. Eine knollige Nase und ein Mund, den zwei Grübchen zierten. Lange, schmale Finger, ein Ehering an der linken Hand. Die Arme leicht behaart, gebräunt mit zahlreichen Sommersprossen übersät. Mit der Krawatte und dem hellen Hemd sah er irgendwie albern aus. Schien bieder und uninteressant zu sein.
„Danke, dass Sie eingesprungen sind. Heute ist der Teufel los. Alle OPs besetzt und eine der Operationsschwestern hat frei. Das kommt nur einmal im Jahr vor, also keine Sorge, wegen der Fehler. Das ist nicht Ihr Gebiet. Nun wissen wir wenigstens, wo man Sie nicht einsetzen kann.“
„Kein Problem. In drei Tagen geht es sowieso los“, äußerte sie, obwohl sie Zorn aufkeimen spürte.
„Zunächst ein Hinweis, da Sie anscheinend nicht die Beilage zu dem Arbeitsvertrag gelesen haben. Es gilt eine gewisse Kleiderordnung. Das bedeutet, Frauen arbeiten im Kostüme, oder Rock und Bluse. Keine Jeans, Hosen oder so ein Top, wie Sie gerade tragen. Wir sind ein Krankenhausbetrieb, seriös, und Sie liegen nicht am Strand von Mombasa. Selbst dort sehen es die Einheimischen nicht gern, wenn sich Urlauber schlimmer kleiden wie prostitute. Das soll keine Beleidigung sein. Nur erscheinen Sie in Zukunft bitte in entsprechender Kleidung. Ich meine damit keinen Minirock. Selbst in Europa oder den Staaten laufen Krankenhausbedienstete nicht so herum. Wie gesagt, Sie werden arbeiten und verleben keinen Urlaub. In einem OP haben Sie nie gearbeitet?“
„Natürlich!“, nun vor Wut schäumend.
„Davon hat man allerdings nichts bemerkt. Manchmal können Sekunden über Leben und Tod bei einem Menschen entscheidend sein. Wenn da nicht jeder Handgriff sitzt, in Fleisch und Blut übergegangen ist, jemand nicht im Voraus mitdenken kann, bedeutet das eine große Gefahr für den Patienten. Wir werden Sie nur bei den herkömmlichen kleinen Fällen einsetzen. Die Verantwortung für andere kann man einer dermaßen unerfahrenen Person nicht übertragen, da das mehr als sträflicher Leichtsinn wäre. Wir wollen Patienten heilen, lebend entlassen und nicht töten. Das bedeutet für Sie, überwiegend kleine Wunden, Impfungen, Brüche behandeln. Das dürfte ja kein Problem sein, oder?“
„Selbstverständlich nicht“, erwiderte sie patzig. „Das war nur die Aufregung“, versuchte, sie zu erklären.
„Miss Niebert, wenn wir einen Patienten auf dem OP-Tisch liegen haben, darf es keine Aufregung geben. Ist egal. Wie ich bereits sagte, sind Sie dafür nicht ausgebildet worden und es wurde nie geplant, dass man Sie in diesem Bereich einsetzt. Das geht aus Ihren Unterlagen hervor. Dazu fehlen Ihnen jegliche Voraussetzungen und Qualifikationen. Haben Sie über meinen Vorschlag nachgedacht, mich nach Nyeri zu begleiten?“
„Warum nicht? Es ist egal, wo ich arbeite und wenn ich dort mehr gebraucht werde, Nyeri. So erspare ich mir das Suchen einer Wohnung und einer Putzfrau.“
Konsterniert sah er sie an. „Eine was? Egal, das würde mich freuen, weil ...“
„Wie ist es gelaufen?“, fragte Erik und nickte der Frau kurz zu.
„Alles gut. In sechs Wochen ist er vermutlich einsetzbar.“
„Sechs Wochen? Na, gut, eben in sechs Wochen.“
Er nahm Platz und Ian stellte ihm Ariane Niebert vor. Erik warf ihr nur einen flüchtigen Blick zu, da er mit anderen Problemen beschäftigt war. Wenigstens würde Tom keine Schäden davontragen, dachte er erleichtert.
„Falls etwas sein sollte, Doktor McGimes, lassen Sie mich holen.“ Sie ergriff die Tasse und schlenderte langsam mit wiegenden Hüften weg. Diesen Gang hatte sie den Models abgeschaut und so oft geübt, dass sie ihn perfekt beherrschte, wie sie dachte. Nur heute schaute keiner hin, das wusste sie nicht.
„Du bist ein unhöflicher Kerl“, hörte sie die Stimme ihres Chefs, wohl mehr lächelnd, als ernst.
„Warum? Sollte ich mit ihr Face-to-Face-Kommunikation betreiben? Dazu habe ich keine Lust. Sie ist nicht mein Typ. Unter Umständen hättest du ein süßes, schnuckeliges, dunkelhaariges Wesen aussuchen sollen, notabene ist sie nicht intelligent. Kaum im Land, schon Sonnenbrand und sie will Daktari sein? Über was soll ich mit so einer Person reden? Du kennst mich lange genug“, grinste er zurück. „Spaß beiseite, sie ist unwichtig, was ist mit Tom?“
Ian schilderte alle Einzelheiten der OP und der schüttelte nur den Kopf.
„Ich habe dir gesagt, sie ist eine Niete. Schicke sie zurück und hol dir einen anderen. Du hattest zwei weitere zur Auswahl.“
‚Hab ich probiert, einer ist in Tanzania, der andere hat nicht geantwortet. Ich hätte sie nach Mombasa abgeschoben. Seit ich ein paar Worte mit ihr gesprochen habe, weiß ich, dass sie die Falsche ist. Ich werde sie mit nach Nyeri nehmen.“
„Warum das denn? Lass diese fette, hässliche Niete bloß hier.“
„Zügel ein bisschen deine Ausdrucksweise. So dick ist sie nicht und es geht nicht um einen Modelvertrag. Werfe ich sie richtig ins kalte Wasser. Spaß beiseite, sie kann uns dort den Kleinkram abnehmen. So haben wir mehr Zeit und können uns um wichtigere Dinge kümmern.“
„Du bist der Chef und wenn du meinst. Ich war vor ein paar Tagen bei Ndogo. Er hat Patienten, obwohl noch nicht alles fertig ist. Karubi und Amy behandeln, während er sich mit allen möglichen Arbeitern ärgert. Das erste Neugeborene ist da und die Eltern haben es Karubi getauft.“
„Asante, das du mir das sagst. Ich fahre wahrscheinlich am Wochenende hin, da Sam Bericht erstattet haben möchte. Du sollst deinen Dad anrufen. Er hat dich nicht erreicht. Es ist eilig, hat er gesagt.“
„Ich warte nur auf Toms Familie, fahre ich hin. Ich benötige eine Dusche und saubere Klamotten.“
„Wenn dich Julie so sieht, kriegt sie Panik.“
„Sie nicht. Das kennt sie“, schmunzelte er.
„Wie geht es deinem Babu?“
„Er leidet sehr. Keiner hat damit gerechnet, dass sie stirbt. Es war für uns alle ein Schock, besonders hart hat es ihn getroffen. Sie hatten haufenweise Pläne. Er ist stark. Er wollte mit Ndemi für einige Tage auf Safari. Ndemi und Lokop sind die Einzigen von den älteren Leuten, die noch da sind. Er wird ihr bestimmt bald folgen. Dad ist ebenfalls ziemlich niedergeschlagen. Er hat seine Stiefmutter vergöttert.“
„Sie war nicht nur eine sehr schöne und starke Frau, sondern ein Außergewöhnliche. William hat sie sein Juwel genannt. Gehen wir zu unserem Patienten. Er müsste bald wach werden.“
Sie tranken aus und erhoben sich.
Ariane hatte vor Wut kochend den Raum verlassen. So ein blöder, arroganter Affe, dachte sie. Dabei sah er umwerfend aus. Auf dem Weg zu ihrem Zimmer drehte sie sich um, eilte zu dem Patienten, der allerdings noch nicht erwacht war. Eine dunkelhäutige Schwester trat ihr entgegen.
„Sie müssen mir nichts sagen, da ich Ärztin bin, Ihre Vorgesetzte, Doktor Ariane Niebert. Kümmern Sie sich um Ihre Arbeit. Ich sehe nach diesem Patienten.“
Die Frau wollte sie zurückhalten. „Sie können so nicht …“
Grob schubste sie die beiseite. „Wenn du bleiben willst, schreibe mir nicht vor, was ich kann.“
Sie betrat den Raum, schaute kurz zu den Geräten, Werten, als sie bemerkte, dass er sich bewegte. Sie blickte auf ihn hinunter und langsam öffnete er die Augen.
„Bleiben Sie ruhig liegen. Sie wurden operiert, aber es ist gut verlaufen.“
„Ein Engel“, brachte er leise heraus.
„Nein, dass nun nicht gerade, eher eine Ärztin“, lächelte, sie den jungen Mann an. Der versuchte sich zu bewegen, verzog geringfügig sein Gesicht.
„Bleiben Sie liegen. Doktor McGimes und ich haben die Kugel herausoperiert. Sie dürfen nicht aufstehen oder sich bewegen.“
„Wer sind Sie? Ich habe Sie noch nie gesehen.“
„Doktor Ariane Niebert und wie gesagt, ich bin Ärztin.“
Die Tür öffnete sich, ihr Chef trat mit diesem Flegel herein. Flugs berichtete sie, dass alles in Ordnung sei.
„Was fällt Ihnen ein, so einen Raum der Intensivstation zu betreten? Sind Sie völlig irre? Können Sie nichts?“, brüllte Ian. „Sie sind keine Frau Doktor, sondern eine anscheinend nichts könnende oder wissende Daktari.“
Erik murmelte ihm leise etwas zu.
„Sie brauchen und sollen sich nach einer OP nicht um den Patienten kümmern, da wir dafür qualifiziertes Personal haben. Diese Arbeit heute war sowie eine Exzeption und gehört nicht in Ihr Gebiet. Sie werden dazu nur im äußersten Notfall gerufen, was besonders für Nyeri gilt, da dort ein begnadeter Chirurg sowie hervorragende OP-Schwestern arbeiten. Es ist, wie wir bemerkt haben, besser so. Das überfordert Sie erheblich“, betonte Ian nochmals, hatte dabei die Stirn gerunzelt. „Nochmals solche Eigenmächtigkeiten und Sie fliegen zurück. Wazimu! Trägt wie eine bozi mgeni Bakterien herein. Haben Sie nichts gelernt? Hat man Ihnen nicht einmal die kleinsten Regeln und Vorsichtsmaßnahmen beigebracht? So etwas Verantwortungsloses habe ich in meinen Jahren als Doktor nie erlebt.“
„Wo ist der Engel?“
„Tom, du fantasierst. Es gibt keine Engel, und bis du dahin kommst, dauert es noch eine Weile.“
„Diese Daktari.“
„Ach du Schande, dir scheint es schlecht zu gehen. Die ist älter als deine Mum und hässlich, fett und verblödet. Werde gesund, das ist das Wichtigste. Deine Eltern und Kate kommen in wenigen Minuten.“
Ariane verließ den Raum. Vor Wut fast berstend eilte sie in ihr Zimmer. Sie hatte einiges erlebt, das war der Gipfel der Frechheit. Diese McGimes führte sich skandalös auf und der gut aussehende Affe … Die meisten Männer bezeichneten sie als schön.
Sie hatte dunkelblonde, gelockte Haare, die ihr bis über die Schultern fielen, wenn sie diese offen trug. Ihre Haut war von der afrikanischen Sonne leicht gebräunt, was ein hübscher Kontrast zu ihren blauen, leuchtenden Augen war. Diese Augen strahlten Lebenslust, Freude aus, bisweilen jedoch schauten sie voller Arroganz und Überheblichkeit, oder sinnlich und verführerisch. Eine kleine Stupsnase und ein schön geschwungener Mund mit vollen Lippen rundeten ihr Gesicht ab. Perfekt, wie sie meinte. Sie war nicht gerade klein, mit ihren 1,74 Metern, schlank, grazil, wie sie fand. Ihre Bewegungen waren fließend, geschmeidig. Das Besondere an ihr war ihre feminine Ausstrahlung, daneben wirkte so lebendig, humorvoll, glücklich. Sie hatte Charme und strahlte Wärme aus, dazu kamen ihre Intelligenz, ihr Frohsinn und besonders ihre Natürlichkeit, wie sie sich beurteilte. Sie besaß den graziösen Gang der Models, bewegte sich voller Anmut. Sie war so eine perfekte Frau, wie Dichter in ihren Romanen, die schönen Frauen und Heldinnen beschrieben. Über alles, das ihr nicht gefiel, sah sie generell hinweg, da sie sich als makellos einstufte.
Auf der einen Seite hasste sie plumpe Anmache von Männern, obwohl sie all das leere Gerede und die dummen Floskeln oft gehört hatte, regte sie sich trotzdem ständig auf. Andererseits genoss sie es, wenn sie Männer wegschicken konnte, ihnen auf eine herablassende Art klarmachen konnte, dass sie kein Interesse an ihm hatte. Es war ein Spiel, das ihr gefiel, das ihr zeigte, dass Männer sehr wohl ein Auge auf sie warfen. Ja, sie wollte von den Männern bewundert werden. Sie flirtet gern, sehr gern, um ihn folgend, mit einer oftmals rüden, beleidigenden Ausdrucksweise in seine Schranken zu weisen. Stefan hatte sie deswegen öfter angeblafft, sie sogar als eingebildete Schnepfe bezeichnet. Aber auch der war nur ein Mann.
Die Geschwister verband eine große Zuneigung, trotz aller zuweilen sehr heftigen Streitereien in der Vergangenheit. Sie waren ein Herz und eine Seele, fand sie. Dabei ignorierte sie, wenn er sie als Angeberin, verwöhnte Göre, überhebliche Tussi bezeichnete. Es gab nur seit über einem Jahr einen Streitpunkt, das waren seine Ansichten über ihre berufliche Qualifikation. Seine Unverschämtheiten in dieser Hinsicht konnte sie selbstverständlich nicht dulden und es hatte permanent gekracht.
Heute war sie mehr als verärgert, dass jemand sie als unansehnlich abstempelte. Das wurmte sie gewaltig und beschäftigte sie den ganzen restlichen Tag. Erneut sah sie sich in dem kleinen Spiegel an, bis sie ihn am Abend wütend in die Ecke warf. Warum der Krankenhausleiter wegen der kleinen Fehlgriffe so ein Aufheben veranstaltete, fand sie mehr als ungerecht. Die Menschen schienen nicht sehr freundlich zu sein, dabei hatte sie damit gerechnet, in diesem Land mit offenen Armen empfangen zu werden. So hatte sie es jedenfalls gelesen. Sie sollten sich freuen, überhaupt qualifiziertes Personal zu bekommen. Am meisten beschäftigte sie sich gedanklich mit diesem aufregend aussehenden Mann. Sie hatte einige sehr gut aussehende Männer gehabt, aber der war etwas Besonderes. Ein leichtes Prickeln durchraste ihren Körper, als wäre er von Kopf bis zu den Füßen elektrisiert. Nie hatte ein Mann sie dermaßen in ihren Bann gezogen. Schade, dass er nur ein ungebildeter Flegel war, der ihr nichts bieten konnte. Für seine Worte würde er von ihr eine richtige Lektion erhalten, die der nie vergessen würde.
*
Trotz Verbot besuchte sie am nächsten Tag den Patienten, der auf der Intensivstation lag. Man wollte sie daran hindern, sie schob die Krankenschwester grob beiseite.
„Du kannst dich um ihn kümmern, wenn ich weg bin. Ich werde dir genaue Anweisungen geben. Verstehst du überhaupt Englisch?“
„Selbstverständlich. Ich muss Fieber messen und …“
„Ich bin die Ärztin und sage, was zu tun ist.“
„Sie müssen diese Sachen anziehen und …“
„Dummes Ding, wage nicht, mir etwas vorzuschreiben“, blaffte sie die Frau an, betrat den Raum.
Er schaute sie lächelnd an. „Da ist ja der Engel“, grinste er.
„Wie geht es Ihnen?“
„Jetzt besser, Frau Doktor. Wenn Sie in meiner Nähe sind, könnte ich Bäume ausreißen.“
Diese Worte waren Balsam auf ihr verletztes Ego.
„Damit warten Sie besser. Wie ist es zu Ihrer Verletzung gekommen?“
„Wir haben Wilderer verfolgt und es kam zum Schusswechsel. Eine hat sich verirrt und mich getroffen. Im Nachhinein war das ein Glücksfall.“
Sie schüttelte leicht den Kopf, lächelte. „Was arbeiten Sie beruflich?“
„Bin bei dem KWS.“
„Was ist die KWS?“
Nun war er verblüfft und schaute sie ungläubig an. „Kenya Wildlife Service, davon gehört?“ Er versuchte, sich etwas aufzurichten, sank in das Kissen zurück. Schweißperlen erschienen auf seiner Stirn.
„Ja, ein wenig, erzählen Sie“, log sie, setzte sich auf einen Stuhl. Er gefiel ihr, außerdem genoss sie seine offensichtliche Bewunderung.
„Zur Jahrtausendwende begann in Kenya die Diskussion über die Notwendigkeit des Naturschutzes. Früher haben Menschen und Tiere friedlich zusammengelebt. Die Völker, die wilde Tiere jagten, hatten nur primitive Waffen und töteten nur so viele Tiere, wie sie für ihr Überleben benötigten. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Jagd ein gewinnbringendes Geschäft. Fleisch von Antilopen und Gazellen wurde in Mombasa an die Schiffsbesatzungen verkauft. Ostafrika wurde ein beliebtes Ziel für White Hunter aus Übersee, die auf der Großwildjagd spannende Abenteuer erleben wollten. Mit dem Handel und Export von Jagdtrophäen war überreichlich Geld zu verdienen. Dazu kam, dass die kenyanische Bevölkerung wuchs, es gab mehr Menschen, die ständig mehr Platz benötigten. Die Zahl der Tiere sank dramatisch und manche Arten wurden fast ausgerottet. Nach einer internationalen Konferenz wurde 1909 ein Gesetz erlassen, welches das Maasailand und ein Gebiet im Norden Kenyas zum Tierreservat erklärte. Die Ausarbeitung dieses Gesetzes dauerte allerdings einige Jahrzehnte. In den Dreißigerjahren wurde entschieden, die Pflanzen, wilde Tiere und besondere Landschaften in Nationalparks und Reservaten zu schützen.
1946 entstand in der Nähe von Nairobi, Kenyas erster Nationalpark, der Nairobi-Nationalpark. Bereits 1963, als Kenya unabhängig wurde, gab es im Land zwölf Parks und Reservate. Heute sind es an die sechzig, die mit ungefähr 45.000 Quadratkilometer, fast 8 Prozent des Landes ausmachen.“ Er holte tief Luft, atmete hastig, berichtete in einem schleppenden Tonfall weiter. „1977 wurde die Großwildjagd und 1978 der Handel mit Trophäen verboten. Das Wildern ließ sich nicht so leicht verbieten. Schwer bewaffnete Wildererbanden reduzierte zwischen 1968 und 1988 die Zahl der Elefanten in Kenya von 180.000 auf 20.000, von 20.000 Nashörnern blieben 400 übrig.“
Sie bemerkte, mit welch Enthusiasmus er das erzählte. Seine Wangen hatten sich gerötet, seine braunen Augen leuchteten und er sah wie ein großes Kind aus. Mit seinen knapp 19 Jahren war er das in gewisser Weise sogar.
Er holte tief Luft, hob die Hand und wischte die Schweißperlen von der Stirn. „1989 wurden die Artenschutzgesetze geändert, um eine effektivere Politik zu ermöglichen. Der Kenya Wildlife Service wurde gegründet und trägt seitdem die Verantwortung für die Nationalparks und Reservate sowie für die wilden Tiere außerhalb der Schutzgebiete. Der KWS ist eine halbstaatliche Organisation, die sehr weitreichende Befugnisse hat. So entscheidet der KWS, welche Gebiete Nationalparks werden, welche Regeln in den Parks gelten und wie viel Eintritt zu zahlen ist. Mit den Eintrittsgeldern werden die Aktivitäten des Kenya Wildlife Service bezahlt, darunter das Management der Schutzgebiete und die Anti-Wilderer-Einheiten.“ Erschöpft schwieg er.
„Erzählen Sie weiter“, forderte sie ihn auf. „Das ist ja so interessant, wie Sie das schildern.“
Er räusperte sich leise, verzog dabei etwas das Gesicht, das zu glühen schien. Schleppend berichtete er weiter. „Im Juli 1989 entfachte Präsident Moi eine erhitzte Diskussion, als er zwölf Tonnen Stoßzähne, die von Wilderern beschlagnahmt wurden, öffentlich verbrennen ließ. Kenya spielte eine leitende Rolle in der Kampagne, was zum weltweiten Verbot des Handels mit Elfenbein führte. Die letzten Nashörner wurden in Schutzgebiete übergesiedelt und werden rund um die Uhr bewacht. Diese Politik ist sehr erfolgreich, sowohl die Zahl der Elefanten, als die der Nashörner nimmt jährlich um 5 Prozent zu.“
„Sie gehören zu dieser Anti-Wilderer-Einheit?“
„Ja!“
Sie hörte, wie stolz er darauf war. Er wischte sich über die Stirn, seine Haare inzwischen feucht.
„Dieser andere Mann, der bei Ihnen war, ebenfalls?“ Sie musste mehr über diesen gut aussehenden Typ erfahren. Nur deswegen hatte sie sich das angehört. Sie wusste, dass es reichlich Wild in diesem Land gab, deswegen gefiel es ihr. Wenn man da ein paar Elefanten abknallte, waren noch genug da. Sie hatte in München einmal eine Figur aus Elfenbein gesehen und fand die sehr schön. Leider hatte Dirk ihr die nicht gekauft, weil er der Meinung war, so etwas kaufte man nicht. So war es mit der Leopardenjacke gewesen. Sprungweise war er richtig geizig.
Tom wischte abermals mit der Hand über die Stirn, hätte so gern geschlafen. Er fand die Frau sehr nett.
„Mein Boss. Wissen Sie, gewildert, wird ständig und diese Kerle schlagen mit allen Mitteln zu. Die sind teilweise besser ausgerüstet als wir, weil das organisiert betrieben wird. Es steckt in Hülle und Fülle Geld dahinter“, sprach er leise, kaum mehr zu verstehen.
„Ein scheußliches Geschäft. Nur Geld regiert die Welt. Erzählen Sie mir mehr von Ihrem Boss. Woher kommt er? Was macht er bei dem Verein? Ist er verheiratet? Wo leben seine Eltern? Ist sein Vater auch bei der KSW? Ist er so nett wie Sie?“
„KWS! Frau Doktor, Sie entschuldigen, ich bin sehr müde.“
Sie erhob sich. „Gehe ich eben. Schade, ich hätte gern mehr über Sie, Ihre Arbeit und Kollegen gehört.“
„Kommen Sie mich nochmals besuchen, Frau Doktor?“
„Sicher. Sie sind schließlich der erste Patient, den ich operiert habe.“
„Ein gutes Omen“, lächelte er sie an, es wirkte verzehrt, seine Augen blickte sie glasig an, bevor er die Lider schloss.
„Pumbawu“, hörte sie eine Stimme und sie drehte sich erschrocken um.
Erik und ihr zukünftiger Chef standen im Raum. Erik nickte ihr flüchtig zu und wandte sich an den Patienten.
„U habi gani, rafiki yangu?“, hörte sie den Mann reden.
„Si mbaya! Tafadhali, unipe maji ya kunywa.“
„Iko hapa maji.“
Erik reichte ihm ein Glas, hörte Ian zu.
„Miss Niebert, ich hatte eine Anweisung gegeben und ich erwarte, dass diese befolgt werden. Es erleichtert uns allen ungemein die Arbeit“, sagte Ian kalt zu ihr. „Sie gehen in ein Zimmer auf der Intensivstation, ohne die erforderlichen Schutzmaßnahmen? Haben Sie nichts gelernt oder wollen Sie unsere Patienten umbringen? Das ist unverantwortlich. Sie bilden sich zu viel ein! Es steht Ihnen gewiss nicht zu, einer erfahrenen Schwester Anweisungen zu erteilen. Sie sind eine kleine, unwichtige Daktari und nicht mehr. Selbst diese Krankenschwestern stehen über Ihnen. Verstanden?“
Erik erblickte die stark glänzenden Augen, die Schweißperlen auf dessen Stirn. „Ian, ana homa. Yu mganga? Hasha!“
„Miss Niebert, Sie haben nicht einmal bemerkt, dass der Patient Fieber hat und das sein Herz viel zu schnell schlägt, um es vereinfacht auszudrücken, damit selbst Sie es begreifen. Gehen Sie und Sie haben Verbot, diese Station zu betreten. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Versuchen Sie erst keine Eigenmächtigkeiten, sonst sind Sie schneller in Deutschland, als Sie denken. Kwa heri. Das habe ich noch nie erlebt, so etwas von dumm, verantwortungslos. Erik, ich lass ihn hinüberbringen. Wir müssen eine Infektion ausschließen können. Wer weiß, was diese Niebert für Bakterien eingeschleppt hat. Wazimu!“
„Diese Deutsche ist unfähig. Wenn ich es nicht gelesen hätte, würde ich denken, die ist keine Medizinerin. Von nichts Ahnung prahlt die lautstark, dass sie Tom operiert hätte. Eine Angeberin und Nichtskönnerin. Passiert Tom etwas, schicke ich die Kizee ins Gefängnis. Lass die bloß hier. So etwas können wir in Nyeri nicht gebrauchen. Die ist eine Gefahr für die Allgemeinheit, diese aufgeblasene Braut. Wazimu!“
„Sie will etwas von dir. Deswegen wollte sie Tom ausfragen.“
„Wer nimmt so eine fette, alte Kuh? Blinde, alte Säcke, die sonst keine abbekommen. Bei so einer Kizee vergeht mir alles. Überall schwabbelt das Fett, dazu diese ordinäre Kleidung, wie eine abgehalfterte prostitute. Ekelhaft! Mamaye sieht besser aus als die.“
Ariane ballte vor Wut die Fäuste, Tränen traten ihr in die Augen, bevor sie leise die Tür schloss. Das würde der Typ bereuen, so über sie herzuziehen. So redete keiner mit oder über sie.
„Ich denke darüber nach. Komm, fahren wir ihn hinüber. Das Fieber ist nicht normal. Heute Morgen war er in Ordnung.“
„Wird die verblödete Kizee Bakterien hereingeschafft haben.“
„Blödsinn! So schnell würde sich das nicht auswirken. Unterstell ihr nichts, selbst wenn sie Fehler gemacht hat.“
*
Erik Shrimes saß bei den Kindern seines Freundes Ian und las ihnen ein Märchen vor. Er hatte zugestimmt, Silvester bei ihm mitzufeiern, obwohl ihm nicht sonderlich danach zumute war. Noch nagte der Tod seiner Großmutter in ihm und dazu, hatte er beruflich jede Menge Probleme. Susan trat leise ins Zimmer. Die meistens fröhliche, gut gelaunte Blondine trug ein dunkelrotes Sommerkleid, mit weitem Rock und wirkte wie ein Wirbelwind. Die blauen Augen strahlten und dominierten in dem kleinen, schmalen Gesicht. Sie war sehr zierlich und passte äußerlich nicht zu dem großen, kräftigen Ian.
„So, Schluss für heute. Erik, die Gäste trudeln allmählich ein.“
„Stürze ich mich ins Gewühl. Zum Feiern ist mir allerdings, nicht zumute.“
„Es lenkt dich ab. Eve hätte nicht gewollt, dass du trauerst.“
„Ich weiß, trotzdem … Sie fehlt mir, Dad, Babu, allen. Sie war stets gesund und …“ Er fühlte den Kloß im Hals, beugte sich hinunter, gab den Kindern einen Kuss auf die Wangen und verließ das Kinderzimmer.
Er griff nach einem beer und begrüßte die Anwesenden, stellte sich zu Ian. „Schlafen sie?“
„Noch nicht.“
„Dein Babu ist in der Ngatia-Lodge?“
„Babu und Ndemi sind unterwegs. Sie feiern dort alle zusammen. Kinjija, Karanja und Mweze sind mit den Familien dort. Jonas und Keith sind heute Morgen ebenfalls hingefahren. Geht ja alles auf unsere Kosten und Mamaye hat reichlich Arbeit. Es wird allerdings eher eine ruhige Feier. Noch ist das zu frisch. Deswegen die Lodge. Auf der Farm erinnert alles an sie. Man denkt, die Tür geht auf und Nyanya kommt herein.“ Eve fehlte ihm. Er hatte seine Großmutter angebetet und nun … Er trank rasch, wollte sich nicht der Trauer hingeben. „Dad wird jetzt endlich die Farm und das Land da oben verkaufen. Babu ist total senil, bekommt nichts mehr mit. Selbst den Schmuck von ihr hat er nicht Mamaye gegeben, sondern er wurde ausfallend, als die ihn mitnehmen wollte. Dabei ist sie mit Dad am nächsten Abend groß ausgegangen. Charlotte und William können sich eine kleine Wohnung irgendwo nehmen. Das reicht für die beiden alten Leute.“ Er drehte sich ein wenig um, bemerkte daher nicht das vor Abscheu verzogene Gesicht des Dokitari, als er Susan fragen hörte. „Haben Sie sich ein wenig eingerichtet?“
„Nicht wirklich, da ich mir keine Wohnung und Putzfrau suchen muss, wenn ich nach Nyeri gehe.“
Susan zog die Augenbrauen hoch, lächelte weiter, Contenance bewahrend.
Erik musterte sie kurz. Sie trug ein enges, dreiviertellanges, rotes Stretchkleid, das eindeutig zwei Nummern zu klein war und unvorteilhaft die wenig vorhandene Taille betonte. Die dunkelblonden Haare umrahmten das runde Gesicht, ließen es dicker wirken. „Ein wenig zu körperbetont. Wenn ich keine Figur habe, sollte ich etwas anderes anziehen.“
„Du bist bissig. Ist vielleicht modern und so eine schlechte Figur hat sie nun wirklich nicht.“
„Für Frauen, die es sich leisten können, so etwas zu tragen. BHs scheint sie nicht zu kennen, sonst würde ihr Busen nicht auf dem Bauch hängen. Selbst der Slip ist zu eng und schneidet in ihr Fett. Gruselig! Erinnert mich eher an eine aufgequollene Nudel, die man zu lange gekocht hat, mit Tomatensoße.“
Allgemeines Gelächter erklang in seiner Umgebung und Ian lachte laut.
„Ja“, hörte er Susan. „Ich höre, Ian hat Ihnen nur die Hälfte erzählt. Für die Ärzte wurden da Häuser aufgestellt. Nett. Es gibt dort sogar einen kleinen Garten zu jedem Anwesen.“
„Wie ich höre, meine Liebe, berichtest du gerade von unserem neuen Zuhause. Ich freue mich, Miss Niebert, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Ein neues Jahr sollte man nicht allein beginnen, besonders nicht in einem fremden Land.“
„Danke für die Einladung, Doktor McGimes“, schlenderte sie weg, musterte Erik nur kurz. Ian verließ ebenfalls die Gesellschaft, da er telefonieren wollte.
„Dieses unscheinbare Wesen hätte keiner vermisst. Farblos, fett, dumm und eine Angeberin. Das einzig Schöne an ihr sind die Schuhe. Nur mit Pumps laufen kann sie nicht. Sieht eher wie ein gehbehinderter Marabu aus. Eben eine runde Nudel mit Tomatensoße.“
„Wenn sie das gehört hat, schäumt sie“, kicherte Susan.
„Lass sie schäumen, unwichtig. Du kennst meinen Geschmack, Susan. Es gibt nur eine blonde Frau, die ich mehr als nett finde und das bist du. Nur Ian war schneller. Desgleichen mag ich keine Menschen, die nichts können, aufschneiden. Diese Nichtskönnerin behauptet tatsächlich gegenüber Tom, sie hätte operiert, derweil war sie zu dämlich das Besteck zu reichen. Nicht heute Abend. Ich flirte lieber mit dir.“
„Susan hätte dich nie genommen, weil sie meine Sommersprossen liebt“, grinste Ian, allerdings sahen seine Augen ihn kalt an. „Darling, ich soll dich grüßen. Sie kommen Anfang Januar.“
„Wer kommt im Januar?“
Eine Antwort erhielt Erik allerdings nicht.
Ariane trat zu einigen weißen Ärzten und schaute sich um, ließ musternd ihren Blick über die Gestalt von diesem arroganten Lümmel schweifen und warf ihm ein überhebliches Augenspiel zu, bevor sie sich endgültig wegdrehte. Sie hörte die drei Leute lachen und münzte es sofort auf ihre Person, dass sie nur noch mehr erboste. Sie hörte desinteressiert den Gesprächen zu. Alles war wenig luxuriös, eher armselig wurde hier gefeiert, stellte sie fest. Besonders störte sie, dass die unzähligen Schwarzen sich erlaubten, sie anzusprechen. Es war skandalös. Sie hatte in Büchern gelesen, wie unterwürfig sich die Schwarzen gegenüber den Weißen verhielten, verhalten zu hatten. Benahm sich einer daneben, hatte man als Weißer sogar das Recht, diese Neger zu züchtigen. Davon hatte sie bisher nichts bemerkt. Sogar auf der Straße glotzten sie die Schwarzen blöd an. Sie machten keinen Platz, wenn Weiße entlang spazierten. Im Gegenteil, eine Schwarze hatte sie sogar angerempelt, frech gegrinst.
Erik stand allein draußen und genoss die kühle Nachtluft. Das Jahr 2002 hatte angefangen. Was würde es ihm bringen? Er schaute zum Sternenhimmel empor und dachte an seine Großmutter. Warum musste diese warmherzige Frau nur so plötzlich sterben? Und sein Babu? Wie würde er den Tod seiner geliebten Frau verkraften? William ging auf die achtzig zu, wurde zunehmend seniler, verlor den Überblick, warf das Geld mit beiden Händen zum Fenster hinaus: Urlaub, Ballonfahrten und wer weiß, was die alles unternommen haben. Man musste dem rasch einen Riegel vorschieben, sonst gab der Greis alles aus. In wenigen Wochen hätten sie ihren 49. Hochzeitstag gefeiert. Innerhalb von Stunden veränderte sich das gesamte Leben und es konnte jeden treffen. „Nyanya, du fehlst uns allen so sehr. Ohne dich ist das Haus leer. Dein Lachen fehlt uns, deine Wärme. Babu ist …“
„So allein?“
Erschrocken drehte er sich um. „Ich wollte meine Ruhe haben, Miss Niebert. Wollen Sie eine Entschuldigung hören?“ Sein leicht spöttischer Tonfall brachte sie abermals gegen ihn auf.
„Nein! Warum sollte ich? Es gibt Menschen, deren Meinung mir ziemlich gleichgültig ist und dazu zählen Sie. Lassen Sie mich bitte allein.“
„Ich stand zuerst draußen, außerdem, Sie eingebildete Person, gehört Ihnen wohl kaum das Grundstück. Wazimu!“
„Bei einem Kerl aus dem Urwald kann man eben kein Benehmen erwarten“, erwiderte sie patzig, wütend über seine herablassende Art.
„Wenn Sie meinen, Miss Niebert“, erwiderte er müde.
„Sie albern Tölpel, es heißt Frau Doktor Niebert, kapieren Sie das, Sie depperter Wilder?“
„Sind Sie vorsichtig mit Ihren Formulierungen, sonst bekommen Sie Ärger. Obendrein haben Sie keinen Doktortitel, Miss Niebert. Dafür hat Ihr Wissen nicht annähernd gereicht.“ Seine Stimme sarkastisch, während er sie mit seinen braunen Augen kalt taxierte. „Ich mag keine alten Frauen, die arrogant, dumm sind, angeben, aber nichts können. En passant finde ich Ihr Aussehen nach wie vor nicht aufregend. Sie sind zu dick, haben keine Kurven und Ihr Gesicht ist rund, rot, faltig, die Haare haben Spliss und der Nagellack ist abgeplatzt.“ Er trat ins Haus zurück.
„Lassen Sie mich in Ruhe“, keifte sie ihm nach.
Erik verabschiedete sich wenig später von seinen Freunden und fuhr zur Wohnung seiner Eltern. Er genoss eine Weile die Ruhe, bevor er sich hinlegte und fast sofort schlief.
*
Vier Wochen waren für Ariane wie im Flug vergangen. Jeder Tag beinhaltete mindestens zehn Stunden Arbeit. So viel hatte sie in ihrem Leben noch nie geleistet. Es war so ungewohnt, neu und hatte nur wenig Ähnlichkeit mit der Klinik in München, wo sie zwangsläufig hatte arbeiten müssen. Alles erschien ihr so fremd, so anders, als wie sie es kannte. Das Bild, das sich ihr auf den Stationen bot, war mehr als gewöhnungsbedürftig. Es gab Zehnbettzimmer. In manchen Betten lagen oftmals sogar zwei Patienten. Sie fand den Geruch in den Zimmern ekelhaft, hatte mehrmals nachgefragt, ob sich die Leute nie waschen würden. Das hatte ihr nur boshafte Blicke eingebracht. Schockierend fand sie den Zustand der Patienten. Alle sahen schlecht aus, die Krankheiten waren weit fortgeschritten, wie ihre anderen Kollegen erklärten. Aus finanziellen Gründen, so erfuhr sie, gingen die meisten erst in ein hospitali, wenn es nicht zu vermeiden war. Mit 2.000 Plätzen ist das Kenyatta das größte Krankenhaus Ostafrikas und das Einzige, das Nierentransplantationen, Operationen am offenen Herzen oder Computertomografien anbietet. Nur wenn sie den Alltag sah, zweifelte sie daran. Amüsiert las sie jeden Tag, wenn sie das Gebäude betrat, die Schilder: This is a corruption free zone. Erst Tage später hatte ein Arzt sie aufgeklärt, was das bedeutete, und ihr berichtet, dass es gewiss nicht an dem wäre, allerdings habe sich die Situation im Laufe der Jahre gebessert. In Kenya studiere man primär Medizin, um Geld zu verdienen. Sie wusste nicht, warum er das in so einem merkwürdigen Tonfall sagte, so war es überall. Wer ging arbeiten, ohne Geld dafür zu bekommen?
Am Anfang hatte sie einige Male mit Ian und einigen anderen Ärzten Visite absolviert, als sie sich dabei über diese Art der Bettenbelegung ausließ, hatte man sie versetzt. Dabei musste jedem klar sein, dass man 100 Patienten nicht in 70 Betten unterbringen konnte.
Sie hatte mit den schwarzen Ärzten gesprochen, sie aufgeklärt, wie man in Europa Patienten behandelte. Sie kapierten es nur nicht. Egal, was sie verändern wollte, sie erntete nur Ablehnung, sogar teilweise Gelächter.
Es gab unzählige Missstände und das war pure Schlamperei, wie sie fand. Man redete sich damit heraus: „Machen wir vielleicht morgen. Es fehlen Medikamente, Spritzen, Betten.“ Blöde lapidare Ausreden, um ihre Faulheit zu entschuldigen. Als sie deswegen die Ärzte kritisierte, hatte man sie stehen gelassen, sie als wazimu betitelt. Was das hieß, wusste sie nicht, sie vermutete nichts Gutes.
Nun hatte man sie in der Notaufnahme eingesetzt und das missfiel ihr sehr. Es war ein ständiges Kommen und Gehen. Sie behandelte Weiße, Schwarze, Touristen, Inder; versorgte größere und kleinere Wunden, Blessuren, impfte. Sie hatte sogar einen Gefangenen behandeln müssen. Der erschien mit Handschellen gefesselt in schwarz-weiß gestreifter Sträflingskleidung. Daneben zwei bewaffnete Soldaten, die sie mit Argusaugen beobachtet hatten, was sie tat. Schließlich war ihr ein Kollege zu Hilfe gekommen und sie war froh gewesen, dass der ihre Arbeit fortsetzte. Für jeden Patienten musste sie Papiere ausfüllen, dabei gab es ständig Ärger. Diese Schwarzen konnten alle kein Englisch und kamen daher ständig fragen. Die Rechnungen mussten hier gleich bezahlt werden. Der zukünftige Chef des Krankenhauses hatte sich sogar erdreistet, ihr zu sagen, sie solle Englisch lernen, da sie anscheinend der Sprache nicht mächtig sei, sie Orte, Namen, Behandlungen falsch schreibe. Angeblich habe sie sogar mehrmals vergessen, Medikamente zu notieren.
Das Schönste für sie war, wenn sie mit Ian in die nahe gelegenen Dörfer fuhr. Dort wurden unterschiedliche Krankheiten behandelt, Kinder und Erwachsene geimpft, Wunden, Entzündungen versorgt. Sie hatte da wenig zu tun, konnte sich alles ansehen. Es kam ihr so vor, als wenn sie eine Zeitreise unternehmen würde. Leider waren es nur zwei Fahrten gewesen. Er habe sich extra wegen ihr die Zeit genommen, damit sie sehe, wie es außerhalb des Krankenhausbetriebes zuging. Wie sie inzwischen wusste, operierte er ansonsten meistens. Sie wollte sich mit ihm gut stellen, damit sie dabei helfen konnte. Gerade erst vor wenigen Tagen hatte er eine Nierentransplantation vorgenommen, wie sie gehört hatte. Exakt bei solchen Arbeiten wollte sie dabei sein und nicht diese schmutzigen, übel riechenden Schwarzen behandeln.
Die Fahrt zu den Dörfern war ein Erlebnis, das sie mit Staunen erfüllte. Es gab diese sogenannten Matatu-Fahrten. Klapprige Kleinbusse, die völlig überfüllt besetzt waren. Die Dinger sahen aus, als wenn sie jeden Moment zusammenfallen würden. Menschen, überwiegend Frauen, mit schweren Lasten bepackt, die stundenlang nach Hause liefen, wie es schien mühelos, meistens ein Baby auf dem Rücken tragend. So kannte sie es aus ihren Büchern.
Papp- und Wellblechhütten bekam sie unterwegs zu sehen. Die Armut war überall unübersehbar, trotzdem hatten die Menschen Würde und Stolz, wie ihre Vorfahren, die vor Hunderten von Jahren gelebt hatten. Sie gewahrte das laufend von Neuem mit Empörung. Auf was konnte die stolz sein? Wie lange gab man diesen Menschen noch Zeit, so zu leben? In Nairobi hatte sie gesehen, was aus denen wurde, die dem Dorf, dem Rückhalt der Familie, den Rücken kehrten. Sie hausten menschenunwürdig, in Slums, die schlimmer als all die Dörfer waren, die sie gesehen hatte. Ihr Geld verdienten diese Leute in der Großstadt mit Kriminalität; Frauen, junge Mädchen häufig mit Prostitution und damit oft mit dem Tod, da viele mit Aids infiziert waren und wurden. Es war abscheulich, wie diese Schwarzen dort in den Slums hausten, nur weil sie faul waren, sich weder Arbeit noch eine Wohnung suchten. Diese Leute in den Dörfern mussten begreifen, dass sie sich ändern, sich der Neuzeit anzupassen hatten. So würde die jüngere Generation nicht abhauen. Sie würde dafür sorgen, dass sie es wenigstens auf dem Gebiet der Medizin, Sauberkeit und Verhütung kapierten. Es zeigte ihr, wie richtig ihre Entscheidung gewesen war, diesen primitiven Menschen zu helfen. Entwicklungshilfe war mehr als notwendig.
Störend fand sie die Kinder, die sie wiederholt brüsk, mit harten Worten wegscheuchte. Die hatten alle kein Benehmen, waren laut und fassten sie an, manche bettelten sogar. Skandalös.
„Afrikanische Kinder sind im Allgemeinen sehr lebensfroh, fröhlich, kennen keine Berührungsängste“, hatte ihr Ian erklärt. „Du musst das als nette Geste von ihnen sehen und nicht dermaßen aggressiv auf sie reagieren. Es ist Ausdruck ihrer Freude und lieb gemeint. Die watoto wissen, dass die Daktari Bonbons oder Schokolade mitbringen. Sie freuen sich auf diese Leckereien, die sie sonst nicht erhalten.“
Deswegen müssen die mich nicht mit ihren dreckigen Fingern antatschen, hatte sie gedacht, jedoch nicht geäußert. Warum er sich so etwas gefallen ließ, war ihr unverständlich. Die Frauen wurden von ihr aufgeklärt, damit sie nicht scharenweise Kinder bekamen, damit sie geschützt gegen Aids waren. Sie erzählte von Treue, Abstinenz. Kondome kamen zur Sprache, manchmal wurden sogar einige verteilt, falls welche vorhanden waren. Sie merkte, wie schwierig es für sie war, ihr umfangreiches Wissen an die Frauen zu vermitteln, was nicht nur auf Sprachprobleme zurückzuführen war. Sie hatte eine gewisse Scheu, das so drastisch auszudrücken, über den Geschlechtsakt als solches zu reden, dabei war es wichtig. Sie tat es dennoch, mit einer gewissen Überheblichkeit, Schärfe in der Stimme, dass es die Frauen abschreckte. Ständig ließen diese sie stehen. Sie hatte Krankenschwester Karen, ihre Dolmetscherin, deswegen angemeckert, da sie vermutete, dass diese falsch übersetzte, anders konnte, sie es sich nicht erklären.
„Aids, ein äußerst vielschichtiges Gesundheits- und Sozialproblem. Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten des Schutzes sind zunächst wichtiger, als über eine Therapie nachzudenken, zu der uns die Mittel fehlen. Sehr entscheidend ist dabei, die Gleichstellung von Frau und Mann zu vermitteln. Nur Gleichberechtigung ist hier genauso ein Problem, wie überall auf der Welt. Es kann nicht angehen, dass der Mann die Krankheit nach Hause bringt, weil er bei einer Prostituierten gewesen war und seine Frau ansteckt, die ein aidsinfiziertes Kind auf die Welt bringt. Es ist ein schwieriges Unterfangen und die Erfolge kommen nur sehr, sehr spärlich“, wie ihr Ian versicherte.
„Wir klären zwar die Menschen auf, sie richten sich in den seltensten Fällen danach. Die Frauen bekommen trotzdem jedes Jahr ein Kind, die Männer gehen weiterhin zu Prostituierten, stecken sich mit Geschlechtskrankheiten, schlimmstenfalls mit Aids an. Sie kommen nach Hause und schlafen mit ihrer Bibi, natürlich ohne Kondome. Wir haben kostenlos Tausende verteilt. Die Kinder spielten damit. Wenn ich mit den Männern darüber rede, kommt nur die lapidare Ausrede: Haben wir vergessen oder macht keinen Spaß. Sicher macht es weniger Spaß, nur sollen sie monogam leben. Nur das wollen sie nicht. Ein ewiger Kreislauf, man versucht es wieder und wieder“, klärte Ian sie unterwegs auf.
Zuweilen hörte sie bei ihm eine gewisse Resignation heraus, was nur kurz der Fall war. Er war ansonsten ein Typ, der Probleme sofort anfasste, egal in welcher Hinsicht. Selbst für kleine, niedrige Arbeiten war er sich nicht zu schade, packte mit an, wo Not am Mann war, was sie oftmals konsterniert beobachtete. Er hatte das nicht nötig. Das waren keine Arbeiten für einen Arzt. Sie war sich sicher, dass man drastischer mit den Menschen in den Dörfern reden und umgehen musste, damit sie gerade in diesem Punkt lernten, und sie nahm sich vor, das bei den Schwarzen so einzuführen. Man sollte mehr Embryos entfernen, die Frauen nach zwei Geburten sterilisieren. Sie las in ihrem Buch nach, damit sie das in Nyeri so praktizieren konnte. Wenn man eine Abtreibung vornahm, konnte man die Schwarze gleich sterilisieren. Die merkten das ja nicht und es war für alle besser. So wie die hausten, ohne Geld, in dem Dreck, war es unverantwortlich, Kinder in die Welt zu setzen. Ja, es gab in dem Jahr überreichlich für sie zu tun.
Dass ihr Ian an dem Nachmittag gesagt hatte, sie würde in Nairobi bleiben, ignorierte sie. Er würde seine Meinung revidieren, weil sie nochmals deswegen mit ihm sprechen wollte. Es gab unermesslich Arbeit und in so einem kleinen Dorf war bestimmt nur wenig zu tun, zumal es dort einen anderen Arzt gab. So konnte sie sich mehr ausruhen, sich das Land ansehen und die Tiere. Sie wollte in alle Nationalparks, die Serengeti sehen und natürlich den Kilimandscharo. Ach, das Leben würde in den nächsten Monaten herrlich werden, freute sie sich.
*
Erik betrat das hospitali und wenig später das Zimmer von Ian.
„Was gibts?“
„Nyeri ist soweit einsatzbereit. Fährst du am Wochenende nach Hause?“
„Ja, seit Langem einmal wieder. Ich muss nur vorher zur Zentrale, Bilder abholen. Ich will diese Kerle erwischen. Nur sie sind mir permanent einen Schritt voraus. Es ist …“
Es klopfte kurz und schon wurde die Tür aufgerissen.
„Ariane, komm herein. Ich muss mit dir sprechen.“
Erik taxierte sie kurz, während er nach einer Zigarette fischte, die Schachtel Ian zuschob.
„Ariane, das hospitali in Nyeri ist so weit fertig, das dort bereits gearbeitet wird. Ein Teil der Häuser ist bewohnbar, deswegen fährst du am Donnerstag hin. So kannst du dich eingewöhnen, bevor die Regenzeit beginnt. Es wird manches schwieriger, falls sie überhaupt kommt. Susan wird einige Tage später kommen, um unser Haus fertig einzurichten. Bis das so weit ist, werdet ihr bei Erik wohnen. Von dort aus ist es nicht weit zum hospitali.“
„Das mache ich bestimmt nicht.“ Sie guckte Ian aufgebracht an. „Wenn das Haus bezugsfertig ist, kann ich dort wohnen, ohne großartige Möbel. Ich kaufe mir einen Schlafsack. Kein Problem.“
Ian sah schmunzelnd zu Erik, der nur die Augenbrauen nach oben zog.
„Dort hast du es wesentlich bequemer, zumal du nicht einmal Kaffee kochen kannst, da die Häuser nicht eingerichtet sind und die Böden, Küchen komplett fehlen. Das alles dauert noch einige Zeit.“
„Kaffeemaschinen kann man kaufen.“
„Ariane, das ist kindisch und infantil. Ich weiß nicht, was du für ein Problem mit Erik hast, aber das ist nicht Deutschland, wo man so ohne Weiteres auf dem Boden schlafen kann, allein, in einem sich im Bau befindlichen Gebiet und nicht als mke“, erklärte er ihr ein wenig schulmeisterlich. „Du fährst am Donnerstag mit Erik nach Nyeri. Du kannst hinter ihm herfahren und alles transportieren. Nimm einen Nachmittag frei und geh das einkaufen, was du so benötigst, wie Geschirr, Wäsche und andere Kleinigkeiten.“
Sie erhob sich ohne ein weiteres Wort.
„Ich freu mich“, lachte Erik.
„Das könnte eventuell zu früh sein“, dabei warf sie ihm einen bösen Blick zu. „Bilden Sie sich bloß nichts ein, Sie Tölpel.“ Wütend warf sie die Tür zu. Das kann ja lustig werden. Mit diesem Flegel würde sie fertig werden. Er würde bestimmt versuchen, sich an sie heran zuwerfen. Sie würde ihn erst richtig anheizen und danach heftig in die Eier treten. Der würde sich wundern und klein angekrochen kommen. Ein Adonis war er trotzdem, selbst wenn der nur aus dem Busch kam.
„Willst du diese Person wirklich mit nach Nyeri nehmen?“
„Wir haben viel zu wenig Personal und sie ist besser als keine.“
„Die Kizee bringt nur Ärger und sie kann nichts. Sie ist dumm, arrogant, völlig verblödet, hässlich. Eine Putzfrau! Wazimu! Lass die hier und wir haben unsere Ruhe.“
„Hast du neuerdings etwas mit dem hospitali zu tun? Am Anfang fandest du sie hübsch. Eben reiches verwöhntes Töchterchen. Sie erinnert mich an dich. Luxus, etwas darstellen und das auf Kosten von anderen. Du hast ebenfalls eine Putzfrau, dazu zwingst du deine Schwester, den Rest zu erledigen. Spiel dich daher nicht auf“, der Doktor nun sehr kühl.
„So bin ich gewiss nicht. Die ist blöd, überheblich, eingebildet, fett und alt“, konterte er verärgert. „Ist deine Entscheidung. So, ich muss los.“
„Asante!“
„Ist gut. Grüß Susan und die watoto.“
*
Es war dunkel, als sie losfuhren. Bereits am Abend hatte sie ihre Sachen in ihrem und seinen Jeep verstaut. Sie hatte eingekauft, was man für einen Haushalt benötigte und war in heller Vorfreude. Nun würde sie eine vernünftige Wohnmöglichkeit geben, sogar irgendwann mit einem kleinen Garten. Es würde ein neuer Abschnitt ihres Kenya-Aufenthaltes beginnen und das erfüllte sie mit einem Glücksgefühl. Bisher verlief es besser als erwartet und sie hatte keine ernsthaften Schwierigkeiten meistern müssen, mit denen sie gerechnet hatte. Selbst, dass sie eine Frau war, hatte für sie keine negative Auswirkung gezeigt, was sie gelegentlich erstaunte. Sie war nur glücklich. Sie freute sich auf ihre zahlreichen Ausflüge, die ausgiebigen Besuche in den Nationalparks, guten Restaurants und ihre Freizeit.
Sie fuhr hinter ihm her, froh, dass sie nicht neben ihm sitzen musste. Der Verkehr war dicht, laut und sie hatte sich noch nicht daran gewöhnt, dass sie auf der falschen Straßenseite fuhren. Ihr gebrauchter Wagen, den sie bereits mit einigen Defekten und Beulen günstig gekauft hatte, wie sie dachte, war deswegen mit zahlreichen neuen Beulen übersät und sie benötigte bald ein anderes Auto. Dass sie fast das Doppelte, nämlich knapp eine Million Shilingi, etwa 30.000 DM, bezahlt hatte, wusste sie nicht, da sie nie handelte. Mit dem Geld hatte sie generell ihre Probleme. Sie wusste nicht, wie viel DM 1.000 kenyanische Shiling waren. Sie fand alles billig, da sie das sowieso oftmals mit Dirks Kreditkarte bezahlte, war das trivial. Sie hatte stets ein Bündel von diesem Geld dabei, falls es einen Notfall gab.
Nun schaute sie die Landschaft an. Es war trocken und auf den Pflanzen lag ein dicker Staubteppich. Es ging an Agavenplantagen vorbei, aus denen Sisal gewonnen wurde. Es standen Pflanzen am Wegesrand, die sie so nie gesehen hatte, aber sie gefielen ihr. Auf der holprigen Straße war reichlicher Verkehr, daneben unzählige Fahrradfahrer und Menschen, die zu Fuß unterwegs waren. Sie musste ständig hupen, damit diese Leute von der Straße verschwanden. Als deswegen ein Fahrradfahrer hinfiel, lachte sie laut. Diese Neger ein bisschen zu erschrecken fand sie lustig.
In Thika hielten sie vor einem Hotel. Sie sah Erik heranschlendern, betrachtete ihn und war von seinem Äußeren fasziniert.
„Gehen wir frühstücken, Miss Niebert. Noch einmal so eine Aktion, dass Sie andere Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn drängeln und Ihr Führerschein ist weg.“
Sie saßen direkt am Fenster, konnten auf die Straße sehen. Er bestellte ein typisch englisches Frühstück mit Eiern, Speck und Kaffee. Ariane entschied sich für Omelett, Obst und ebenfalls Kaffee.
„Wissen Sie eigentlich, wo Sie gerade sitzen?“ Er zündete eine Zigarette an und musterte sie.
„In einem Hotel, irgendwas mit Blue.“
„Ein bekannter Ort. Er wurde sogar in einem Buch beschrieben.“
„Ach, du kannst lesen?“
Erst war er verblüfft, dann lachte er laut heraus, dass sich einige Gäste nach ihm umdrehten. „Sorry“, nickte er in die Runde. „Das war ein guter Scherz. Sagt Ihnen der Titel Flame Trees of Thika von Elsbeth Huxley etwas?“
Sie schüttelte den Kopf.
„Sie sollten es einmal lesen, da finden Sie einiges über das Blue Posts Inn. Auf dem Hotelgelände befinden sich die Chania Falls, die vor einigen Jahren als Kulisse für einen Film dienten. Haben zwei Flüsse einen Wasserfall gebildet, der Chania und der Thika River, die sich Richtung Küste in den Tana River ergießen. Wir schauen uns das nach dem Frühstück an, damit Sie wenigstens etwas von der Gegend sehen.“
Kaffee wurde serviert. Erik bedankte sich mit einem Lächeln und sie hatte Zeit, ihn zu taxieren. Ebenmäßige sehr weiße Zähne, ein gut gezeichneter Mund. Er hatte dunkelbraune Haare, fast die gleiche Farbe wie seine Augen. Sein Gesicht, seine muskulösen Arme waren braun, was von vielem Aufenthalt in der Sonne zeugte und durch das weiße Shirt betont wurde. Er war sehr groß, einen Kopf größer als sie, schlank. Sie schätzte ihn auf Ende zwanzig. Er rührte in seinem Kaffee und sie sah seine kräftigen Hände, mit schmalen Fingern, sauberen, rundgefeilten Fingernägeln. Er hob die Tasse hoch und ihre Blicke trafen sich, hielten fest, bevor Ariane die Lider senkten. Dieser Mann war ein Adonis und sie stellte sich für Sekunden vor, wie es wohl mit ihm wäre.
„Heutzutage ist Thika für seine weltweit größten Ananasplantagen berühmt und für das Fahrzeugmontagewerk, das Fahrzeuge der britischen Marke Land Rover montiert. Ungefähr zwanzig Kilometer weiter, an der Straße nach Garissa stoßen Sie auf die Fourteen-Falls. Mit vierundzwanzig Metern sind sie nicht sensationell, können besonders nach Regenfällen ziemlich spektakulär aussehen. Nach der Regenzeit sind sie am schönsten, augenblicklich eher langweilig.“
„Du kennst dich gut aus?“
„Tun Sie das in München nicht?“
Sie wurde einer Antwort enthoben, da die Frau das Frühstück servierte. Abermals lächelte er sie an und diese schaute ihn ein weniger länger an, bevor sie, mit leicht wiegenden Hüften, davon schritt.
Ariane musste sich zurückreißen, um nicht laut zu lachen. Dieser Typ war zu eingebildet, aber anscheinend gefiel das den Frauen. Von einer Schwarzen konnte man generell nichts anderes erwarten.
Sie widmete sich dem Frühstück, das köstlich duftete.
Erik hingegen nahm solche Gesten nicht wahr. Er war gedanklich mit den Bildern und Informationen beschäftigt, die er gestern von seinem Boss erhalten hatte. Er war sich sicher, dass dieser miese Kerl dahintersteckte, er konnte es ihm nicht beweisen. Wenn er in Nyeri war, konnte und musste er mehr herausfinden. Er würde mit Jane sprechen. Sie musste einfach mehr wissen und sie würde ihm helfen, egal wie er sie dazu brachte. Notfalls mit Gewalt.
„So nachdenklich?“, schreckte ihre Stimme ihn auf. „Ich versuche, mir das Haus vorzustellen. Wie sieht es aus?“
„Ein Haus, eben. Vor dem Haus sowie an einer Seite eine kleine überdachte Holzveranda, davor kommen irgendwann Blumen, Sträucher, Gras hin. Meistens stellen die Leute dort Stühle, Blumentöpfe auf.“
„Woher weißt du das?“
„Weil ich die Häuser gesehen habe. Entfernter stehen große Akazienbäume, was sehr hübsch aussieht und Schatten spendet. Sie wohnen neben Ndogo, ich meine Doktor Doktor Nteke und dessen Familie, da wären seine Bibi Karubi und der zwei Monate alte Kimani. Daneben wohnt Ian mit Familie. Die beiden Häuser sind größer, haben zwei Räume mehr. Weitere Häuser sind im Bau.“
„Du kennst dich ja sehr gut dort aus.“
„Sicher, ich fahre regelmäßig dort vorbei oder bringe etwas zu Ndogo. Wir sind befreundet. Er ist ein erstklassiger Doktor. Karubi ist Anästhesistin, arbeitet nur in Notfällen, was mindestens zweimal monatlich der Fall ist. Er hat vorher in einem alten Bau die Leute verarztet. Entfernter steht das Haus für Schwestern und ein kleines Haus für anderes Personal.“
„Das ist sehr gut. So kann dort meine Putzfrau wohnen.“
Er glotzte sie an und lachte. „Ihre was?“
„Putzfrau, so was kennst du wahrscheinlich nicht. In deiner Bude wird es entsprechend dreckig aussehen.“
„Sind Sie vorsichtig, was Sie zu mir sagen.“ In Sekundenbruchteil schaute er sie mit kalten, schwarzen Augen an. Die Stimme eiskalt und sie zuckte zusammen.
„Bestimmt nicht! Von so einem lasse ich mir nicht den Mund verbieten. Wohnst du etwa in der Nähe?“
„Etwa drei Kilometer entfernt habe ich ein Haus, das Büro, Lager, Einsatzzentrale und Besprechungsort ist. Sie werden es ja sehen.“
„Ach, ein Haus des KWS? Stellen die dir so etwas zur Verfügung? Du hast Glück, dass du nicht mehr in einer Wellblechbude wohnen musst.“
„Sie haben nicht zugehört. Es gehört mir, sehen wir uns ein wenig um. Ich gehe nur zahlen. Sie können so lange draußen warten.“
„Ich zahle meins selber.“
„Vergessen Sie es. Sie waren eingeladen.“
„Danke, Mister Shrimes.“
Er grinste und ging zu der jungen Frau, während sie hinaus schlenderte.
Die Sonne brannte heiß, gleißend, grell vom Himmel und sie zog ihr Shirt aus, brachte das zu ihrem Auto. Als sie sich umdrehte, sah sie Erik auf sich zukommen.
„Kommen Sie, Miss Niebert, sehen Sie sich das Wasser an.“
Sie schlenderten nebeneinander durch einen Wald.
„Warum arbeitest du bei dem KWS?“
„Weil ich es wollte.“
„Warum?“
„Ich wollte es eben.“
„Eine dumme Antwort“, äußerte sie sich erbost, da er sich nichts Privates entlocken ließ.
„Mag sein. Das ist so bei Leuten, die nicht lesen können. In Kenya gibt es übrigens viele davon. Ein Land, ein Kontinent von Analphabeten. In unserem Land können nur 85 Prozent der Menschen lesen, schreiben, rechnen.“
„Du bist ein arroganter, blöder Kerl. Ein depperter, eingebildeter Wilder.“
„Danke, und du bist eine dumme, arrogante Ziege, die ständig das letzte Wort haben will. Nur nicht alle fallen auf dich herein. Du bist es anscheinend gewöhnt, deinen Willen zu bekommen und wenn nicht, fauchst du. Ich gehöre bestimmt nicht zu der Sorte Mann, dass ich mich einer mke unterordne, das tue, was sie will, was sie erwartet, nur weil sie eine unbedeutende Daktari ist. Du bist wütend auf mich, weil ich dich nicht angehimmelt habe und nun erwartest du von mir, dass ich still und reumütig bin. Pech, ich bin es nicht, werde es nie sein. Nun kannst du dir überlegen, ob du ein bockiges mtoto bist oder eine mke, mit der man reden kann.“
„Für Sie heißt es Frau Doktor Niebert, Herr Shrimes“, giftete sie, worauf er schallend lachte, den Kopf schüttelte. „Wazimu! Ist es in Deutschland nicht strafbar, einen Titel zu führen, den man nicht erworben hat? Angeberin!“
Sie wurde rot, betrachtete daher den Weg, bis sie den Wasserfall erspähte.
Eine Postkartenidylle lag vor ihnen, so wundervoll, so einzigartig, so berauschend. Ringsherum dichtes Gebüsch, hohe Bäume. Man konnte vergessen, dass man sich in Afrika befand, so üppig wucherte die Vegetation. Es roch anders, würzig, fand sie.
„Wie gefällt es der Memsaab?“
„Sehr gut sogar. Danke. Hier müsste man sich darunter stellen und das Wasser über sich fließen lassen.“
„Nach der masika, falls sie kommt, ist das Wasser rötlich gefärbt und es sieht wesentlich spektakulärer aus.“
Ariane hatte seine Anwesenheit vergessen, genoss nur das Panorama, hörte das Tosen des Wassers, die aufschäumende Gischt, die sich wie silberne Sterne gegen den strahlendblauen Himmel abzeichneten. Das war wie im Paradies.
„Mögen Sie afrikanische Kunst?“
„Ja, sehr, wenn es nicht zu kitschig ist.“
„Zeige ich Ihnen etwas. Eventuell finden Sie etwas, das Ihnen gefällt.“
Eine kleine Ansammlung von Rundhütten erwartete sie, in denen Händler Kunsthandwerk ausstellten. Gleich in der ersten Hütte konnte sie sich nicht sattsehen. Es gab zu viele schöne Dinge.
„Das ist Kunst, die die Einheimischen für wenig Geld, mit viel Liebe, fertigen.“
„Hier könnte ich stundenlang stöbern und kaufen. Wo gibt es denn so Sachen aus Elfenbein? Haben die Felle von Leoparden, Geparden oder so? Ich möchte unbedingt welche haben.“
„Wazimu!“ Er sah sie kalt an und irgendwie hatte sie Angst vor ihm, trat einen Schritt beiseite.
„Es gibt weder Elfenbein noch Felle. Sie müssen handeln, sonst zahlen Sie zu viel“, gab er ihr den Tipp, ließ sie allein. Sie erstand zwei große Holzfiguren und einige wunderschöne Teller, auf denen Krieger auf einen dunkelroten, glänzenden Untergrund gemalt waren, bezahlte, ohne zu handeln. Erik schüttelte nur den Kopf, sah das breite Grinsen der beiden Schwarzen. Die Memsaab hatten sie so richtig über den Tisch gezogen. Das Zeug war höchstens ein Fünftel davon Wert.
„Magineti moset ne kagoeet kolany ketit“, sagte er zu einem der Männer.
„Ukosawa!“, amüsierte der sich. So ein gutes Geschäft machte man nur alle paar Monate.