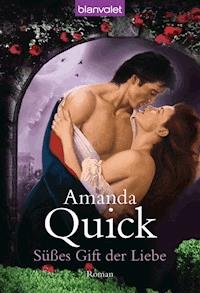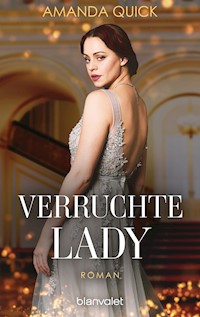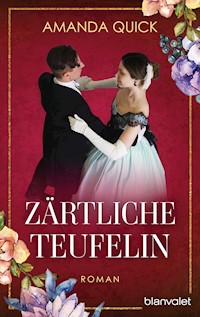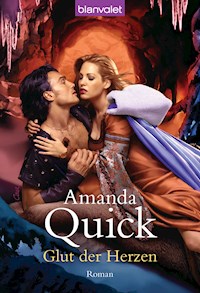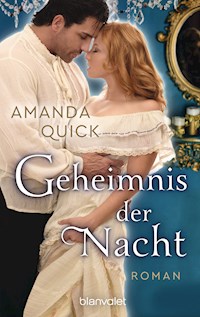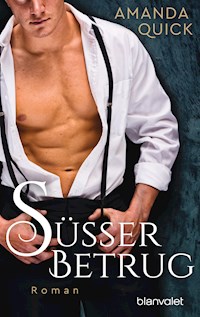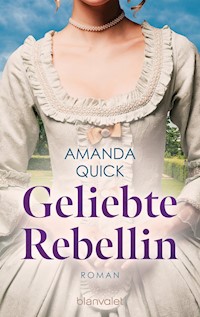
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Sie findet für jede Frau die große Liebe. Nur ihr Herz hält sie fest verschlossen – bis er in ihr Leben tritt …
London, 19. Jahrhundert: Charlotte Arkendale, Heiratsvermittlerin für die besseren Kreise, weiß aus Erfahrung nur zu gut, warum sie Männern gegenüber ihre Skepsis nie ablegt. Doch da wird eine ihrer Klientinnen ermordet, und Charlottes angeborene Neugier treibt sie dazu, dem Verbrechen auf den Grund zu gehen. Wie unangenehm, dass sie dazu die Hilfe des berühmten Chemikers Baxter St. Ives in Anspruch nehmen muss! Und dass zur Tarnung auch noch eine Verlobung notwendig wird …
Leidenschaftlich, atmosphärisch und spannend bis zur letzten Seite – perfekter Schmökerstoff für alle Fans der Erfolgsserie »Bridgerton«!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
London, 19. Jahrhundert: Charlotte Arkendale, Heiratsvermittlerin für die besseren Kreise, weiß aus Erfahrung nur zu gut, warum sie Männern gegenüber ihre Skepsis nie ablegt. Doch da wird eine ihrer Klientinnen ermordet, und Charlottes angeborene Neugier treibt sie dazu, dem Verbrechen auf den Grund zu gehen. Wie unangenehm, dass sie dazu die Hilfe des berühmten Chemikers Baxter St. Ives in Anspruch nehmen muss! Und dass zur Tarnung auch noch eine Verlobung notwendig wird …
Autorin
Amanda Quick ist das Pseudonym der erfolgreichen, vielfach preisgekrönten Autorin Jayne Ann Krentz. Krentz hat Geschichte und Literaturwissenschaften studiert und lange als Bibliothekarin gearbeitet, bevor sie ihr Talent zum Schreiben entdeckte. Sie ist verheiratet und lebt in Seattle.
Von Amanda Quick bereits erschienen (Auswahl)
Süßer Betrug · Geheimnis der Nacht · Liebe um Mitternacht · Verführung im Mondlicht · Verzaubertes Verlangen · Riskante Nächte · Dieb meines Herzens · Süßes Gift der Liebe · Glut der Herzen · Ungezähmte Leidenschaft · Gefährliche Küsse · Zärtliche Teufelin · Geliebte Rebellin · Liebe Ohne Skrupel · Verführung · Verlangen · Verruchte Lady
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet
Amanda Quick
Geliebte Rebellin
Roman
Deutsch von Uschi Gnade
Die Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Affair« bei bei Bantam Books, a division of Random House Inc., New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright dieser Ausgabe © 2021 by Blanvalet, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 1997 by Jane A. Krentz
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 by Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Buchgewand Coverdesign | www.buch-gewand.de unter Verwendung von Motiven von depositphotos.com: ©DaLiu, ©HayDmitriy, ©marchello74
DK · Herstellung: at
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN978-3-641-29126-6V001
www.blanvalet.de
Prolog
Mitternacht London
Charlotte sollte nie erfahren, was sie in den frühen Morgenstunden vor Anbruch der Dämmerung geweckt hatte. Vielleicht hatte ihr Unterbewusstsein im Schlaf das Quietschen einer Bodendiele oder die gedämpfte Stimme eines Mannes wahrgenommen. Ganz gleich, was auch immer die Ursache gewesen sein mochte, sie öffnete abrupt die Augen und setzte sich in ihrem Bett auf. Eine unerklärliche Unruhe überfiel sie, und ihr Körper war von einer bösen Vorahnung erfüllt. Die Haushälterin hatte ihren freien Abend. Winterbourne, ihr Stiefvater, kam derzeit nie vor dem Morgengrauen nach Hause. Charlotte wusste, dass sie und ihre Schwester Ariel allein im Haus waren.
Aber gerade eben war jemand die Treppe heraufgekommen und über den Gang gelaufen.
Charlotte schlug die Decken zur Seite und stand auf. Einen Moment lang hatte sie nicht die leiseste Ahnung, was sie als Nächstes tun sollte.
Wieder ächzte eine Bodendiele.
Sie ging zur Tür, öffnete sie einen Spaltbreit und blickte den dunklen Korridor hinunter. Zwei Gestalten, die in lange, weite Mäntel gehüllt waren, standen im Schatten am Ende des Flurs vor Ariels Tür.
Einer der Männer hielt eine Kerze in der Hand. Der Lichtschein fiel auf Winterbournes schwammiges verlebtes Gesicht.
»Machen Sie schnell«, sagte Winterbourne, und seine Worte waren nur ein gepresstes Murren. »Und dann verschwinden Sie. Es dämmert schon bald.«
»Aber ich will dieses seltene Vergnügen in aller Ruhe auskosten. Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass sich einem die Gelegenheit bietet, in den Genuss einer echten Jungfrau von derart hervorragender Abstammung zu kommen. Vierzehn, sagten Sie? Ein gutes Alter. Ich gedenke, mir Zeit zu lassen, Winterbourne.«
Charlotte unterdrückte einen erzürnten und furchtsamen Aufschrei. Die Stimme des zweiten Mannes klang wie ein geheimnisvoll gespieltes Musikinstrument und selbst dann noch voller Anmut und Eindringlichkeit, wenn sie zu einem Flüstern gedämpft war. Es war eine Stimme, die wilde Tiere beschwichtigen oder Choräle hätte singen können, und doch hatte Charlotte nie einen grauenerregenderen Klang gehört.
»Sind Sie wahnsinnig geworden?«, zischte Winterbourne.
»Eilen Sie sich, und sehen Sie zu, dass Sie es schnell hinter sich bringen.«
»Sie schulden mir eine ganze Menge Geld, Winterbourne. Sie rechnen doch gewiss nicht damit, Ihre Schulden begleichen zu können, indem Sie mir nicht mehr als ein paar Minuten mit meinem sehr teuer bezahlten kleinen Unschuldslamm zubilligen. Ich will mir mindestens eine volle Stunde Zeit dafür nehmen.«
»Das ist völlig ausgeschlossen«, murmelte Winterbourne.
»Das ältere Mädchen hat sein Zimmer am anderen Ende dieses Ganges. Sie ist die reinste Hexe. Absolut unbezähmbar, mit ihr kann niemand fertigwerden. Und wenn sie wach wird, ist nicht abzusehen, was sie unternehmen wird.«
»Das ist Ihr Problem und nicht meines. Schließlich sind Sie der Herr in diesem Haus, oder etwa nicht? Ich überlasse es Ihnen, sie mir vom Hals zu halten.«
»Und was, zum Teufel, erwarten Sie von mir für den Fall, dass Sie das Mädchen wecken sollten?«
»Schließen Sie sie in ihrem Zimmer ein. Fesseln Sie sie. Stecken Sie ihr einen Knebel in den Mund. Schlagen Sie sie bewusstlos. Mir ist es egal, wie Sie diese Angelegenheit handhaben, solange Sie nur dafür sorgen, dass mein Genuss nicht beeinträchtigt wird.«
Charlotte schloss lautlos ihre Schlafzimmertür, lehnte sich dagegen und sah sich mit wilden Blicken in ihrem mondhellen Zimmer um. Sie holte tief Luft, um die Panik abzuschütteln und ihren klaren Verstand wiederzufinden, und dann eilte sie über den Teppich zu einer Truhe, die dicht am Fenster stand.
Sie rüttelte an dem Verschluss der Truhe, bis es ihr gelang, den Deckel zu öffnen und die beiden Decken herauszuziehen, die obenauf lagen. Der kleine Koffer, der die Pistole ihres Vaters enthielt, lag ganz unten auf dem Boden der Truhe.
Charlotte hob den Koffer aus der Truhe. Sie legte ihn auf ihr Bett, öffnete ihn mit zitternden Fingern und zog die schwere Waffe heraus. Sie war nicht geladen. Daran ließ sich im Moment nichts ändern. Es fehlte ihr nicht nur an dem notwendigen Schießpulver und einer Kugel, sondern sie hatte jetzt auch keine Zeit dahinterzukommen, wie man die Pistole laden musste.
Sie ging zur Tür, riss sie weit auf und trat in den Flur hinaus. Ihr war klar, dass der Fremde, der Ariel vergewaltigen wollte, der gefährlichere der beiden Männer war. Sie ahnte auch, dass jedes Anzeichen, das auf Angst oder Unsicherheit ihrerseits schließen ließ, ihn ermutigen würde, ganz zu schweigen von ihrer Panik, die sie sich jedoch unter gar keinen Umständen anmerken lassen durfte.
»Schluss jetzt, und zwar sofort, oder ich schieße«, sagte Charlotte mit ruhiger Stimme.
Winterbourne taumelte vor Erstaunen. Die Flamme der Kerze in seiner Hand ließ deutlich erkennen, dass sein Mund offenstand. »Der Teufel soll dich holen, Charlotte.«
Der zweite Mann drehte sich wesentlich langsamer zu ihr um. Sein weiter Mantel schwang mit einem leisen raschelnden Geräusch um ihn herum. Der matte Schein von Winterbournes Kerze erreichte ihn nicht. Er hatte den Hut nicht abgesetzt. Die breite Krempe und der hochgestellte Mantelkragen tauchten sein Gesicht in einen tiefen Schatten.
»Ah«, murmelte er. »Vermutlich handelt es sich hierbei um die ältere Schwester?«
Charlotte stand nun direkt im hellen Mondschein, der von ihrem Fenster aus durch die offene Tür flutete. Der Fremde konnte die Silhouette ihres Körpers sehen, die sich durch ihr weißes Leinennachthemd abzeichnete.
Sie wünschte sich von ganzem Herzen, die Pistole, die sie in der Hand hielt, sei mit einer schweren Ladung gefüllt. Nie in ihrem ganzen Leben hatte sie jemanden so sehr gehasst, wie sie diesen Mann in ebendiesem Augenblick hasste. Und sie hatte sich auch noch nie so sehr gefürchtet.
Einen Moment lang drohte ihre Phantasie, ihren Verstand außer Kraft zu setzen. Tief in ihrem Innern machte sich die Überzeugung breit, dass sie es hier nicht etwa mit einem Menschen zu tun hatte, sondern mit einem Ungeheuer.
Charlotte schwieg, schlang beide Hände um den Griff der Pistole, hob sie hoch und peilte mit größter Genauigkeit ihr Ziel an, als sei die Waffe wirklich geladen. Dann spannte sie den Hahn. Das unverwechselbare Geräusch hallte laut durch den stillen Flur.
»Verdammt noch mal, Mädchen, hast du den Verstand verloren?« Winterbourne sprang mit einem Satz auf sie zu und blieb dicht vor ihr stehen. »Leg die Pistole weg.«
»Verschwindet.« Charlotte ließ nicht zu, dass der Lauf der Waffe schwankte. Ihre Aufmerksamkeit galt voll und ganz dem Ungeheuer in dem schwarzen Mantel. »Und zwar alle beide. Jetzt sofort.«
»Ich glaube tatsächlich, sie hat vor abzudrücken, Winterbourne.« Die liebliche Stimme des Ungeheuers war voller Gehässigkeit und einem furchteinflößenden Maß an Belustigung.
»Das würde sie nicht wagen.« Dennoch wich Winterbourne einen Schritt zurück. »Charlotte, hör mir zu. Du kannst nicht so dumm sein, dir einzubilden, du könntest mir nichts, dir nichts einen Mann kaltblütig erschießen. Dafür wird man dich hängen.«
»Von mir aus.« Die Pistole lag fest in Charlottes Händen.
»Kommen Sie, Winterbourne«, sagte das Ungeheuer leise.
»Lassen Sie uns von hier verschwinden. Die Kleine hat im Ernst vor, einem von uns eine Kugel in den Leib zu jagen, und ich habe den Eindruck, dass sie mich als ihr Opfer auserkoren hat. Keine Jungfrau auf Erden ist es wert, sich so viel Ärger einzuhandeln.«
»Aber was ist mit meinen Schuldscheinen?«, fragte Winterbourne mit bebender Stimme. »Sie haben versprochen, Sie würden sie mir zurückgeben, wenn ich Ihnen das jüngere der beiden Mädchen überlasse.«
»Es scheint ganz so, als müssten Sie sich etwas anderes einfallen lassen, um Ihre Schulden zu begleichen.«
»Aber mir stehen keine anderen Mittel zur Verfügung, Sir.« Winterbournes Stimme klang verzweifelt. »Ich habe nichts mehr zu verkaufen, was genug einbrächte, um meine Verluste zu decken und meine Schulden bei Ihnen zu bezahlen. Der Schmuck meiner Frau ist bereits fort. Nur ein kleiner Teil des Tafelsilbers ist mir noch geblieben. Und dieses Haus gehört mir nicht. Ich habe es lediglich gemietet.«
»Ich bin ganz sicher, dass Ihnen etwas einfallen wird, wie Sie mich entschädigen können.« Das Ungeheuer ging langsam zur Treppe und ließ Charlotte keinen Moment lang aus den Augen. »Aber sorgen Sie dafür, dass mir die Notwendigkeit erspart bleibt, mich mit einem Racheengel anzulegen, der eine Pistole in den Händen hält, wenn ich meine Bezahlung erhalten soll.«
Charlotte hielt die Pistole weiterhin auf den Fremden gerichtet, als er die Treppe hinunterlief. Da er den Schein von Winterbournes Kerze sorgsam gemieden hatte, war es ihm die ganze Zeit gelungen, in Dunkelheit gehüllt zu bleiben. Charlotte beugte sich über das Treppengeländer und sah zu, wie er die Haustür öffnete.
Zu ihrem Entsetzen blieb er noch einmal stehen und blickte zu ihr herauf. »Glauben Sie an die Macht des Schicksals, Miss Arkendale?« Seine Stimme klang aus der Dunkelheit zu ihr herauf.
»Mit solchen Angelegenheiten gebe ich mich nicht ab.«
»Das ist ein Jammer. Wenn man bedenkt, was für einen grandiosen Beweis Sie gerade dafür geliefert haben, dass Sie zu den wenigen Menschen zählen, in deren Macht es steht, ihr Los selbst in die Hand zu nehmen, dann sollten Sie diesem Thema wirklich mehr Aufmerksamkeit widmen.«
»Verlassen Sie dieses Haus.«
»Leben Sie wohl, Miss Arkendale. Es ist sehr amüsant gewesen, um es zurückhaltend auszudrücken.« Der weite Mantel schwang noch ein letztes Mal um ihn herum, und dann war das Ungeheuer verschwunden.
Charlotte bekam endlich wieder Luft. Sie drehte sich zu Winterbourne um.
»Und Sie werden jetzt ebenfalls verschwinden, Sir. Verlassen Sie das Haus, oder ich schieße.«
Sein schwammiges Gesicht geriet in heftige Bewegung.
»Ist dir überhaupt klar, was du angerichtet hast, du dummes Biest? Ich schulde diesem Kerl ein verdammtes Vermögen.«
»Mich interessiert nicht, wie viel Sie an ihn verloren haben. Er ist ein Ungeheuer, und Sie sind ein Mann, der einer Bestie ein unschuldiges Kind zum Fraß vorwerfen würde. Das macht auch Sie zu einem Ungeheuer. Raus jetzt.«
»Du kannst mich nicht einfach aus meinem eigenen Haus vertreiben.«
»Genau das beabsichtige ich. Gehen Sie, oder ich schieße. Ich rate Ihnen, meine Worte nicht in Zweifel zu ziehen, Winterbourne.«
»Um Himmels willen, ich bin dein Stiefvater.«
»Sie sind ein heruntergekommener, verabscheuungswürdiger Lügner. Und außerdem sind Sie ein Dieb. Sie haben die Erbschaft gestohlen, die mein Vater Ariel und mir hinterlassen hat, und Sie hatten nichts Besseres zu tun, als unser Geld in Spielhöllen zu tragen. Glauben Sie etwa, nach allem, was Sie uns angetan haben, könnten Sie auf meine Loyalität setzen? Wenn Sie das tatsächlich meinen, müssen Sie wahnsinnig sein.«
Winterbourne geriet in Wut. »Dieses Geld ist an mich übergegangen, als ich deine Mutter geheiratet habe.«
»Verlassen Sie dieses Haus.«
»Charlotte, warte. Du hast die Situation nicht erfasst. Mit diesem Mann, der gerade fortgegangen ist, ist nicht zu spaßen. Er hat verlangt, dass ich meine Spielschulden noch heute Nacht bezahle. Ich muss diese Angelegenheit unbedingt regeln. Ich weiß nicht, was er tun wird, wenn es mir nicht gelingt.«
»Verschwinden Sie.«
Winterbourne machte den Mund auf und schloss ihn dann sofort wieder. Er starrte die Pistole an und hastete mit einem gepeinigten Ächzen zur Treppe. Er umklammerte das Treppengeländer, als er die Stufen hinabtaumelte, durchquerte die Eingangshalle und lief zur Tür hinaus.
Charlotte verharrte stocksteif im Schatten auf dem oberen Treppenabsatz, bis sich die Tür hinter Winterbourne geschlossen hatte. Sie atmete mehrmals tief durch und ließ langsam die Pistole sinken.
Einen Moment lang schien die Welt um sie herum zu schwanken und sich im Kreis zu drehen. Die Geräusche von Kutschen, die mit klappernden Rädern durch die Straße holperten, klangen fern und unwirklich. Die vertrauten Umrisse der Eingangshalle und der Treppe wirkten mit einem Mal sehr gespenstisch auf Charlotte.
Ariels Tür am Ende des Korridors öffnete sich. »Charlotte? Ich habe Stimmen gehört. Ist alles in Ordnung mit dir?«
»Ja.« Charlotte presste die ungeladene Pistole an ihre Seite, damit ihre Schwester sie nicht sehen konnte. Sie drehte sich langsam um und zwang sich zu einem zittrigen Lächeln.
»Ja, es ist alles in Ordnung, Ariel. Mir fehlt nichts. Winterbourne ist wie üblich betrunken nach Hause gekommen. Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung. Aber jetzt ist er wieder aus dem Haus gegangen. Heute Nacht wird er nicht noch einmal zurückkommen.«
Ariel schwieg einen Moment. »Ich wünschte, Mama wäre noch da. Manchmal fürchte ich mich sehr in diesem Haus.« Charlotte spürte, wie Tränen in ihren Augen brannten.
»Ich fürchte mich auch manchmal, Ariel. Aber wir werden schon bald frei sein. Oder, genauer gesagt, wir werden morgen die Postkutsche nach Yorkshire nehmen.«
Sie eilte auf ihre Schwester zu und schlang einen Arm um sie. Die Pistole verbarg sie in den Falten ihres Nachthemds. Das kalte Eisen fühlte sich auf ihrem Oberschenkel heiß an.
»Dann hast du also das letzte Silber und den Rest von Mamas Schmuck verkauft?«, fragte Ariel.
»Ja. Das Teetablett habe ich gestern versetzt. Jetzt ist nichts mehr übrig.«
In dem Jahr seit dem vorzeitigen Tod ihrer Mutter, die bei einem Reitunfall ums Leben gekommen war, hatte Winterbourne die wertvollsten Stücke aus der Sammlung des Familienschmucks der Arkendales und die meisten größeren Gegenstände aus Silber verkauft, um seine wachsenden Spielschulden zu bezahlen.
Als sie begriffen hatte, was hier geschah, hatte Charlotte heimlich diverse kleine Ringe und Broschen und einen Anhänger an sich gebracht. Auch Teile des silbernen Teeservices hatte sie zur Seite geschafft, und im Lauf der letzten Monate hatte sie diese Gegenstände unauffällig verpfändet.
Winterbourne kam meist in angetrunkenem Zustand nach Hause, sodass er noch nicht einmal merkte, wie viele Wertgegenstände aus dem Haushalt verschwunden waren. Wenn ihm gelegentlich doch auffiel, dass etwas fehlte, teilte Charlotte ihm mit, er persönlich hätte die betreffenden Gegenstände im Suff versetzt.
Ariel blickte auf. »Glaubst du, dass es uns in Yorkshire gefallen wird?«
»Es wird sehr schön dort sein. Wir werden uns ein kleines Häuschen suchen und es mieten.«
»Aber wovon sollen wir leben?« Sogar im zarten Alter von vierzehn Jahren hatte Ariel bereits eine erstaunlich praktische Art. »Das Geld, das du für Mamas Sachen bekommen hast, wird nicht lange reichen.«
Charlotte umarmte sie. »Mach dir bitte keine Sorgen. Mir wird schon etwas einfallen, um uns beide durchzubringen.« Ariel zog die Stirn in Falten. »Du wirst doch nicht etwa gezwungen sein, dich als Gouvernante zu verdingen? Du weißt doch selbst, wie übel die Damen dran sind, die diese Laufbahn einschlagen. Niemand bezahlt sie besonders gut, und oft werden sie schlecht behandelt. Und wenn du dich von jemandem in seine Dienste nehmen lässt, kann ich wahrscheinlich nicht mit dir dort einziehen.«
»Du kannst ganz sicher sein, dass ich eine andere Möglichkeit finden werde, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen«, versicherte ihr Charlotte.
Es war allgemein bekannt, dass das Los einer Gouvernante nicht gerade erfreulich war. Zu den niedrigen Löhnen und der demütigenden Behandlung kamen noch die Männer des jeweiligen Haushalts dazu, die in Gouvernanten eine leichte Beute sahen.
Es musste eine andere Möglichkeit geben, wie sie sich durchschlagen konnten, sagte sich Charlotte.
Aber schon am nächsten Morgen hatte sich ihre Situation grundlegend verändert.
Lord Winterbourne war mit aufgeschlitzter Kehle aus der Themse gefischt worden, und man ging davon aus, dass er einem Wegelagerer zum Opfer gefallen war.
Es gab jetzt keinen Grund mehr, nach Yorkshire zu fliehen, aber es bestand noch immer die Notwendigkeit, sich etwas zu suchen, womit sie ihren Unterhalt finanzieren konnten. Daher war es unbedingt erforderlich, dass Charlotte einen Beruf fand.
Sie nahm die Neuigkeiten über Winterbournes Tod mit großer Erleichterung auf. Aber sie wusste auch, dass sie niemals das Ungeheuer mit der faszinierend schönen Stimme vergessen würde, dem sie im Flur begegnet war.
Mitternacht an der italienischen Küste, zwei Jahre später
»Dann hast du dich also doch noch entschlossen, mich reinzulegen. Du willst mich verraten.« Morgan Judd stand in der Tür des alten steinernen Verlieses, das ihm als Laboratorium diente. »Was für ein Jammer. Dabei haben wir beide doch so viel miteinander gemeinsam, du und ich, St. Ives. Wir hätten ein Bündnis schmieden können, das uns beiden zu unerhörtem Reichtum und enormer Macht verholfen hätte. Welche Vergeudung angesichts dieser glorreichen Aussichten. Aber andererseits glaubst du ja nicht an die Macht des Schicksals, stimmt’s?«
Baxter St. Ives’ Finger umklammerten das Notizbuch, das er gerade entdeckt hatte. Die Angaben, die darin standen, reichten aus, um Morgan zu vernichten. Er drehte sich zu ihm um.
Frauen waren von Judds Aussehen fasziniert. Sein schwarzes Haar war von Natur aus gelockt und verlieh ihm das lässig elegante Aussehen der romantischen Dichter, die zurzeit groß in Mode waren. Es umrahmte eine hohe, intelligente Stirn und Augen, die das undenkbare Blau von Gletschereis aufwiesen.
Morgans Stimme hätte Luzifer persönlich gehören können. Es war die Stimme eines Mannes, der in Oxford im Chor gesungen, gebannten Zuhörern Gedichte vorgelesen und Damen der besseren Gesellschaft in sein Bett gelockt hatte. Es war eine volltönende dunkle Stimme, die einen mitriss, eine Stimme, in der subtile Zweideutigkeiten und unausgesprochene Versprechen mitschwangen. Es war eine Stimme voller Eindringlichkeit und Glut, und Morgan setzte sie – wie alles andere und jeden anderen – dafür ein, seine eigenen Ziele zu erreichen.
Das Blut, das in seinen Adern floss, war so blau wie das Eis in seinen Augen. Er war der Sprössling einer der höchstgestellten adeligen Familien in ganz England. Aber sein elegantes aristokratisches Gebaren verleugnete die wahren Umstände seiner Geburt.
Morgan Judd war ein uneheliches Kind, ein Bastard. Diese Tatsache, da hatte Baxter tatsächlich recht, war eine der wenigen Gemeinsamkeiten zwischen beiden. Der zweite Punkt war die Faszination, die die Chemie auf beide ausübte. Letzteres hatte diese mitternächtliche Auseinandersetzung herbeigeführt.
»Das Schicksal ist etwas für romantische Dichter und die Autoren von Romanen.« Baxter drückte sich die Goldrandbrille fester auf die Nase. »Ich habe mich den Naturwissenschaften verschrieben. An diesem metaphysischen Unsinn fehlt mir jegliches Interesse. Ich weiß jedoch, dass es einem Menschen möglich ist, seine Seele an den Teufel zu verkaufen. Und genau das hast du getan. Warum, Morgan?«
»Ich nehme an, du sprichst von dem Abkommen, das ich mit Napoleon geschlossen habe.« Morgans sinnlicher Mund verzog sich zu einem kalten belustigten Lächeln.
Er ging zwei Schritte in das düstere Verlies und blieb dann stehen. Die Art, wie die Falten seines schwarzen Umhangs um den oberen Rand seiner blankpolierten Stiefel schwangen, ließ Baxter unwillkürlich an die Flügel eines großen Raubvogels denken.
»Ja«, sagte Baxter, »von diesem Geschäft spreche ich.«
»Meine Entscheidung ist alles andere als geheimnisvoll. Ich tue einfach nur das, was getan werden muss, damit sich mein Los erfüllt und ich mich selbst verwirklichen kann.«
»Du würdest dein eigenes Land verraten, weil du von dieser irrsinnigen Vorstellung eines glorreichen Schicksals besessen bist?«
»Ich bin England nichts schuldig, und du schuldest diesem Land ebenso wenig. Es wird von Gesetzen und ungeschriebenen gesellschaftlichen Regeln beherrscht, die es geistig überlegenen Männern wie dir und mir verbieten, den Platz einzunehmen, der uns in der natürlichen Ordnung der Dinge rechtmäßig zusteht.« Morgans Augen funkelten im Kerzenschein. Bitterer Zorn ließ seine Stimme knistern. »Es ist noch nicht zu spät, Baxter. Mach mit. Schließ dich meinem Unterfangen an.«
Baxter hielt das Notizbuch hoch. »Du willst, dass ich dir dabei helfe, die Formel für dieses grässliche chemische Gebräu zu finden, damit Napoleon es als Waffe gegen unsere eigenen Landsleute einsetzen kann? Du musst wirklich vollkommen wahnsinnig sein.«
»Ich bin keineswegs wahnsinnig, aber du bist ganz entschieden ein Narr.« Morgan zog eine Pistole aus den weiten Falten seines schwarzen Umhangs. »Und du bist trotz deiner Brille blind, wenn du nicht selbst sehen kannst, dass Napoleon richtungweisend für die Zukunft ist.«
Baxter schüttelte den Kopf. »Er hat versucht, zu viel Macht an sich zu reißen, und das wird zu seinem Untergang führen.«
»Dieser Mann hat begriffen, dass große Schicksale von denjenigen geschmiedet werden, die den Willen und den Intellekt besitzen, sie zu formen. Hinzu kommt, dass dieser Mann an den Fortschritt glaubt. Er ist derzeit der einzige Herrscher in ganz Europa, der sich über den potentiellen Wert der Wissenschaft wahrhaft im Klaren ist.«
»Mir ist durchaus bewusst, dass er einigen Leuten große Summen zur Verfügung gestellt hat, um auf dem Gebiet der Physik und der Chemie und dergleichen zu experimentieren.« Baxter blickte auf die Pistole in Morgans Hand. »Aber er wird das, was du hier in diesem Laboratorium produzierst, dafür einsetzen, den Krieg zu gewinnen. Engländer werden eines grausamen Todes sterben, wenn du erfolgreich große Mengen tödlicher Dämpfe herstellst. Bedeutet dir das denn gar nichts?«
Morgan lachte. Das Geräusch hatte die tiefe Resonanz einer großen Glocke, die sehr behutsam geläutet wird.
»Nein, nicht das Geringste.«
»Hast du nicht nur deine eigene Ehre, sondern auch das Land, in dem du geboren bist, der Hölle verschrieben?«
»St. Ives, du überraschst mich. Wann wirst du endlich lernen, dass die Ehre eine Sportart ist, ein Zeitvertreib zur Belustigung jener Männer, die auf dem richtigen Bettlaken gezeugt worden sind?«
»In dem Punkt bin ich nicht deiner Meinung.« Baxter setzte seine Brille ab und begann, die Gläser mit seinem Taschentuch zu polieren. »Ehre ist etwas, was für jeden gilt, und jeder kann sie nach seinen eigenen Vorstellungen definieren.« Er verzog den Mund zu einem Lächeln. »Das widerspricht noch nicht einmal deiner eigenen Vorstellung vom Schicksal, wenn du es dir genau überlegst.«
Blanker Hohn und eiskalte Wut ließen Morgans Augen härter werden. »Die Ehre ist etwas für Männer, die Macht und Reichtum schlichtweg deshalb in die Wiege gelegt bekommen, weil ihre Mütter den gesunden Menschenverstand besessen haben, einen Ehevertrag zu bekommen, ehe sie die Schenkel spreizen. Das ist etwas für Männer wie unsere hochwohlgeborenen und angesehenen Väter, die ihren Titel und ihren Grundbesitz ihren ehelichen Söhnen vermachen und ihre unehelichen Kinder mit leeren Händen dastehen lassen. Für unsereinen gilt das nicht.«
»Weißt du eigentlich, was deine entscheidende Charakterschwäche ist, Morgan?« Baxter setzte seine Brille mit größter Behutsamkeit wieder auf. »Du gestattest es dir, bei gewissen Themen unsachlich zu werden. Heftige Gefühle zählen nicht zu den Charaktereigenschaften, die einem Chemiker bei seiner Arbeit förderlich sind.«
»Der Teufel soll dich holen, St. Ives.« Morgans Hand umfasste den Griff der Pistole fester. »Ich habe genug von deinen außerordentlich langweiligen und übermäßig stumpfsinnigen Predigten. Dein größter Makel besteht darin, dass es dir an Durchsetzungsvermögen und an der waghalsigen Natur fehlt, die eine unumgängliche Voraussetzung dafür sind, dein eigenes Schicksal zu verändern.«
Baxter zuckte die Achseln. »Wenn es so etwas wie ein Schicksal gibt, dann nehme ich an, meines wird so aussehen, dass ich bis zum Tage meines Ablebens ein unglaublicher Langweiler sein werde.«
»Ich fürchte, dieser Tag ist jetzt gekommen. Es mag zwar sein, dass du mir nicht glaubst, aber ich bedaure es tatsächlich, dass sich die Notwendigkeit ergeben hat, dich zu töten. Du bist einer der wenigen Männer in ganz Europa, der die Brillanz meiner Errungenschaften hätte würdigen können. Es ist ein Jammer, dass du nicht mehr am Leben sein wirst und nicht mehr zusehen kannst, wie sich mein Schicksal entwickelt.«
»Das Schicksal! Ist es noch zu fassen? Was für ein Haufen Blödsinn. Ich muss dir schon sagen, diese Besessenheit vom Metaphysischen und vom Okkulten ist ein weiterer beklagenswerter Charakterzug für einen Naturwissenschaftler. Früher einmal sind diese Dinge nur ein amüsanter Zeitvertreib für dich gewesen. Wann hast du begonnen, diesem Blödsinn wirklich Glauben zu schenken?«
»Du bist ein Dummkopf.« Morgan peilte mit größter Präzision sein Ziel an und spannte den Hahn.
Baxter starrte fassungslos auf den Revolverlauf. Er hatte nichts mehr zu verlieren. In seiner Verzweiflung packte er den schweren Kerzenständer. Er warf ihn mitsamt der brennenden Kerze auf die nächstbeste Werkbank, auf der sich alles Mögliche zu einem unordentlichen Stapel türmte.
Der eiserne Kerzenhalter prallte gegen ein Glasröhrchen, das augenblicklich zerbarst. Die blassgrüne Flüssigkeit spritzte über die Werkbank, floss in die Flamme, entzündete sich im nächsten Moment mit einem Zischen und loderte bedrohlich hell auf.
»Nein«, schrie Morgan panisch. »Der Teufel soll dich holen, St. Ives.«
Er gab einen Schuss ab, aber seine Aufmerksamkeit galt dem Feuer, das sich immer weiter ausbreitete, und nicht seinem Ziel. Die Kugel schlug in das Sprossenfenster hinter Baxter. Eine der kleinen Scheiben zerbrach. Baxter rannte mit dem Notizbuch in der Hand auf die Tür zu.
»Wie kannst du es wagen, dich meinen Plänen in den Weg zu stellen?« Morgan nahm ein grünes Glasfläschchen von einem Regal und drehte sich sofort wieder um, um Baxter den Weg abzuschneiden. »Du verdammter Narr. Du kannst mich nicht aufhalten.«
»Das Feuer breitet sich schnell aus. Um Gottes willen, lauf los.«
Morgan missachtete Baxters Warnung. Sein Gesicht war vor Wut verzerrt, als er seinem früheren Freund das grüne Fläschchen entgegenschleuderte, damit ihn die Flüssigkeit traf.
Baxter riss instinktiv einen Arm vors Gesicht. Dann wandte er sich eilig ab. Die Säure traf seine Schulter und seinen Rücken. Im ersten Moment spürte er nur ein merkwürdig kaltes Gefühl. Es war, als sei er mit Wasser übergossen worden. Aber schon im nächsten Augenblick hatten die Chemikalien sein Leinenhemd zerstört und fraßen sich in seine bloße Haut.
Schmerz durchzuckte ihn, ein glühend heißer Pfeil, der sich in seine Haut bohrte und ihm die Sinne zu rauben drohte. Er zwang sich, seine Gedanken nur noch auf seine Flucht zu richten.
In dem steinernen Verlies breitete sich das Feuer schnell aus. Eine dichte, übelriechende Rauchwolke breitete sich aus, als weitere Glasgefäße zersprangen und ihr Inhalt sich in die Flammen ergoss.
Morgan sprang mit einem Satz zu einer Schublade, zog sie auf und holte eine zweite Pistole heraus. Er drehte sich zu Baxter um und kniff die Augen zusammen, um durch die immer dichter werdende Rauchwolke die Waffe erneut auf ihn zu richten.
Baxter hatte das Gefühl, ihm würde die Haut in Streifen vom Leib gezogen. Durch den Schleier, den der Rauch und der Schmerz vor seine Augen zogen, konnte er gerade noch sehen, dass der Weg zur Tür bereits von mannshohen Flammen versperrt war. In dieser Richtung gab es kein Entkommen.
Er nahm Anlauf und trat mit dem Stiefel gegen die schwere Luftumwälzungsanlage. Sie fiel um und kippte gegen Morgans rechtes Bein.
»Der Teufel soll dich holen.« Morgan wankte zur Seite, und sank auf die Knie. Die Pistole fiel auf den Steinboden.
Baxter rannte zum Fenster. Die durchlöcherten Reste seines verätzten Hemdes hingen an ihm herab. Er erreichte das breite steinerne Fenstersims und warf einen Blick in die Tiefe. Unter ihm tobte das aufgewühlte brodelnde Meer. In dem silbernen Schein der schmalen Mondsichel konnte er die wilde Brandung deutlich erkennen. Sie brach sich an den Felsen, die das Fundament des alten Schlosses bildeten.
Ein donnernder Schuss löste sich aus der Pistole.
Baxter stürzte sich hinunter in das dunkle Gewässer. Eine Reihe von heftigen Explosionen hallte durch die Nacht, während er wie ein Stein in die Tiefe fiel.
Der Aufprall auf der Wasseroberfläche entriss ihm Morgan Judds Notizbuch, das für immer auf den Meeresgrund sank.
Als er einen Moment später aus den tosenden Wellen auftauchte, merkte Baxter, dass auch seine Brille verschwunden war. Doch auch so sah er, dass sich das Laboratorium im Schlossturm in ein Inferno verwandelt hatte. Grässliche Rauchschwaden trieben in die Nacht hinaus.
Einen solchen Großbrand konnte niemand überleben.
Morgan Judd musste tot sein.
Baxter dachte daran, dass er dem Mann den Tod gebracht hatte, der einstmals sein engster Freund und Kollege gewesen war.
Beinahe hatte er den Eindruck, dass es doch so etwas wie Schicksal und Vorbestimmung gäbe.
1
London, drei Jahre später
»Sie zwingen mich, schonungslos zu sein, Mr. St. Ives. Sie lassen mir keine andere Wahl. Leider sieht es jedoch so aus, dass Sie meinen Vorstellungen von einem Sekretär nicht ganz entsprechen.« Charlotte Arkendale saß hinter ihrem breiten Mahagonischreibtisch und musterte Baxter kritisch. »Es tut mir leid, dass Sie Ihre Zeit vergeudet haben.«
Das Einstellungsgespräch ließ sich gar nicht gut an. Baxter rückte die Brille mit dem goldenen Gestell auf seinem Nasenrücken gerade und gelobte sich insgeheim, dem Impuls, mit den Backenzähnen zu knirschen, jetzt nicht nachzugeben.
»Verzeihen Sie, Miss Arkendale, aber ich hatte den Eindruck, Sie wollten eine Person engagieren, die absolut harmlos, unauffällig und uninteressant wirkt.«
»Das kommt den Tatsachen recht nahe.«
»Ich glaube, Ihre exakte Beschreibung des idealen Kandidaten für diesen Posten lautete, ich zitiere wörtlich: Ein Mensch, der so fad ist wie Haferschleim.«
Charlottes große grüne, beunruhigend intelligente Augen blinzelten. »Sie verstehen mich nicht richtig, Sir.«
»Ich irre mich nur äußerst selten, Miss Arkendale. Meine Haupteigenschaften bestehen darin, dass ich präzise, methodisch und besonnen veranlagt bin. Irrtümer werden von jenen begangen, die impulsiv sind oder zu übermäßiger Leidenschaft neigen. Ich kann Ihnen versichern, dass das nicht meinem Naturell entspricht.«
»Was die Gefahren angeht, die eine leidenschaftliche Natur birgt, könnte ich nicht noch mehr mit Ihnen übereinstimmen«, entgegnete ihm Charlotte eilig. »Genau das ist auch eines der Probleme …«
»Gestatten Sie mir, Ihnen wörtlich vorzulesen, was Sie in dem Brief an Ihren kürzlich ausgeschiedenen Sekretär geschrieben haben.«
»Das ist nicht nötig. Ich weiß selbst, was ich an Mr. Marcle geschrieben habe.«
Baxter ignorierte sie. Er griff in die Innentasche seiner zerknitterten Jacke und zog den Brief heraus. Er hatte das verdammte Ding schon so oft durchgelesen, dass er es nahezu auswendig kannte, doch er blickte auf die geschwungene Handschrift.
»›Wie Sie wissen, Mr. Marcle, brauche ich als Ersatz für Sie einen Sekretär, der Ihre bisherige Stellung einnimmt. Dabei muss es sich um eine Person von einem gewöhnlichen und bescheidenen Äußeren handeln. Ich will diese Stellung mit einem Mann besetzen, der unbemerkt seinen Geschäften nachgehen kann; ich brauche einen Gentleman, mit dem ich mich häufig treffen kann, ohne ungebührliche Aufmerksamkeit zu erregen oder zufälligen Beobachtern vorschnelle Äußerungen zu entlocken. Zu den üblichen Pflichten eines Sekretärs, den Aufgaben, die Sie im Laufe der vergangenen fünf Jahre so bewunderungswürdig erfüllt haben, kommt allerdings diesmal noch etwas Weiteres hinzu. Ich muss mir strikt ausbedingen, dass der Gentleman, den Sie empfehlen, auch über gewisse andere Fähigkeiten und zusätzliche Kenntnisse verfügt. Ich werde Sie nicht bis in alle Einzelheiten mit der Situation belasten, in der ich mich derzeit befinde. Belassen wir es dabei, zu sagen, dass ich aufgrund der Vorfälle in jüngster Zeit eines kräftigen und wackeren Individuums mit hellwachem Verstand bedarf, auf das absoluter Verlass ist, wenn es um den Schutz meiner eigenen Person geht. Kurz und gut, ich wünsche, nicht nur einen Sekretär einzustellen, sondern auch einen Leibwächter. Der Kostenfaktor muss, wie immer, berücksichtigt werden. Daher bin ich zu dem Schluss gelangt, dass es sich als wirtschaftlicher erweisen wird, nicht etwa zwei Männer zu engagieren, sondern beide Aufgaben an einen einzigen Mann zu vergeben, der die Pflichten übernimmt, die beide Stellungen mit sich bringen …‹«
»Ja, schon gut. Ich kann mich noch recht deutlich an meine eigenen Worte erinnern«, fiel ihm Charlotte gereizt ins Wort.
»Aber darum geht es hier nicht.« Baxter fuhr hartnäckig fort.
»›Daher bitte ich Sie darum, mir einen respektablen Gentleman zu schicken, der den obengenannten Anforderungen entspricht und von seinem äußeren Erscheinungsbild her so fad ist wie Haferschleim.‹«
»Mir ist nicht begreiflich, warum Sie den Wortlaut dieser ganzen Seite wiederholen müssen, Mr. St. Ives.« Aber Baxter gab nicht nach.
»›Er muss ein hohes Maß an Intelligenz besitzen, da ich von ihm erwarte, dass er die üblichen heiklen Nachforschungen für mich anstellt. In seiner Kapazität als Leibwächter muss er jedoch zudem auch noch geschickt im Umgang mit der Waffe sein, für den Fall, dass die Ereignisse eine unerfreuliche Wendung nehmen sollten. Und in allererster Linie muss er, wie Sie selbst sehr gut wissen, Mr. Marcle, Diskretion und ein ausgeprägtes Taktgefühl mitbringen.‹«
»Das genügt jetzt, Mr. St. Ives.« Charlotte griff nach einem schmalen, in rotes Leder gebundenes Büchlein und schlug damit auf die Tischplatte.
Baxter blickte von dem Brief auf. »Ich bin der Überzeugung, dass ich den meisten Ihrer Anforderungen entspreche, Miss Arkendale.«
»Gewiss eignen Sie sich in einigen der Punkte.« Sie bedachte ihn mit einem frostigen Lächeln. »Mr. Marcle hätte Sie mir niemals empfohlen, wenn das nicht der Fall wäre. Aber bedauerlicherweise mangelt es Ihnen an einer äußerst wichtigen Eigenschaft.«
Baxter faltete bedächtig den Brief zusammen und ließ ihn wieder in die Innentasche seiner Jacke gleiten. »Nach Marcles Angaben spielt die Zeit eine wesentliche Rolle.«
»Das ist durchaus korrekt.« Ein besorgter Ausdruck schimmerte in ihren glänzenden Augen auf, verschwand jedoch sogleich wieder. »Ich bin darauf angewiesen, dass dieser Posten augenblicklich besetzt wird.«
»In dem Fall sollten Sie vielleicht nicht ganz so wählerisch sein, Miss Arkendale.«
Sie errötete. »Aber die Sache ist die, Mr. St. Ives, dass ich einen Mann einzustellen wünsche, der all meinen Anforderungen entspricht und nicht nur einigen von ihnen.«
»Ich muss darauf bestehen, dass ich sämtlichen Anforderungen genüge, die Sie stellen, Miss Arkendale.« Er unterbrach sich. »Oder jedenfalls fast allen. Ich bin intelligent, umsichtig, besonnen und erstaunlich diskret. Ich gestehe, dass mein Interesse an Pistolen recht gering ist. Ich empfinde sie im Allgemeinen als ziemlich unzuverlässig.«
»Aha.« Bei dieser Mitteilung hellte sich ihr Gesicht auf.
»Da haben wir es. Eine weitere Voraussetzung, die Sie nicht erfüllen, Sir.«
»Aber ich kann mit gewissen Kenntnissen auf dem Gebiet der Chemie aufwarten.«
»Chemie?« Sie runzelte die Stirn. »Wozu soll das denn dienen?«
»Das kann man nie wissen, Miss Arkendale. Gelegentlich sind mir diese Kenntnisse schon sehr nützlich gewesen.«
»Ich verstehe. Nun, das ist natürlich alles äußerst interessant. Aber ich kann leider keinen Chemiker gebrauchen.«
»Sie haben darauf bestanden, dass es ein Mann sein muss, der so gut wie keine Aufmerksamkeit erregt. Ein seriöser, gesetzter und unauffälliger Sekretär.«
»Ja, aber …«
»Gestatten Sie mir, Ihnen mitzuteilen, dass ich oft mit ebendiesen Worten beschrieben worden bin. In jeder Hinsicht so fad wie Haferschleim.«
Charlottes Augen begannen, Funken der Gereiztheit zu sprühen. Sie sprang auf und schritt um ihren Schreibtisch herum. »Es fällt mir außerordentlich schwer, Ihnen das zu glauben, Sir.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, weshalb Ihnen das schwerfallen sollte.« Baxter setzte seine Brille ab, während Charlotte in dem kleinen Arbeitszimmer umherlief. »Sogar meine eigene Tante sagte mir immer wieder, ich brächte es fertig, innerhalb von weniger als zehn Minuten jeden im Umkreis von zwanzig Metern in einen Zustand akuter Langeweile zu versetzen. Miss Arkendale, ich kann Ihnen versichern, dass ich nicht nur langweilig aussehe, nein, ich bin es tatsächlich.«
»Vielleicht sind schlechte Augen in Ihrer Familie verbreitet, Sir. Ich würde Ihrer Tante empfehlen, sich Augengläser wie die zuzulegen, die Sie tragen.«
»Meine Tante würde um keinen Preis auf Erden mit einer Brille herumlaufen.« Baxter sann einen Moment lang über die unerhört modebewusste Rosalind, Lady Trengloss, nach, während er seine Brillengläser polierte. »Sie trägt ihre Brille nur dann, wenn sie ganz sicher sein kann, dass niemand in ihrer Nähe ist. Ich möchte bezweifeln, dass ihre eigene Zofe sie jemals mit einer Brille auf der Nase zu sehen bekommen hat.«
»Das wiederum bestätigt mich nur in meinem Verdacht, dass Ihre Tante Sie schon seit geraumer Zeit nicht mehr genauer angesehen hat, Sir. Vielleicht waren Sie damals noch ein Wickelkind.«
»Wie bitte?«
Charlotte drehte sich abrupt zu ihm um. »Mr. St. Ives, die Frage des Augenlichts hat eine ganze Menge mit dem zu tun, was ich Ihnen gerade klarzumachen versuche.«
Baxter setzte seine Brille mit besonnener Bedächtigkeit wieder auf. Ganz offensichtlich verlor er den Gesprächsfaden aus den Augen. Das war kein gutes Zeichen. Er zwang sich, Charlotte mit seiner gewohnten analytischen Distanz zu mustern.
Sie wies so gut wie keine Ähnlichkeit mit den meisten anderen Damen in seinem Bekanntenkreis auf. In Wahrheit gelangte Baxter, je länger er sich in ihrer Gegenwart aufhielt, immer mehr zu der Überzeugung, dass sie absolut einzigartig war.
Zu seinem Erstaunen musste er feststellen, dass er trotz allem, was er über sie wusste, wider Willen fasziniert von ihr war. Sie war um einiges älter, als er erwartet hatte. Fünfundzwanzig, das hatte er ganz nebenbei in Erfahrung gebracht.
Ihr Mienenspiel erinnerte an die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen in einem Röhrchen über einer glühend heißen Flamme, und obwohl sich auf ihren Zügen alle Emotionen mit äußerster Intensität zeigten, waren sie doch ebenso schnell wieder verschwunden. Ihre Augen wurden von kräftigen Augenbrauen und langen Wimpern eingerahmt. Eine ausgeprägte Nase, hohe Wangenknochen und ein ausdrucksvoller Mund vermittelten den Eindruck von temperamentvoller Entschlossenheit und einem unbeugsamen Willen.
Mit anderen Worten, dachte Baxter, diese Frau setzt ihren Kopf um jeden Preis durch.
Ihr schimmerndes kastanienbraunes Haar war über einer hohen, intelligenten Stirn in der Mitte gescheitelt. Sie hatte es zu einem strengen Knoten aufgesteckt, ließ jedoch ein paar kleine Korkenzieherlöckchen um ihre Schläfen tanzen. Während die Mode der laufenden Ballsaison übertrieben tief ausgeschnittene Mieder und hauchdünne Stoffe vorschrieb, alles dazu gedacht, die weiblichen Formen möglichst deutlich zur Geltung zu bringen, trug Charlotte ein erstaunlich sittsames Kleid. Es war aus gelbem Musselin geschneidert, hatte eine hoch angesetzte Taille und lange Ärmel und war mit weißen Rüschen eingefasst. Unter dem keineswegs kokett schwingenden, sondern nur angedeuteten Volant, der den Saum zierte, schauten gelbe Schuhe aus Glacéleder heraus. Ihm entging nicht, dass sie sehr hübsche Füße hatte, wohlgeformt und mit zierlichen Knöcheln.
Da ihn die Richtung seiner Gedanken entsetzte, wandte Baxter den Blick schnell ab. »Verzeihen Sie, Miss Arkendale, aber ich scheine nicht begriffen zu haben, was Sie mir klarmachen wollen.«
»Sie eignen sich schlichtweg nicht für den Posten, den ich zu besetzen habe.«
»Weil ich eine Brille trage?« Er runzelte die Stirn. »Und dabei hätte ich gedacht, das unterstreicht den Eindruck der Fadheit von Haferschleim erst recht.«
»Ihre Brille ist nicht das Problem.« Es klang ganz so, als sei sie inzwischen reichlich aufgebracht und frustriert.
»Ich dachte, Sie hätten gerade gesagt, darin bestünde das Problem.«
»Haben Sie mir denn überhaupt nicht zugehört? Allmählich fange ich an zu glauben, dass Sie mich absichtlich missverstehen, Sir. Ich wiederhole es noch einmal: Sie eignen sich nicht für diesen Posten.«
»Ich eigne mich blendend dafür. Dürfte ich Sie daran erinnern, dass mich kein anderer als Ihr eigener Sekretär für diese Stellung empfohlen hat?«
Charlotte tat diesen Einwand mit einer wegwerfenden Handbewegung ab. »Mr. Marcle ist nicht mehr als mein Sekretär tätig. Er ist in diesem Moment bereits auf dem Weg zu seinem Häuschen in Devon.«
»Ja, richtig. Ich glaube, er hat sich tatsächlich dahingehend geäußert, dass er sich einen langen und friedlichen Ruhestand verdient hätte. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass es sich bei Ihnen nicht gerade um eine besonders umgängliche Arbeitgeberin handelt, Miss Arkendale, und dass Sie enorm hohe Ansprüche stellen.«
Sie nahm eine steife Haltung ein. »Wie bitte?«
»Schon gut, das tut nichts zur Sache. Schließlich geht es hier nicht um Marcles Pensionierung. Was im Moment zählt, ist, dass Sie sich ein letztes Mal an ihn gewandt haben, um ihm die Anweisung zu erteilen, er solle seinen Nachfolger bestimmen. Seine Wahl ist auf mich gefallen, da es in seinem Sinne wäre, wenn ich seine bisherigen Verantwortungen übernähme.«
»In dieser Angelegenheit liegt die endgültige Entscheidung bei mir, und ich sage Ihnen, dass dieser Posten nichts für Sie ist.«
»Ich versichere Ihnen, dass Marcle der Meinung war, ich sei ganz außerordentlich gut für diesen Posten geeignet. Er hat nur zu gern das Empfehlungsschreiben aufgesetzt, das ich Ihnen vorgelegt habe.«
Der adrette John Marcle mit dem silbergrauen Haar war gerade dabei gewesen, seinen Haushalt aufzulösen, als er die letzten Anweisungen von seiner Arbeitgeberin, die schon sehr bald seine ehemalige Arbeitgeberin sein sollte, erhalten hatte. Baxter hatte den perfekten Zeitpunkt für sein Erscheinen gewählt. Oder zumindest hatte er sich das eingebildet, bis er den Versuch unternommen hatte, den unschlüssigen Marcle davon zu überzeugen, dass er sich unter allen Umständen für diesen Posten bewerben wollte.
Statt Erleichterung zu verspüren angesichts der Aussicht, er könnte dieses letzte »Arkendale Problem«, wie er selbst es genannt hatte, aus der Welt schaffen, hatte sich der gewissenhafte Marcle gezwungen gesehen, Baxter von seinem Vorhaben abzubringen.
»Miss Arkendale ist, äh, recht ungewöhnlich«, hatte Marcle gesagt, während er mit seinem Federhalter herumgespielt hatte. »Sind Sie ganz sicher, dass Sie sich für diesen Posten bewerben wollen?«
»Ich bin mir ganz sicher«, hatte Baxter geantwortet. Marcle hatte seine dichten weißen Augenbrauen hochgezogen und ihm ins Gesicht gesehen. »Verzeihen Sie, Sir, aber mir ist nicht ganz klar, warum Sie sich Miss Arkendale in dieser Eigenschaft verpflichten wollen.«
»Die üblichen Gründe. Ich brauche dringend eine Anstellung.«
»Ja, ja, das verstehe ich schon. Aber es sind doch gewiss auch noch andere Stellungen zu haben.«
Baxter beschloss, seine Geschichte ein wenig auszuschmücken. Er schlug einen Tonfall an, von dem er sich erhoffte, dass er vertraulich klang. »Wir wissen doch beide, wie nüchtern und langweilig die meisten dieser Posten sind. Man erteilt Rechtsanwälten und diversen Maklern Anweisungen. Man trifft Vorkehrungen für den Ankauf und Verkauf von Immobilien. Man erledigt Bankgeschäfte. Das ist doch alles andere als anregend. Wer könnte sich für so etwas schon begeistern?«
»Nach fünf Jahren als Sekretär in Miss Arkendales Diensten kann ich Ihnen versichern, dass sehr viel für eine Stellung spricht, in der man alltägliche Routineangelegenheiten abwickelt.«
»Ich bin ganz versessen darauf, endlich einmal etwas anderes zu tun«, sagte Baxter ernst. »Dieser Posten klingt ganz so, als fiele er ein wenig aus dem Rahmen. Ich habe sogar tatsächlich das Gefühl, er könnte für mich eine gewisse Herausforderung darstellen.«
»Eine gewisse Herausforderung?« Marcle schloss die Augen. »Ich möchte bezweifeln, dass Ihnen die volle Bedeutung dieses Wortes heute schon bekannt ist, Sir.«
»Man hat mir gesagt, ich bewegte mich in ausgefahrenen Gleisen. Es wurde angedeutet, ich solle mein Leben etwas aufregender gestalten. Ich hoffe sehr, dass mir dieser Posten die Gelegenheit bieten wird, mein Leben um das Element der Spannung zu bereichern.«
Marcle riss besorgt die Augen auf. »Wollen Sie damit etwa sagen, dass Sie etwas Aufregendes suchen?«
»Ja, allerdings, Sir. Ein Mann meines Schlages bekommt im Normalfall nur sehr wenig von den spannenden Seiten des Lebens mit.« Baxter hoffte, dass er nicht zu dick auftrug.
»Ich habe bisher immer ein ruhiges Leben geführt.« Eigentlich müsste noch gesagt werden, dass er sein friedliches Dasein jeglicher Aufregung bei weitem vorzog. Dieser abscheuliche Auftrag, zu dessen Ausführung ihn seine Tante mit ihren flehentlichen Bitten überredet hatte, stellte für ihn eine unliebsame Störung dar, die ihn aus seinem ruhigen Alltagstrott herausriss.
Er hatte sich nur deshalb dazu beschwatzen lassen, weil er Rosalind sehr gut kannte. Sie besaß zwar einen Hang zum Dramatischen – nichts anderes bedauerte sie so sehr wie den Umstand, dass sie nie zur Bühne gegangen war –, doch sie neigte nicht zu dummen Hirngespinsten und fieberhaften Wahnvorstellungen.
Rosalind machte sich ernstliche Sorgen, was die näheren Begleitumstände der Ermordung ihrer Freundin Drusilla Heskett anging. Die Behörden hatten sich darauf versteift, die Frau sei von einem Einbrecher erschossen worden. Rosalind hegte jedoch den Verdacht, dass es sich bei der Mörderin um niemand anderen als Charlotte Arkendale handelte.
Baxter hatte eingewilligt, sich die Situation einmal näher anzusehen, um seiner Tante einen Gefallen zu tun.
Diskrete Nachforschungen hatten die Information ans Licht gebracht, dass die geheimnisvolle Miss Arkendale zufällig gerade einen neuen Sekretär einstellen wollte. Baxter hatte nicht lange gezögert und beschlossen, sich für den Posten zu bewerben.
Er war überzeugt, dass, wenn es ihm gelänge, durch seine Überredungskünste an diese Anstellung zu kommen, das dann für ihn der ideale Ausgangspunkt für weitere Nachforschungen sei. Mit etwas Glück würde er die ganze Angelegenheit innerhalb von kürzester Zeit geklärt haben und könnte sich dann wieder ungestört in sein ruhiges Laboratorium zurückziehen.
Marcle seufzte. »Es stimmt schon, dass die Arbeit für Miss Arkendale manchmal das Element der Spannung mit sich bringen kann, aber ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, ob es sich dabei um die Art von Spannung handelt, die Ihnen zusagen würde, Mr. St. Ives.«
»Darüber werde ich mir selbst ein Urteil bilden.«
»Glauben Sie mir, Sir, wenn Sie danach lechzen, etwas Aufregendes zu erleben, dann täten Sie besser daran, in eine Spielhölle zu gehen.«
»Ich habe keinen Spaß an Glücksspielen.«
Marcle schnitt eine Grimasse. »Ich versichere Ihnen, eine Spielhölle, in der es lebhaft zugeht, ist nicht annähernd so nervenaufreibend wie die Verwicklungen, auf die man sich einlässt, wenn man sich mit Miss Arkendales Angelegenheiten befasst.«
Baxter hatte bisher noch nicht die Möglichkeit in Betracht gezogen, Charlotte Arkendale könnte eine Anwärterin fürs Irrenhaus sein. »Sie halten sie für verrückt?«
»Wie viele Damen in Ihrem Bekanntenkreis haben Bedarf an einem Sekretär, der außerdem auch noch die Aufgaben eines Leibwächters zu übernehmen hat, Sir?«
Eine ausgezeichnete Frage, dachte Baxter kläglich. Die ganze Angelegenheit schien mit jeder Sekunde bizarrer zu werden. »Ich möchte mich trotz allem um den Posten bewerben. Die Gründe dafür, dass sie einen neuen Sekretär braucht, liegen auf der Hand. Schließlich gehen Sie in den Ruhestand, und Miss Arkendale braucht daher einen Ersatz für Sie. Aber vielleicht wären Sie so freundlich, mir zu erklären, warum Miss Arkendale so dringend einen Leibwächter benötigt?«
»Woher, zum Teufel, sollte ich die Antwort auf diese Frage kennen?« Marcle warf seinen Federhalter auf den Tisch.
»Miss Arkendale ist eine sehr eigenartige Frau. Seit dem Tod von Lord Winterbourne, ihrem Stiefvater, habe ich als ihr Sekretär in ihren Diensten gestanden. Ich kann Ihnen versichern, dass diese letzten fünf Jahre die längsten fünf Jahre meines ganzen Lebens waren.«
Baxter musterte ihn neugierig. »Wenn Sie eine solche Abneigung gegen Ihren Posten gehabt haben, warum haben Sie dann nicht die Stellung gewechselt?«
Marcle seufzte. »Sie bezahlt ihre Mitarbeiter außerordentlich gut.«
»Ich verstehe.«
»Aber ich muss gestehen, dass ich jedes Mal wieder vor Angst geschlottert habe, wenn ich einen Brief mit ihren neuesten Anweisungen erhalten habe. Ich konnte nie wissen, welche seltsamen Aufgaben sie für mich haben würde. Und das war noch zu den Zeiten, ehe sie auf den Gedanken gekommen ist, die Aufgaben eines Leibwächters auf die Person zu übertragen, die auch den Posten des Sekretärs innehat.«
»Welche Art von Anforderungen stellt sie denn, wenn alles ganz normal verläuft?«
Marcle seufzte. »Sie hat mich losgeschickt, damit ich Erkundigungen über die merkwürdigsten Leute einziehe. Ich bin rauf in den hohen Norden gereist, um ihr Informationen über einen gewissen Gentleman zu beschaffen. Ich habe in ihrem Auftrag die Geschäftsführer der abscheulichsten Spielhöllen und Bordelle ausgehorcht. Ich habe detaillierte Erkundigungen über die finanziellen Verhältnisse zahlloser Männer eingeholt, die zutiefst schockiert wären, wenn sie zufällig erfahren sollten, dass Miss Arkendale sich für ihre Angelegenheiten interessiert.«
»Das klingt wirklich seltsam.«
»Und so ganz und gar nicht damenhaft. Ich versichere Ihnen, Sir, wenn die Bezahlung nicht so ansehnlich gewesen wäre, hätte ich meine Stellung schon nach dem ersten Monat wieder gekündigt. Aber wenigstens ist von mir nie verlangt worden, dass ich zusätzlich noch den Leibwächter spiele. Manchmal sollte man schon für Kleinigkeiten dankbar sein.«
»Sie haben also keine Ahnung, warum sie das Gefühl hat, in Gefahr zu schweben?«
»Nicht die geringste.« Marcles Stuhl quietschte, als er sich zurücklehnte. Er fuhr fort: »Miss Arkendale hat es nicht für angemessen erachtet, sich mir in diesem Punkt anzuvertrauen. In Wahrheit gibt es reichlich viele Dinge, die Miss Arkendale mir niemals anvertraut hat, da es ihr offenbar nicht angebracht erschien. Beispielsweise weiß ich bis heute nicht, woher sie ihre Einnahmen tatsächlich bezieht.«
Baxter stellte sich sehr geschickt an, wenn es darum ging, seine Gesichtszüge zu beherrschen. Ein Bastard erlernt diese Fähigkeit schon in jungen Jahren, selbst dann, wenn es sich bei ihm um das Zufallsprodukt eines wohlhabenden Earl handelt. Diese Begabung erwies sich im Moment als äußerst nützlich. Es gelang ihm nämlich, sich so zu geben, als interessierte ihn Marcles letzte Äußerung nur am Rande.
»Ich hatte bisher den Eindruck, Lady Winterbourne, Miss Arkendales Mutter, hätte aus ihrer ersten Ehe beträchtliche Einkünfte bezogen«, sagte Baxter behutsam. »Und ich hatte angenommen, die Erbschaft sei an Miss Arkendale und ihre Schwester übergegangen.«
Marcle zog die Augenbrauen hoch. »Genau das möchte Miss Charlotte die Leute gern glauben machen. Aber ich kann Ihnen sagen, Winterbourne hat das Arkendale-Erbe fast bis auf den letzten Penny ausgegeben, ehe er vor fünf Jahren endlich den Anstand besessen hat, sich von einem Wegelagerer umbringen zu lassen.«
Baxter setzte seine Brille ab und begann, mit seinem Taschentuch die Gläser zu polieren. »Und aus welcher Quelle stammt Ihrer Meinung nach Miss Arkendales Geld tatsächlich?«
Marcle unterzog seine Fingernägel einer eingehenden Prüfung. »Ich werde Ihnen die Wahrheit sagen, Sir. Obgleich ich ihr fünf Jahre lang dabei assistiert habe, ihr Einkommen zu investieren und es zu verwalten, habe ich keine Ahnung, woher das Geld stammt. Ich empfehle Ihnen wärmstens, meinem Beispiel zu folgen, falls Sie diesen Posten übernehmen sollten. Manchmal ist es das Beste, nicht über alle Fakten informiert zu sein.«
Baxter setzte seine Brille langsam wieder auf. »Faszinierend. Ich nehme an, ein entfernter Verwandter ist verstorben und hat ihr eine Erbschaft hinterlassen, die das von Winterbourne vergeudete Erbe wieder wettgemacht hat.«
»Ich glaube nicht, dass das der Fall ist«, sagte Marcle bedächtig. »Vor ein paar Jahren bin ich meiner Neugier erlegen und habe einige diskrete Nachforschungen angestellt. Die Arkendales hatten keinen einzigen derart wohlhabenden Verwandten. Ich fürchte, ihre Einnahmequelle zählt schlichtweg zu den zahlreichen seltsamen Geheimnissen, in die Miss Arkendale gehüllt ist.«
Ihm waren ihre Einnahmequellen absolut kein Rätsel, vorausgesetzt, Rosalind lag richtig mit ihren Schlussfolgerungen, dachte Baxter. Dann handelte es sich bei der Dame nämlich um nichts weiter als um eine schnöde Erpresserin. Ein Pochen, das nicht zu überhören war, ließ seine Gedanken wieder in die Gegenwart zurückkehren. Er warf einen Blick auf Charlotte, die vor dem Kamin stehen geblieben war. Sie trommelte mit den Fingern auf das marmorne Kaminsims.
»Mir ist beim besten Willen nicht begreiflich, was Marcle auf den Gedanken bringen konnte, Sie wären für diesen Posten geeignet«, sagte sie.
Baxter hatte keine Lust mehr, diese Frage noch länger zu erörtern. »Es verhält sich ja nicht gerade so, als gäbe es zahllose Männer, die Ihren absurden Anforderungen entsprächen, Miss Arkendale.«
Sie sah ihn finster an. »Aber Mr. Marcle kann doch gewiss einen Gentleman für mich ausfindig machen, der sich für diesen Posten besser eignet als Sie.«
»Haben Sie schon wieder vergessen, was Sie mir selbst gerade erzählt haben? Marcle ist bereits auf dem Wege nach Devon. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir genauer zu sagen, was Ihnen an mir derart ungeeignet erscheint?«
»Sie meinen, abgesehen davon, dass es Ihnen im Umgang mit einer Pistole an der nötigen Geschicklichkeit fehlt?«, fragte sie mit einer übertrieben zuckersüßen Stimme.
»Ja. Was haben Sie sonst noch an mir auszusetzen?«
»Sie zwingen mich, grob zu werden, Sir. Das Problem besteht in Ihrem Äußeren.«
»Was, zum Teufel, ist gegen mein Äußeres einzuwenden? Niemand könnte auf den ersten Blick noch weniger einnehmend wirken als ich.«
Charlotte zog die Stirn in Falten. »Versuchen Sie bloß nicht, mir eine Geschichte aufzutischen. Sie haben ganz eindeutig keinerlei Ähnlichkeit mit Haferschleim aufzuweisen. Tatsächlich ist sogar das genaue Gegenteil der Fall.«
Er starrte sie an. »Wie bitte?«
Sie stöhnte. »Sogar Ihnen selbst muss doch durchaus bewusst sein, Sir, dass Ihre Brille eine erbärmliche Verkleidung darstellt.«
»Eine Verkleidung?« Er fragte sich, ob er vielleicht die falsche Adresse genannt bekommen hatte und an die falsche Charlotte Arkendale geraten war. Vielleicht hatte er sich sogar in der Stadt geirrt. »Was, in drei Teufels Namen, sollte ich Ihrer Meinung nach verschleiern wollen?«
»Sie sind doch sicher nicht der Illusion erlegen, dass diese Brille über Ihre wahre Natur hinwegtäuschen kann.«
»Meine wahre Natur?« Baxters Geduldsfaden riss jetzt endgültig. »Verdammt noch mal, was zum Teufel bin ich denn, wenn ich nicht unauffällig und unsympathisch bin?« Sie spreizte die Hände. »Sie haben das Äußere eines Mannes mit heftigen Leidenschaften, der sein Temperament nur mittels enormer Willenskraft und Selbstbeherrschung gebändigt hat.«
»Wie bitte? Könnten Sie etwas deutlicher werden!«
Ihre Augen waren grimmig entschlossen zusammengekniffen. »Ein solcher Mann hofft vergebens, er könnte sich unbemerkt in der Gegend herumtreiben. Sie werden zwangsläufig Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn Sie geschäftliche Angelegenheiten für mich regeln. Das kann ich absolut nicht gebrauchen. Für meine Zwecke ist jemand erforderlich, der in der Menge untergehen kann. Jemand, dessen Gesichtszüge sich niemandem allzu klar einprägen. Verstehen Sie das denn nicht, Sir? Sie dagegen vermitteln den Eindruck, als seien Sie, nun ja, um es plump auszudrücken, reichlich gefährlich.«
Baxter verschlug es die Sprache.
Charlotte faltete die Hände hinter dem Rücken und begann wieder, in ihrem Büro umherzulaufen. »Es liegt auf der Hand, dass es Ihnen niemals gelingen wird, wie ein langweiliger und gewöhnlicher Sekretär zu wirken. Daher müssen Sie begreifen, dass Sie für meine Zwecke vollkommen unbrauchbar sind.«
Baxter merkte, dass sein Kiefer hinuntergeklappt war. Es gelang ihm nur mit Mühe, den Mund wieder zu schließen. Er hatte sich schon vieles anhören müssen, und er war es durchaus gewöhnt, dass man ihn als einen Bastard beschimpfte, ihm seine schlechten Manieren vorwarf oder ihm vorhielt, was für ein unglaublicher Langweiler er war, aber niemand hatte ihm je den Stempel aufgedrückt, er sei ein Mann mit heftigen Leidenschaften. Und es hatte auch noch nie jemand von ihm behauptet, dass er gewissermaßen »gefährlich« wirkte.
Er war Naturwissenschaftler. Den distanzierten, sachlichen Ansatz, mit dem er an Probleme, Menschen und Situationen heranging, hielt er sich stolz zugute. Diese Eigenschaft hatte er bereits vor Jahren perfektioniert, nämlich schon damals, als er dahintergekommen war, dass ihm sein rechtmäßiges Erbe für immer versagt bleiben würde, da er der uneheliche Sohn des Earl of Esherton und der berüchtigten Emma, Lady Sultenham, war.
Schon seit dem Tag seiner Geburt waren Spekulationen über ihn angestellt worden, und seitdem waren auch stets Gerüchte über ihn in Umlauf gewesen. Er hatte schon sehr früh gelernt, Zuflucht bei seinen Büchern und naturwissenschaftlichen Apparaturen zu suchen.
Zwar fanden viele Frauen den Gedanken an eine Affäre mit dem unehelichen Sohn eines Earl anfangs recht aufregend, vor allem dann, wenn sie erfuhren, dass er trotz seiner unehelichen Geburt sehr wohlhabend war, doch diese Einstellung hielt nicht lange an. Die kraftlosen Flammen, die ins Leben sprangen, wenn er eine seiner seltenen Affären begann, waren ausnahmslos schon nach kürzester Zeit hinuntergebrannt und zischend erloschen.
Seit seiner Rückkehr aus Italien vor drei Jahren hatte sich die durchschnittliche Dauer seiner Affären noch mehr verkürzt. Die Verätzungen auf seinem Rücken und auf seinen Schultern waren zwar verheilt, doch er war für den Rest seines Lebens gezeichnet.
Frauen reagierten schockiert und angewidert auf die hässlich verfärbten, entstellenden Narben. Baxter konnte es ihnen nicht wirklich vorwerfen. Er hatte noch nie besonders gut ausgesehen, und die tiefen Spuren, die die Säure hinterlassen hatte, hatten nicht gerade dazu beigetragen, dass er besser aussehen würde.
Zum Glück war sein Gesicht verschont geblieben. Er hatte es jedoch satt, immer peinlich genau darauf achten zu müssen, dass die Kerzen gelöscht wurden und das Feuer heruntergebrannt war, ehe er sich auszog und mit einer Dame ins Bett stieg.
Bei dem letzten dieser Anlässe, vor rund sechs Monaten, hatte er sich an einem der Bettpfosten beinahe den Schädel eingeschlagen, als er in dem tintigen Dunkel, das durch das Fenster in das unbeleuchtete Schlafgemach drang, über einen seiner eigenen Stiefel gestolpert war. Dieser unliebsame Zwischenfall hatte den Rest des Abends ganz entschieden beeinträchtigt.
Befriedigung und Lust fand er vorwiegend in seinem Labor. Dort war er von seinen schimmernden Glasröhrchen und Phiolen umgeben, von Destillierkolben und Bunsenbrennern, und ihm blieben die nichtssagenden Gespräche und die frivolen Zeitvertreibe der feinen Gesellschaft erspart. An dieser Welt hatte er ohnehin noch nie seine Freude gehabt. Es war eine Welt, die ihn nicht einmal ansatzweise verstand. Eine Welt, die er als unerträglich oberflächlich, geistlos und schal empfand. Eine Welt, in der er sich nie heimisch gefühlt hatte.
Baxter riss sich zusammen, rief seine Gedanken zurück, die sich selbständig gemacht hatten, und zwang sich, schnell wieder Vernunft anzunehmen. Charlotte hatte ihn als Kandidaten für den Posten schlichtweg abgelehnt. Jetzt musste er sich einen vollkommen neuen Ansatz einfallen lassen, wenn er sie davon überzeugen wollte, dass es das einzig Richtige war, ihm die Stellung zu geben.
»Miss Arkendale, Ihre Beurteilung meiner wahren Natur scheint in einem krassen Gegensatz zu der Auffassung zu stehen, die sich die restliche Welt gebildet hat. Dürfte ich vielleicht vorschlagen, dass wir diese Angelegenheit klären, indem wir ein Experiment durchführen?«
Sie verharrte regungslos. »Und wie sähe dieses Experiment aus?«
»Ich schlage vor, die Angehörigen Ihres Haushalts zu rufen und jeden einzelnen nach seiner Meinung zu fragen. Falls alle darin übereinstimmen sollten, dass ich meine Aufgaben problemlos erfüllen kann, ohne aufzufallen oder gar aus der Menge herauszustechen, bekomme ich den Posten. Falls die anderen Befragten jedoch Ihren Auffassungen beipflichten sollten, werde ich mich klaglos verabschieden und mich anderswo nach einer geeigneten Stellung umsehen.«
Sie zögerte, und die Unschlüssigkeit war ihr deutlich anzusehen. Dann nickte sie. »Damit bin ich einverstanden, Sir. Es erscheint mir durchaus logisch. Wir werden das Experiment auf der Stelle durchführen. Ich rufe meine Schwester und unsere Haushälterin jetzt gleich in mein Büro. Beide besitzen eine ganz hervorragende Beobachtungsgabe.«
Sie griff nach der samtenen Klingelschnur, die neben dem Kamin hing, und zog energisch daran.
»Sie erklären sich einverstanden, das Ergebnis dieses Tests zu akzeptieren und sich an die Abmachungen zu halten?«, fragte er misstrauisch.
»Sie haben mein Wort darauf, Sir.« Sie lächelte mit einem Ausdruck kaum verhohlenen Triumphes. »Wir werden diese Frage augenblicklich klären.«
Im Flur waren Schritte zu hören. Baxter rückte seine Brille zurecht und lehnte sich auf dem Stuhl zurück, um den Ausgang des Experiments abzuwarten.
Er verließ sich darauf, dass er die Ergebnisse jetzt schon vorhersagen konnte. Er kannte seine Stärken besser als jeder andere. Niemand konnte ihn überbieten, wenn es darum ging, so langweilig wie Haferschleim zu wirken.
Zwanzig Minuten später verließ Baxter das Stadthaus der Arkendales und lief mit einem Gefühl stummen innerlichen Frohlockens die Stufen hinunter. Ihm fiel auf, dass der scharfe Märzwind, der noch vor einer Stunde äußerst kühl gewesen war, ihm jetzt wie eine erfrischende und belebende Brise entgegenwehte.
Mit einem sachgemäß durchgeführten naturwissenschaftlichen Experiment konnte sich nichts messen, wenn es darum ging, Streitpunkte aus der Welt zu schaffen, sagte er sich, noch während er eine vorüberfahrende Droschke an den Straßenrand winkte. Es war zwar nicht gerade einfach gewesen, aber schließlich hatte er sich seinen neuen Posten doch noch sichern können. Er hatte fest damit gerechnet, dass Charlotte Arkendale die einzige Person in diesem kleinen Haushalt sein würde, wenn, und das war mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, sie nicht sogar der einzige Mensch in ganz London war, dem er jemals in einer Menschenmenge aufgefallen wäre.
Er war sich nur nicht ganz sicher, was die seltsamen Vorstellungen, die sie sich von seiner wahren Natur machte, über sie selbst aussagten. Er wusste nur, dass John Marcles Meinung sich bestätigt hatte. Charlotte war eine sehr ungewöhnliche Frau, und einmalig.
Und sie entsprach ganz und gar nicht dem Bild, das man sich von einer Erpresserin und Mörderin machte, dachte Baxter.