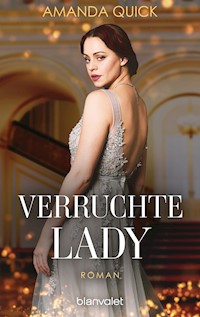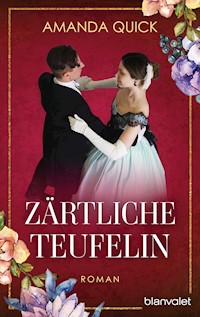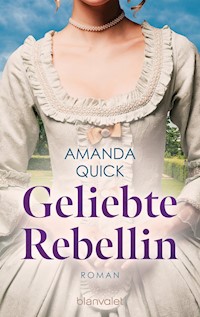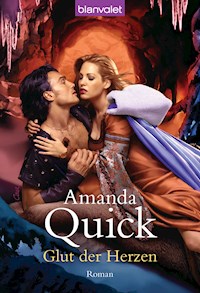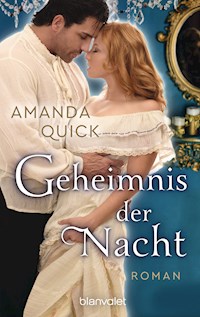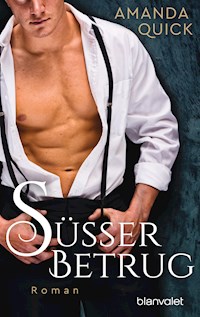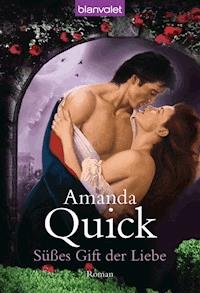
5,99 €
5,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Lucinda Bromley ist entsetzt: Mit einem seltenen Pflanzengift aus ihrem Gewächshaus wurde jemand ermordet. Die junge Botanikerin bittet den verschwiegenen Ermittler Caleb Jones um Hilfe. Lucinda und Caleb geraten in einen Wirbel finsterer Verschwörungen, gefährlicher Intrigen – und leidenschaftlicher Sehnsucht. Doch auf Caleb lastet ein dunkles Vermächtnis, und die Ermittlungen führen sie mitten hinein in seine mysteriöse Vergangenheit …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2010
3,8 (16 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Buch
Autorin
Titel
Liebe Leserinnen und Leser,
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
Copyright
Buch
Als berufstätige Frau im viktorianischen London? Die schöne Lucinda Bromley weiß nur zu gut, wie schwer das ist. Doch die Pflanzen sind ihre Passion und niemals würde die Botanikerin ihr Gewächshaus aufgeben! Als eines Tages ein seltenes Gift aus ihrem Haus verschwindet, mit dem kurz darauf ein Mord begangen wird, gerät sie jedoch unter dringenden Tatverdacht. Die junge Frau bittet den verschwiegenen Ermittler Caleb Jones von der geheimnisvollen Arcane Society um Hilfe, denn wenn sie nicht schnell herausfindet, wer die giftige Pflanze gestohlen hat, könnte es schwierig werden, ihre eigene Unschuld zu beweisen. Auf ihrer Suche nach dem wahren Mörder geraten Lucinda und Caleb in einen Wirbel finsterer Verschwörungen und gefährlicher Intrigen: Es stellt sich heraus, dass eine Gruppe machthungriger Gesellschaftsgrößen ein Mittel entwickeln will, das die Menschen beeinflussen kann. Bei ihren Erkundigungen kommen sich Caleb und Lucinda gefährlich nah und entbrennen schließlich in stürmischer Leidenschaft - doch auf Caleb lastet ein dunkles Vermächtnis, und die Ermittlungen führen sie mitten hinein in seine mysteriöse Vergangenheit …
Autorin
Amanda Quick ist das Pseudonym der erfolgreichen, vielfach preisgekrönten Autorin Jayne Ann Krentz. Krentz hat Geschichte und Literaturwissenschaften studiert und lange als Bibliothekarin gearbeitet, bevor sie ihr Talent zum Schreiben entdeckte. Sie ist verheiratet und lebt in Seattle.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.amandaquick.com und www.blanvalet.de
Die Arcane-Society-Romane bei Blanvalet: Verzaubertes Verlangen (36735) - Dieb meines Herzens (37308) - Süßes Gift der Liebe (37536)
Von Amanda Quick bei Blanvalet außerdem lieferbar:
Geheimnis der Nacht (36195) - Verführung im Mondlicht (36309) - Riskante Nächte (36790) - Geliebte Rebellin/Verstohlene Küsse (36352)
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »The Perfect Poison« bei G. P. Putnam’s Sons, New York
Liebe Leserinnen und Leser,
mich erreichen viele begeisterte Reaktionen von deutschen Lesern, die ich leider nicht immer beantworten kann. Aber ich freue mich jedes Mal sehr, in Ihnen eine so treue und tolle Lesergemeinschaft gefunden zu haben - auch für meine Arcane Society.
Ich erschuf die Welt der Arcane Society, weil sie mir die Möglichkeit bietet, in meinen historischen und auch meinen zeitgenössischen Romanen die Art von Geschichten zu erzählen, die mir die liebsten sind, und sie unter einem einenden Aspekt zu einer Serie zu verbinden. Falls Sie die Bücher kennen, die ich unter meinen drei Pseudonymen veröffentlicht habe - Jayne Ann Krentz für zeitgenössische Romane, Amanda Quick für historische Romane und Jayne Castle für Zukunftsromane -, haben Sie bestimmt bemerkt, dass ich gern romantische Abenteuer mit übernatürlichen oder paranormalen Elementen verbinde. Die Arcane-Society-Romane weisen alle die für meine Bücher so typische Mischung aus Leidenschaft und rätselhaftem Geheimnis auf, und sie enthalten einen überraschenden paranormalen Dreh.
Jedes Buch über die Arcane Society ist eine völlig unabhängige Geschichte. Doch für diejenigen, die die ganze Serie verfolgen, enthält jeder Roman auch neue interessante Informationen über die Society und ihre Mitglieder. Neben dem Helden und der Heldin werden Ihnen beim Lesen auch immer wieder Figuren aus früheren Romanen der Serie begegnen.
Die Geschichte der Arcane Society
Die Arcane Society wurde im späten sechzehnten Jahrhundert von einem brillanten, zurückgezogen lebenden, wahnsinnigen Alchemisten namens Sylvester Jones gegründet. Jones besaß einige ungewöhnliche paranormale Fähigkeiten, und er widmete sein Leben ihrer geheimen Erforschung. Das versteckte festungsartige Laboratorium, in dem er seine Experimente durchführte und seine Ergebnisse archivierte, wurde am Ende zu seiner letzten Ruhestätte.
Am Ende der viktorianischen Epoche wurde dieses Laboratorium, in dem der Alchemist Sylvester begraben lag, schließlich von zwei seiner Nachkommen gefunden und ausgegraben, von Gabriel und Caleb Jones. Sie entdeckten das gefährlichste Geheimnis des Alchemisten: eine Rezeptur für ein Mittel, das - Sylvesters Aufzeichnungen zufolge - die natürlichen psychischen Fähigkeiten eines Menschen steigern und ihn sehr mächtig machen kann.
Das Mittel wirkte, aber es rief einige schreckliche Nebenwirkungen hervor.
Im Laufe der Jahre unternahm die Arcane Society große Anstrengungen, um Sylvesters Rezeptur zu verbergen, doch sie verfolgt die Society und die Jones-Familie bis zum heutigen Tag.
Die Society hütet noch weitere gefährliche Geheimnisse, darunter eine schauerliche Sammlung übersinnlicher Artefakte und okkulter Gegenstände. Überdies unterhält sie eine Forschungseinrichtung, die sich Experimenten und Studien paranormaler Phänomene widmet.
Die Arcane-Society-Romane, die unter dem Namen Amanda Quick erscheinen, sind im spätviktorianischen Zeitalter angesiedelt, in dem die Erforschung des Übersinnlichen absolut en vogue war.
Die Arcane-Society-Romane, die unter dem Namen Jayne Ann Krentz erscheinen, sind zeitgenössische Geschichten. In der modernen Ära hat sich die Arcane Society ausgebreitet. Viele Nachkommen der Jones-Familie sind in die USA ausgewandert, dort gründeten sie eine Privatdetektei für übersinnliche Phänomene, bekannt unter dem Namen Jones & Jones. Die Privatdetektei ist unter anderem damit beauftragt, die dunkelsten Geheimnisse der Society zu schützen.
Ich hoffe, dass die Abenteuer der Arcane Society Sie beim Lesen genauso begeistern werden, wie mich beim Schreiben!
Herzlichst Ihre Jayne Ann Krentz
Diesen Roman widme ich meiner wunderbaren Schwägerin Wendy Born in Liebe und Dankbarkeit für die Ameliopteris amazonensis.
Mein herzlicher Dank gilt auch Barbara Knapp, die mich unter anderem mit Mr Marcus Jones bekannt machte.
Beiden bin ich verpflichtet, da sie für mich ein Fenster zu der wundervollen Welt der Botanik im neunzehnten Jahrhundert aufstießen.
1. KAPITEL
Gegen Ende der Regierungszeit Königin Viktorias.
Lucinda blieb einige Schritte vor dem Toten stehen und wappnete sich gegen die heftigen, wenn auch unterschwelligen Spannungen, die in der eleganten Bibliothek wüteten.
Der Konstabler und die trauernden Angehörigen, denen sehr wohl bewusst war, wen sie vor sich hatten, beobachteten sie mit einer Mischung aus makabrer Faszination und kaum verhülltem Entsetzen. Sie konnte es ihnen nicht verdenken. Als skandalumwitterte Frau, die in Verbindung mit einem schockierenden Mord von der Presse durch den Schmutz gezogen worden war, wurde sie von der guten Gesellschaft konsequent geschnitten.
»Ich fasse es nicht!«, rief die attraktive, frisch gebackene Witwe aus. »Inspektor Spellar, wie können Sie es wagen, uns diese Frau ins Haus zu bringen?«
»Es wird nur einen Moment in Anspruch nehmen«, gab Spellar zurück. Er neigte den Kopf Lucinda zu. »Wären Sie so gut, mir Ihre Meinung mitzuteilen?«
Lucinda behielt ihre kühle, gefasste Miene mit einiger Mühe bei. Später würden die Familienmitglieder zweifellos unter Freunden und Bekannten verbreiten, sie hätte so gewirkt, wie Zeitungen und Groschenblätter sie geschildert hatten, nämlich eiskalt.
Tatsächlich war ihr allein der Gedanke an das Bevorstehende absolut zuwider. Viel lieber wäre sie zu Hause in ihrem Gewächshaus gewesen, eingehüllt von den Düften, Farben und der Energie ihrer geliebten Pflanzen. Doch aus irgendeinem ihr unerklärlichen Grund fühlte sie sich dennoch zu den Aufgaben hingezogen, die sie gelegentlich für Spellar erledigte.
»Aber gewiss, Inspektor«, sagte sie. »Deswegen bin ich schließlich hier. Dass ich nicht zum Tee eingeladen wurde, steht wohl mit Sicherheit fest.«
Die Schwester der Witwe, eine streng aussehende alte Jungfer, die als Hannah Rathbone vorgestellt worden war, schnappte hörbar nach Luft.
»Unerhört«, stieß Hannah hervor. »Wo bleibt Ihr Gefühl für Anstand, Miss Bromley? Ein Gentleman ist tot. Sich dem Anlass entsprechend zu benehmen und dieses Haus rasch wieder zu verlassen, ist das Mindeste, was Sie tun können.«
Spellars vielsagender Blick gab Lucinda zu verstehen, sie möge ihre Zunge hüten. Seufzend fügte sie sich. Seine Ermittlungen zu gefährden, war das Allerletzte, was sie wollte, da er sich dann sehr gut überlegen würde, weiterhin ihren Rat zu suchen.
Auf den ersten Blick hätte kaum jemand Spellars Beruf erraten. Seine rundliche Statur ließ ihn gutmütig und freundlich erscheinen. Ein buschiger Schnurrbart und ein schütterer grauer Haarkranz lenkten von der klaren, scharfsichtigen Intelligenz seiner blaugrauen Augen ab.
Wer ihn nicht gut kannte, konnte nicht ahnen, dass er ein ausgeprägtes Talent dafür besaß, am Tatort eines Mordes auch die kleinste Spur wahrzunehmen, eine Gabe, die jedoch begrenzt war. So konnte er nur die offenkundigsten Fälle von Vergiftungen erkennen.
Fairburns Leichnam lag in der Mitte des riesigen, floral gemusterten Teppichs. Spellar trat vor und bückte sich, um das Laken wegzuziehen, das man über den Toten gebreitet hatte.
Lady Fairburn brach wieder in einen Tränenschwall aus. »Ist das wirklich nötig?«, fragte sie mit gebrochener Stimme.
Hannah Rathbone nahm sie in die Arme.
»Schon gut, Annie«, flüsterte sie ihr zu. »Beruhige dich. Du weißt, dass du deinen Nerven nicht zu viel zumuten darfst.«
Hamilton Fairburn, das dritte anwesende Familienmitglied, legte sein gut geschnittenes Gesicht in ernste Falten. Der gut aussehende junge Mann Mitte zwanzig war Fairburns Sohn aus einer früheren Ehe. Laut Spellar war es Hamilton gewesen, der darauf bestanden hatte, Scotland Yard zu Rate zu ziehen. Als Fairburn aber Lucindas Namen erkannte, war er sichtlich fassungslos gewesen. Er hätte ihr den Zutritt ins Haus verwehren können, hatte es aber nicht getan. Er wollte, dass es mit den Ermittlungen voranging, dachte sie, auch wenn dies bedeutete, eine übel beleumundete Person in seinem Haus dulden zu müssen.
Sie ging näher an den Leichnam heran, auf jene Empfindungen gefasst, die eine Begegnung mit dem Tod unweigerlich weckte. Nichts aber hätte sie auf das Gefühl der Desorientierung und völligen Leere vorbereiten können, das sie erfasste, als sie auf die Gestalt auf dem Boden hinunterblickte. Wer und was immer Fairburn zu Lebzeiten gewesen sein mochte, die Essenz seines Wesens hatte sich verflüchtigt.
Sie wusste jedoch, dass Beweisspuren, die Hinweise auf die Art seines Todes liefern konnten, dem Schauplatz noch immer anhafteten. Spellar konnte die meisten erfassen. Falls aber Gift im Spiel war, so war es ihre Aufgabe, es zu finden. Die für sie wahrnehmbaren Spuren giftiger Substanzen verblieben nicht nur im Körper, sondern waren an allem zu finden, was das Individuum in seinen letzten Augenblicken berührt hatte.
Oft gab es aber auch andere, höchst unangenehme und offenkundigere Beweise. Ihrer Erfahrung nach wurden Menschen, die durch Gift zu Tode kamen, sehr krank, ehe sie starben. Auch dabei gab es natürlich immer Ausnahmen. Eine lang anhaltende, mäßige Beigabe von Arsen führte meist zu keinem so dramatischen Endergebnis.
Es lagen freilich keine Anzeichen vor, dass Lord Fairburn vor seinem Tod an Anfällen von Unwohlsein gelitten hätte. Sein Tod konnte ebenso als Folge eines Schlaganfalls oder einer Herzattacke eingetreten sein. Die meisten Familien, die wie die Fairburns gehobenen Kreisen angehörten, hätten eine solche Diagnose vorgezogen und das öffentliche Aufsehen vermieden, das Ermittlungen in einem Mordfall unweigerlich mit sich brachten. Sie fragte sich, was Hamilton Fairburn bewogen haben mochte, Scotland Yard einzuschalten. Sicher war er auf etwas gestoßen, das seinen Verdacht geweckt hatte.
Sie konzentrierte sich kurz auf visuelle Hinweise, doch verrieten ihr diese wenig. Die Haut des Toten hatte eine ausgeprägt aschgraue Färbung angenommen. Seine offenen Augen starrten ins Leere, die Lippen waren zu einem letzten Seufzer geöffnet. Sie registrierte, dass er mindestens zwanzig Jahre älter als seine Frau sein musste. Kein ungewöhnlicher Umstand, wenn ein begüterter Witwer sich wieder vermählte.
Routiniert streifte sie ihre dünnen Lederhandschuhe ab. Es war nicht immer nötig, den Toten zu berühren, doch erleichterte es der direkte körperliche Kontakt, Nuancen von Energie aufzuspüren, die ihr andernfalls entgangen wären.
Wieder war schockiertes Luftschnappen von Lady Fairburn und Hannah Rathbone zu vernehmen. Hamilton kniff die Lippen zusammen. Sie wusste, dass alle den Ring an ihrem Finger gesehen hatten, den Ring, von dem die Sensationspresse behauptet hatte, er hätte als Versteck für das Gift gedient, das ihren Verlobten tötete.
Sie beugte sich vor und strich mit den Fingerspitzen leicht über die Stirn des Toten, während sie zugleich ihre Sinne weit öffnete.
Sofort erfuhr die Atmosphäre des Raumes eine subtile Veränderung. Die Düfte, die dem großen Gefäß mit dem Blumenpotpourri entströmten, überfluteten sie wie eine schwere Woge, ein Gemisch aus getrockneten Geranien, Rosenblättern, Gewürznelken, Orangenschalen, Piment und Veilchen.
Die Farbtöne der Rosen in den zwei hohen, edlen Vasen leuchteten intensiver und zeigten fremdartige, nicht zu benennende Schattierungen. Die Blütenblätter waren noch frisch und samtig, doch war der unverkennbare Geruch der Verwesung deutlich spürbar. Einen Raum mit Schnittblumen zu schmücken, wäre ihr nie in den Sinn gekommen, da deren Schönheit sehr vergänglich war und sie sich im Zustand des Absterbens befanden. Ein Friedhof war der einzig passende Ort für sie. Wenn man die Kraft einer Pflanze, sei es Blume oder Heilkraut, bewahren will, muss man sie trocknen, dachte sie unwillig.
Der kläglich aussehende, mit einer feuchten Schicht überzogene Farn hinter der Glasfront des Terrariums lag in den letzten Zügen. Sie bezweifelte, ob der erlesene zarte Trichomanes speciosum den Monat überleben würde. Sie verdrängte das Verlangen, ihn zu retten. Es gibt kaum einen Salon im ganzen Land, der sich nicht eines Farnes rühmen kann, dachte sie. Man konnte nicht alle retten. Diese Farn-Manie grassierte seit einigen Jahren. Sie hatte sogar einen eigenen Namen - Pteridomania.
Mit einer durch viel Übung erworbenen Leichtigkeit unterdrückte sie die ablenkenden Energien und Farben der Pflanzen im Raum und konzentrierte sich auf den Leichnam. Ein schwacher Rückstand ungesunder Energie streifte ihre Sinne. Dank ihrer Gabe konnte sie fast jede Art von Gift aufspüren, da die Energien toxischer Substanzen die Atmosphäre auf verschiedene Weise durchdrangen. Doch Lucindas wahre Stärke lag auf dem Gebiet jener Gifte, die dem Reich der Botanik entstammten.
Sie wusste sofort, dass Spellar mit seiner Vermutung recht gehabt hatte. Fairburn hatte Gift zu sich genommen. Aber das Verblüffende waren die schwachen Spuren einer gewissen, sehr seltenen Farn-Gattung. Kalte Panik durchströmte sie.
Sie ließ sich mit dem Toten einen oder zwei Augenblicke länger Zeit als nötig und gab vor, sich auf ihre Analyse zu konzentrieren. In Wahrheit aber nutzte sie die Zeit, um wieder zu Atem zu kommen und ihre Nerven zu beruhigen. Ganz ruhig. Keine Emotionen zeigen.
Als sie sicher sein konnte, dass sie sich wieder unter Kontrolle hatte, richtete sie sich auf und blickte Spellar an.
»Sie haben mit ihrem Verdacht recht, Sir«, sagte sie in einem Ton, von dem sie hoffte, dass er sich professionell anhörte.
Lady Fairburn stieß einen schrillen Schrei damenhaften Entsetzens aus. »Es ist so, wie ich befürchtete. Mein geliebter Mann nahm sich das Leben. Wie konnte er mir das nur antun?«
Sie fiel anmutig in Ohnmacht.
»Annie!«, rief Hannah aus.
Sie kniete neben ihrer Schwester nieder und entnahm der dekorativen Schlüsselkette an ihrer Taille ein Fläschchen. Sie entkorkte es und schwenkte das Riechsalz unter Lady Fairburns Nase. Die Wirkung trat sofort ein. Die Lider der Witwe flatterten.
Hamilton Fairburns Miene verhärtete sich zu grimmiger Empörung. »Wollen Sie damit sagen, dass mein Vater Selbstmord beging, Miss Bromley?«
Sie verschloss ihre Sinne und blickte ihn über den riesigen Teppich hinweg an. »Ich sagte nicht, dass er das Gift mit Absicht trank, Sir. Ob unglücklicher Zufall oder Absicht soll die Polizei feststellen.«
Hannah fixierte sie mit loderndem Blick. »Wer sind Sie, dass Sie behaupten können, der Tod Seiner Lordschaft wäre auf Gift zurückzuführen? Sie sind kein Arzt, Miss Bromley. Tatsächlich wissen wir alle, wer Sie sind. Wie können Sie es wagen, dieses Haus zu betreten und Anschuldigungen zu erheben?«
Lucinda spürte, wie Zorn sich in ihr regte. Das war der ärgerliche Aspekt ihrer Beratertätigkeit. Dank der Sensationspresse, die seit einigen Jahren eine morbide Vorliebe für dieses Thema entwickelt hatte, herrschte in der Öffentlichkeit panische Angst vor Gift.
»Ich bin nicht gekommen, um Anschuldigungen zu erheben«, sagte Lucinda, um einen ruhigen Ton bemüht. »Inspektor Spellar bat mich um meine Meinung, die ich soeben äußerte. Wenn Sie erlauben, gehe ich jetzt.«
Spellar trat vor. »Ich bringe Sie zu Ihrem Wagen, Miss Bromley.«
»Danke, Inspektor.«
Sie gingen von der Bibliothek in die Eingangshalle, wo sie die Haushälterin und den Butler antrafen. Beide wurden sichtlich von Angst verzehrt. Der Rest des zweifellos zahlreichen Hauspersonals blieb diskret unsichtbar. Lucinda konnte es ihnen nicht verargen. Wenn es um Gift ging, gerieten Dienstboten oft als Erste unter Verdacht.
Der Butler beeilte sich, die Tür zu öffnen. Als Lucinda gefolgt von Spellar auf die Stufen hinaustrat, sahen sie sich einer grauen Wand gegenüber. Es war erst Nachmittag, doch der Nebel war schon so dicht, dass er die kleine Parkanlage in der Mitte des Platzes verhüllte und die vornehmen Stadthäuser auf der andere Seite unsichtbar machte. Lucindas private Equipage wartete auf der Straße. Shute, ihr Kutscher, lehnte daneben an einer Brüstung. Er richtete sich auf, als er sie erblickte, und öffnete den Wagenschlag.
»Um diesen Fall beneide ich Sie nicht, Inspektor Spellar«, bemerkte sie leise.
»Es war also doch Gift«, sagte Spellar. »Ich dachte es mir schon.«
»Leider nichts so Einfaches wie Arsen. Sie werden Mr Marshs Test nicht anwenden können, um einen Beweis zu bekommen.«
»Bedauerlichweise ist Arsen neuerdings nicht mehr so beliebt, seitdem jedermann weiß, dass es nachweisbar ist.«
»Nicht verzweifeln, Sir, es ist eine altbewährte Zweitbesetzung und wird sich immer einer gewissen Beliebtheit erfreuen, sei es, seiner leichten Erreichbarkeit wegen oder weil die Symptome, die es hervorruft, einer Anzahl anderer tödlicher Krankheiten zugeschrieben werden können, vorausgesetzt, es wird regelmäßig und über einen längeren Zeitraum verabreicht. Schließlich heißt Arsen in Frankreich nicht von ungefähr Erbschaftspulver.«
»Wie wahr.« Spellar verzog das Gesicht. »Ich will gar nicht wissen, wie viele betagte Eltern und unbequeme Ehepartner durch dieses Mittel schon ins Jenseits befördert wurden. Aber wenn es nicht Arsen war, was dann? Ich konnte keinen Bittermandelgeruch entdecken, mir fielen auch keine anderen Symptome auf, die auf Zyanid hingedeutet hätten.«
»Ich bin sicher, dass das Gift pflanzlichen Ursprungs ist. Grundlage ist die Rizinuspflanze, die hochgiftig ist, wie Sie wissen.«
Spellar runzelte die Stirn. »Ich war der Meinung, eine Rizinusvergiftung riefe große Übelkeit hervor, ehe sie zum Tod führt. Lord Fairburn wies aber keinerlei Symptome einer Unpässlichkeit auf.«
Sie wählte ihre Worte sehr bedacht, um Spellar die Wahrheit möglichst verständlich zu vermitteln. »Wer immer das Gift zusammenbraute, schaffte es, die gefährlichsten Komponenten der Pflanze so herauszufiltern, dass er eine überaus toxische und sehr rasch wirkende Substanz gewann. Lord Fairburns Herzschlag setzte aus, ehe sein Körper das Gift ausscheiden konnte.«
»Sie klingen sehr beeindruckt, Miss Bromley.« Spellar zog die buschigen Brauen zusammen. »Ich nehme an, dass das Wissen um die Herstellung eines solchen Giftes eher ungewöhnlich ist?«
In seinen Augen blitzte seine scharfe Beobachtungsgabe auf, die sofort wieder hinter der nichtssagenden, ein wenig linkischen Fassade, die er zur Schau trug, verschwand. Ihr war nun klar, dass sie sehr vorsichtig sein musste.
»Sehr ungewöhnlich«, sagte sie mit Nachdruck. »Nur ein Wissenschaftler, genauer ein Chemiker, der fast ein Genie sein muss, kann dieses Gift hergestellt haben.«
»Ein psychisches Genie?«, fragte Spellar leise.
»Möglich.« Sie seufzte. »Ich will ehrlich sein, Inspektor. Diese spezielle Mischung ist mir in einem Gift noch nie begegnet.« Das war mehr oder weniger die Wahrheit.
»Ich verstehe.« Spellar nahm eine resignierte Haltung ein. »Ich werde wohl mit den Apotheken beginnen müssen, wenn ich mir auch nicht viel davon erwarte, da dort immer ein schwunghafter Schwarzhandel mit Giften blüht. Eine Witwe in spe kann sich dort ganz einfach eine toxische Substanz besorgen, und wenn der Göttergatte tot umfällt, kann sie behaupten, sie habe das Zeug nur für die Ratten gekauft. Ein Pech, dass der Mann zufällig davon trank.«
»In London gibt es Tausende von Apotheken.«
Er schnaubte. »Ganz zu schweigen von den Läden, die Kräuter und andere Heilmittel feilbieten. Aber ich könnte die Liste der Möglichkeiten einengen, wenn ich mich auf den Umkreis dieser Adresse konzentriere.«
Sie zog ihre Handschuhe über. »Sie sind also überzeugt, dass es sich um Mord handelt? Nicht um Selbstmord?«
Der scharfe Blick kam und verging in Spellars Augen. »Es war Mord«, sagte er leise. »Ich spüre es.«
Sie schauderte. An seiner Intuition zweifelte sie keinen Moment.
»Man kann nicht umhin zu bemerken, dass Lady Fairburn in Trauer sehr attraktiv wirken wird«, sagte sie.
Spellar lächelte fast unmerklich. »Auch mir kam dieser Gedanke.«
»Glauben Sie, dass sie ihn tötete?«
»Es wäre nicht das erste Mal, dass eine unglückliche junge Frau, die sowohl frei als auch reich sein möchte, ihrem viel älteren Ehemann Gift einflößt.« Er wiegte sich auf den Fersen. »In diesem Haus aber bieten sich mehrere Möglichkeiten an. Als Erstes muss ich eruieren, woher das Gift kommt.«
Ihr Inneres krampfte sich zusammen, und es kostete sie Mühe, sich ihre Angst nicht anmerken zu lassen. »Ja, natürlich. Viel Glück, Inspektor.«
»Danke für Ihr Kommen.« Er senkte die Stimme. »Für die Taktlosigkeit, die Sie im Haus der Fairburns über sich ergehen lassen mussten, entschuldige ich mich.«
»Das war doch nicht Ihre Schuld.« Sie lächelte andeutungsweise. »Wir beide wissen, dass ich dieses Benehmen gewohnt bin.«
»Das macht es nicht erträglicher.« Spellars Miene wurde ungewöhnlich ernst. »Die Tatsache, dass Sie bereit sind, sich diesem Benehmen auszusetzen, um mir ab und zu beizustehen, lässt mich immer tiefer in Ihre Schuld geraten.«
»Unsinn. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Keiner von uns möchte Mörder ungestraft davonkommen lassen. Aber ich fürchte, diesmal ist der Fall wie auf Sie zugeschnitten.«
»Sieht so aus. Guten Tag, Miss Bromley.«
Er half ihr beim Einsteigen in die leichte kleine Kutsche, schloss den Wagenschlag und trat zurück. Sie lehnte sich im gepolsterten Sitz zurück, zog die Falten ihres Mantels ordentlich um sich und blickte ins Nebelmeer hinaus.
Seit dem Tod ihres Vaters hatte sie nichts so sehr erschüttert wie die Spuren des Farns, die sie vor wenigen Minuten im Gift entdeckt hatte. Es gab in ganz England nur ein Exemplar einer Ameliopteris amazonensis. Bis vor einem Monat hatte es in ihrem privaten Gewächshaus existiert.
2. KAPITEL
Die knallig-bunten Plakate vor dem Theater kündigten ihn als Bestaunenswerten Mysterio, Bezwinger aller Schlösser an. In Wahrheit hieß er Edmund Fletcher und wusste sehr wohl, dass er auf der Bühne keine Sensation war. Seine Stärke lag auf anderem Gebiet. Man gebe ihm ein versperrtes Haus, und er würde unbemerkt wie Luft eindringen. Im Inneren angelangt, war er imstande, auch noch so gut versteckte Wertsachen aufzuspüren. Ja, er besaß ein ausgeprägtes Talent zum Einbrechen und Eindringen. Problematisch war nur, dass sein Entschluss, es wieder einmal mit dem ehrlichen Leben zu versuchen, sich, wie alle vorangegangenen, als arger Fehlschlag erwiesen hatte.
Seine Auftritte fanden vor leeren Reihen statt, und im Verlaufe der Wochen wurde das Publikum immer spärlicher. An diesem Abend blieben fast drei Viertel der Plätze in dem winzigen Theater leer. Ging es so weiter, wäre er sehr bald gezwungen, wieder in sein altes Metier zurückzukehren.
Es hieß zwar, dass Verbrechen sich nicht bezahlt macht, doch war es weitaus profitabler als der Beruf des Zauberkünstlers.
»Um alle Anwesenden zu überzeugen, dass keine faulen Tricks zur Anwendung kommen, dürfte ich wohl einen Freiwilligen aus dem Publikum auf die Bühne bitten?«
Gelangweilte Stille. Schließlich hob sich eine Hand.
»Ich werde überprüfen, ob Sie nicht betrügen«, sagte ein Mann in der zweiten Reihe.
»Danke, Sir.« Edmund deutete auf die zur Bühne führende Treppe. »Kommen Sie doch zu mir ins Scheinwerferlicht.«
Der massige Mann im schlecht sitzenden Anzug stieg die Stufen hinauf.
»Ihr Name, Sir?«, fragte Edmund.
»Spriggs. Also, was soll ich machen?«
»Bitte, nehmen Sie diesen Schlüssel, Mr Spriggs.« Edmund hielt ihm ein schweres Stück Eisen hin. »Sobald ich im Käfig bin, sperren Sie die Tür zu. Sind die Instruktionen klar?«
Der Mann schnaubte. »Das werde ich wohl schaffen. Los jetzt. Hinein mit Ihnen.«
Vermutlich kein gutes Zeichen, dass der Freiwillige aus dem Publikum dem Zauberer Anweisungen gibt, dachte Edmund bei sich.
Er fühlte sich wie ein Idiot, als er den Käfig betrat und das schweigende Publikum durch die Stäbe hindurch anblickte.
»Mr Spriggs, Sie können zuschließen«, sagte er.
»Los, also.« Spriggs warf die Tür zu und drehte den altmodischen Schlüssel im großen Schloss um. »Jetzt sind Sie fest eingesperrt. Mal sehen, wie Sie da herauskommen.«
Stühle ächzten. Das Publikum wurde unruhig. Edmund wunderte sich nicht. Er hatte keine Ahnung, wie seine Zuschauer das Vergehen der Zeit empfanden, wenngleich die Anzahl der Leute, die hinausgegangen waren, Bände sprach, von seiner Warte aus war der Auftritt schier endlos.
Wieder wanderte sein Blick zu der einsamen Gestalt in der letzten Reihe. Im schwachen Licht der Wandbeleuchtung konnte er nur die dunklen Umrisse auf dem Ecksitz am Mittelgang ausmachen. Die Züge des Mannes blieben beschattet. Dennoch ging etwas Gefährliches, ja Bedrohliches von ihm aus. Er hatte keine von Edmunds Entfesselungsnummern beklatscht, hatte ihn aber auch nicht ausgebuht oder zischend sein Missfallen geäußert. Er saß nur da, völlig reglos und stumm, und beobachtete alle Vorgänge auf der Bühne.
Wieder flammte in Edmund ein gewisses Unbehagen auf. Womöglich war einer seiner Gläubiger unruhig geworden und hatte jemanden geschickt, der das Geld rüde und handgreiflich eintreiben sollte. Dann kam ihm noch ein Gedanke, ein viel beunruhigender. Vielleicht war ein ungewöhnlich scharfsinniger Detektiv von Scotland Yard am Schauplatz von Jasper Vines Tod schließlich doch auf eine Spur gestoßen, die zu ihm führte. Nun, jetzt kam ihm zugute, dass auch die schäbigsten Theater aus verschiedenen Gründen praktische Hintertüren hatten, die sich auf dunkle Gässchen öffneten.
»Meine Damen und Herren«, setzte er an und rückte auffallend seinen Schlips zurecht, wobei er das kleine flache Metallstück umfasste, das sich darunter verbarg. »Achten Sie ganz genau auf alles. Ich werde diese Tür nun allein durch Berührung mit meinen Fingern öffnen.«
Er spannte seine Sinne an und strich zugleich mit der Hand über das Schloss. Die Käfigtür schwang auf.
Matter Applaus ertönte.
»Ich habe von Straßenkünstlern schon bessere Tricks gesehen«, rief ein Mann in der zweiten Reihe.
Edmund ignorierte ihn und verbeugte sich tief vor Spriggs. »Danke für Ihre liebenswürdige Hilfe.« Er richtete sich auf, zog eine Taschenuhr hervor und ließ sie vor Spriggs baumeln. »Ich glaube, das gehört Ihnen.«
Spriggs erschrak und riss Edmund die Uhr aus der Hand. »Her damit.«
Er lief die Stufen hinunter und schritt aus dem Theater.
»Du bist ja nur ein Langfinger … trotz der feinen Klamotten«, rief jemand.
Die Lage wurde immer prekärer. Höchste Zeit, Schluss zu machen. Edmund ging in die Bühnenmitte und achtete darauf, im Mittelpunkt des Scheinwerferlichts zu stehen.
»Nun, liebe Freunde«, kündigte er an, »ist es Zeit, Ihnen Adieu zu sagen.«
»Na endlich«, rief jemand aus.
Edmund verbeugte sich tief.
»Ich will mein Geld zurück«, brüllte ein Mann.
Ohne die Missfallensrufe zu beachten, griff Edmund nach den Rändern seines Umhangs, hob sie hoch und zog sodann die schwarzen Satinfalten zusammen, so dass er den Blicken der Zuschauer entzogen wurde. Wieder spannte er seine Sinne an, produzierte mehr Energie und präsentierte seine letzte Überraschung.
Der Umhang sank zu Boden und enthüllte eine leere Bühne.
Endlich zeigte das Publikum Reaktionen des Erstaunens. Das Zischen und die Buhrufe verstummten jäh. Edmund hörte es auf der anderen Seite des zerschlissenen roten Samtvorhangs. Er musste sich mehr von diesen spektakulären, Aufmerksamkeit erregenden Tricks aneignen, doch gab es dabei zwei Probleme. Das erste bestand darin, dass ausgefeilte und entsprechend dramatische Bühnenrequisiten, die das Publikum gebührend beeindruckten, sehr kostspielig waren.
Sein zweites Problem war, dass er solche Auftritte nicht mochte. Er blieb lieber unbemerkt. Er hasste Scheinwerfer und alles, was damit zusammenhing. Wenn alle Blicke auf ihn gerichtet waren, empfand er Unbehagen. Fletcher, sieh den Tatsachen ins Auge. Du wurdest für ein Leben als Krimineller und nicht für die Bühne geboren.
»Komm heraus und zeig uns, wie du das gemacht hast«, rief jemand auf der anderen Seite des Vorhangs.
Das verblüffte und erstaunte Gemurmel von vorhin ging prompt in grollendes Missfallen über.
»Einen einzigen halbwegs anständigen Trick«, klagte ein Mann. »Mehr hat er nicht auf Lager.«
Edmund ging hinter die Bühne in seine Garderobe. Murphy, der Theaterbesitzer, wartete im Halbdunkel. Pom, sein fetter kleiner Hund, lag zu seinen Füßen. Mit ihren breiten Gesichtern und platten Nasen wiesen die beiden eine unheimliche Ähnlichkeit auf. Pom fletschte die Zähne und stieß ein tiefes Knurren aus.
»Schwieriges Publikum«, äußerte Edmund.
»Kann man den Leuten nicht verübeln«, sagte Murphy in einem Ton, der jenem Poms stark ähnelte. Sein gerötetes Gesicht verzog sich zu einer säuerlichen Miene. »Jeder Entfesselungskünstler, der sein Geld wert ist, entkommt einem versperrten Käfig oder wird seine Handschellen los. Ihr letzter Trick ist ja nicht übel, aber keineswegs einzigartig. Keller der Große und Lorenzo der Prächtige machen sich allabendlich auf der Bühne unsichtbar. Außerdem lassen sie noch viele andere Dinge verschwinden, unter anderem attraktive junge Damen.«
»Engagieren Sie ein hübsches Mädchen, und ich lasse es für Sie verschwinden«, sagte Edmund. »Das haben wir bereits besprochen, Murphy. Wenn Sie größere Überraschungen möchten, müssen Sie mehr in teure Requisiten und ansehnliche Assistentinnen investieren. So wie Sie mich bezahlen, kann ich mir nicht mehr leisten.«
Pom knurrte. Murphy ebenso.
»Ich zahle Ihnen schon viel zu viel«, stieß Murphy hervor.
»Als Droschkenfahrer könnte ich mehr verdienen. Aus dem Weg, Murphy. Ich brauche einen Drink.«
Er ging den Gang weiter zu dem kleinen Verschlag, der ihm als Garderobe diente. Murphy eilte ihm nach. Edmund hörte Poms Klauen über die Dielen scharren.
»Halt«, sagte Murphy. »Wir müssen miteinander reden.«
Pom jaulte auf.
Edmund verlangsamte seinen Schritt nicht. »Später, wenn es Ihnen recht ist.«
»Nein, verdammt. Ich kündige Ihr Engagement. Heute war Ihr letzter Auftritt. Sie können Ihre Sachen packen und verschwinden.«
Edmund blieb abrupt stehen und drehte sich auf dem Absatz um. »Sie können mich nicht feuern. Es gibt einen Vertrag.«
Pom kam schlitternd zum Stehen und trat hastig den Rückzug an. Murphy richtete sich zu seiner vollen Größe auf, so dass sein großer Kahlschädel mit Edmunds Schultern auf gleiche Höhe kam. »Eine Klausel besagt aber, dass ich den Vertrag kündigen kann, wenn die Zuschauerzahl an drei aufeinanderfolgenden Abenden unter ein gewisses Minimum fällt. Zu Ihrer Information - der Kartenverkauf liegt seit über zwei Wochen unter diesem Minimum.«
»Ist es denn meine Schuld, wenn Sie nicht wissen, wie man einen Trickkünstler richtig ankündigt und anpreist?«
»Ist es denn meine Schuld, dass Sie ein höchst mittelmäßiger Artist sind?«, schoss Murphy zurück. »Safes zu öffnen und ein paar Sachen verschwinden und wieder auftauchen zu lassen, ist ja schön und gut, aber im Grunde ein alter Hut. Das Publikum erwartet neue und aufregendere Tricks. Die Leute wollen Sie frei schweben sehen. Zumindest erwartet man, dass Sie ein paar Geister aus dem Jenseits herbeizitieren.«
»Als Medium habe ich mich nie ausgegeben. Ich bin Zauberkünstler.«
»Einer, der nur ein paar Gags präsentiert. Ich gebe zu, dass Sie Taschenspielertricks beherrschen, das reicht aber heutzutage nicht für ein verwöhntes Publikum.«
»Murphy, geben Sie mir noch ein paar Abende Zeit, dann werde ich etwas Spektakuläres bringen. Ehrenwort.«
»Ach was. Das sagten Sie schon letzte Woche. Sie tun mir ja leid, Fletcher, weil Sie kein Talent haben, aber noch eine Chance kann ich mir nicht leisten. Ich muss Rechnungen bezahlen und habe eine Frau und drei Kinder durchzufüttern. Unser Vertrag ist ab sofort gekündigt.«
Also würde er doch wieder in einem Ganovenleben landen. Na, wenigstens würde es mehr einbringen, wenngleich es gefährlicher war. Es war eines, wegen schlechter Auftritte auf der Bühne entlassen zu werden; etwas ganz anderes aber war es, nach einem Hauseinbruch hinter Gittern zu landen. Immerhin besaß die Kunst des Einbrechens und Eindringens einen gewissen Reiz, einen Reiz, den er in einem ehrlichen Beruf nie annähernd erlebt hatte.
Gezielt erhöhte er seine Sinnesempfindungen und lud die Atmosphäre mit knisternder Energie auf. Murphy besaß zwar kein wahrnehmbares psychisches Talent, aber jeder, auch der stumpfsinnigste und ärgerlichste Theaterbesitzer, besaß ein wenig Intuition.
»Morgen bin ich weg«, sagte Edmund. »Doch jetzt verschwinden Sie samt Ihrem jämmerlichen Köter, sonst lasse ich euch beide verschwinden. Für immer.«
Verängstigt jaulend duckte Pom sich hinter Murphy.
Murphys Schnauzbart zuckte, seine Augen wurden groß. Hastig wich er einen Schritt zurück und trat dabei auf Pom.
Der Hund jaulte auf. Murphy ebenso.
»Hören Sie, mit Drohungen dürfen Sie mir nicht kommen«, stammelte Murphy. »Ich rufe die Polizei.«
»Das wäre nicht ratsam«, entgegnete Edmund. »Ich kann Sie jederzeit verschwinden lassen. Aber ehe Sie sich mit dem Vieh verziehen, möchte ich meinen Anteil an den Einnahmen.«
»Haben Sie keine Ohren? Heute gibt es keinen Gewinn.«
»Ich zählte dreißig Personen samt dem Mann in der letzten Reihe, der zu spät kam. Unser Vertrag hält fest, dass ich die Hälfte der Kasseneinnahmen bekomme. Falls Sie mich hereinlegen wollen, werde ich derjenige sein, der die Polizei holt.« Eine leere Drohung, doch wollte ihm nichts anderes einfallen.
»Falls Sie es nicht bemerkt haben sollten - der Großteil der Anwesenden ging, ehe Sie den Auftritt beendeten«, beharrte Murphy. »Ich musste einen stattlichen Betrag des Geldes rückerstatten.«
»Nicht einen Penny. Sie sind ein viel zu gerissener Geschäftsmann.«
Zornrot griff Murphy in seine Tasche und holte Geld hervor. Er zählte es sorgfältig und überließ vertragsgemäß die Hälfte Edmund.
»Hier«, grollte er. »Um Sie loszuwerden, ist es mir die Sache wert. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihren gesamten Krempel mitnehmen. Was zurückbleibt, geht in mein Eigentum über.«
Murphy hob Pom hoch, nahm den Hund unter einen Arm und strebte seinem Büro an der Vorderfront des Theaters zu.
Edmund ging in seine Garderobe, drehte die Gasbeleuchtung auf und rechnete rasch nach. Es reichte für eine Flasche Roten und das Essen für morgen. Es konnte jedoch kein Zweifel daran bestehen, dass er seine Karriere als Mitglied der Einbrecherzunft sofort wieder aufnehmen musste. Spätestens morgen Abend. Er wollte packen und das Theater durch den Hinterausgang verlassen, für den Fall, dass der Unbekannte aus der letzten Reihe ihn vor dem Haupteingang erwartete.
Er wuchtete seinen zerbeulten Koffer unter dem Frisiertisch hervor und warf eilig seine wenigen Habseligkeiten hinein. Das dramatische Satincape lag noch auf der Bühne. Er durfte es nicht vergessen, obwohl er es nicht mehr brauchen würde, vielleicht konnte er es einem anderen am Hungertuch nagenden Artisten andrehen.
Ein Klopfen an der Tür ließ ihn innehalten. Der Mann in der letzten Reihe. Seine Intuition war zuverlässig. In Situationen wie dieser ließ sie ihn nie im Stich.
»Verdammt, Murphy, ich sagte schon, dass ich morgen weg bin«, rief er laut.
»Hätten Sie eventuell Interesse an einem anderen Engagement?«
Die Männerstimme klang leise und gepflegt. Kühle Beherrschung und rohe Kraft schwangen darin mit. Nicht der typische Schuldeneintreiber, dachte Edmund, doch fand er dies aus irgendeinem Grund nicht sonderlich beruhigend.
Er spannte seine Sinne an, griff nach seinem Koffer und öffnete vorsichtig die Tür. Der Mann auf dem Gang schaffte es irgendwie, außerhalb des matten Scheins der Gaslampe zu bleiben. Die schattenhafte Gestalt hatte etwas Hageres, Hartes, Raubtierhaftes an sich.
»Zum Teufel, wer sind Sie?«, fragte Edmund. Er machte sich bereit, eine kleine Ablenkung zu inszenieren.
»Vielleicht Ihr neuer Chef.«
Na, vielleicht ließ sich die Rückkehr ins Verbrecherleben eine Weile verschieben.
»Sie wollen einen Artisten engagieren?«, fragte Edmund. »Zufällig bin ich im Moment frei.«
»Ich brauche keinen Zauberer. Ich brauche jemanden, der ein übernatürliches Talent für das Eindringen und Entkommen aus verschlossenen Räumen besitzt.«
Ein Gefühl der Beunruhigung erfasste Edmund.
»Ich weiß nicht, wovon Sie reden«, sagte er.
»Mr Fletcher, Sie sind doch kein Bühnenzauberer. Sie leben nicht von faulen Tricks, oder?«
»Ich weiß nicht, was Sie meinen, Sir.«
»Sie besitzen ein höchst ungewöhnliches psychisches Talent, eines, das Sie befähigt, es mit den kompliziertesten Schlössern aufzunehmen. Es befähigt Sie ebenso, kleine Illusionen zu schaffen, mit deren Hilfe Sie die Blicke Ihrer Umgebung ablenken, während Sie Ihre Arbeit tun. Sie können zwar nicht durch Wände gehen, man könnte aber meinen, dass Sie dazu imstande wären.«
»Wer sind Sie?«, fragte Edmund, der sich sein Erstaunen nicht anmerken lassen wollte.
»Ich heiße Caleb Jones. Seit Kurzem führe ich eine kleine Ermittlungsagentur, Jones & Co, die Aufträge höchst privater und vertraulicher Natur übernimmt. Ich musste die Erfahrung machen, dass ich gelegentlich auf die Hilfe von Konsulenten angewiesen bin, die über besondere Talente verfügen.«
»Sie suchen einen Berater?«
»Im Moment stecke ich in einer Ermittlung, die ungewöhnliche Fähigkeiten erfordert, Mr Fletcher. Seien Sie versichert, dass Sie gut bezahlt werden.«
»Sie sagten, Ihr Name wäre Jones. Da klingelt es bei mir ganz laut. Stehen Sie mit der Arcane Society in Verbindung?«
»Seien Sie versichert, dass diese Verbindung manchmal enger ist, als mir lieb sein kann.«
»Und was soll ich für Sie tun?«
»Sie sollen mir helfen, in ein gut verschlossenes und gut bewachtes Gebäude einzudringen. Sind wir erst drinnen, werden wir ein gewisses Artefakt an uns bringen.«
Edmund spürte, wie sein Pulsschlag sich beschleunigte.
»Ich hatte eigentlich gehofft, eine Verbrecherlaufbahn vermeiden zu können«, antwortete er.
»Warum denn?« Caleb Jones fragte ganz ernsthaft. »Schließlich haben Sie Talent dafür.«
3. KAPITEL
Das größte und unüberwindliche Problem bei der Führung einer Ermittlungsagentur auf psychischer Basis waren die dafür nötigen Klienten.
Caleb entstieg der Droschke und ging die Stufen von Nummer 12, Landreth Square hinauf. Er hob den schweren Türklopfer aus Messing und ließ ihn einige Male fallen.
Die Klienten waren der große Pferdefuß eines ansonsten interessanten und anspruchsvollen Berufes. Gewisse Muster und Regelmäßigkeiten zu entdecken und Erklärungen dafür zu finden, hatte ihn immer schon interessiert - bis hin zur Besessenheit, wie manche behaupteten. Im Ermittlungsgeschäft war er noch neu, erkannte aber bereits, dass es viel Anregung verhieß. Zudem bedeutete es eine willkommene Ablenkung von einer anderen Sache, die ihn seit einiger Zeit in Anspruch nahm.
Jammerschade, dass er den Umgang mit den Individuen nicht vermeiden konnte, die die Jones-Agentur beauftragten. Klienten benahmen sich immer sehr dramatisch. Klienten wurden emotional. Nachdem sie sich seiner Dienste versichert hatten, plagten sie ihn mit Anfragen und wollten wissen, ob er Fortschritte erzielt hatte. Lieferte er ihnen Antworten, teilten sich die Kunden in zwei Kategorien. Die eine Hälfte bekam Wutanfälle. Der Rest brach unter Tränen zusammen. So oder so, sie waren selten befriedigt. Leider stellten die Klienten einen unverzichtbaren Teil seines Unternehmens dar.
Nun aber erwartete ihn ein Vorgespräch mit einer potentiellen Kundin, die ganz entschieden aus dem Rahmen fiel. Trotz seiner üblichen Abneigung gegen jene, die ihn aufsuchten, um seine Hilfe bei Ermittlungen in Anspruch zu nehmen, konnte er ein sonderbares Vorgefühl nicht unterdrücken.
Natürlich hatte er ihren Namen erkannt, als er ihre Nachricht öffnete. Lucinda Bromley, von der Sensationspresse Lucrezia Bromley genannt, war die Tochter des berühmtberüchtigten Botanikers Arthur Bromley, der auf der Suche nach seltenen und exotischen Pflanzen die Welt bis in die entferntesten Winkel bereist hatte. Frau und Tochter hatten ihn oft begleitet. Nachdem Amelia Bromley vor vier Jahren verstorben war, hatte Lucinda die Reisen mit ihrem Vater fortgesetzt.
Vor etwa anderthalb Jahren hatte es ein jähes Ende dieser Expeditionen gegeben, als Bromleys langjähriger Geschäftspartner Gordon Woodhall als Opfer einer Blausäurevergiftung tot aufgefunden wurde. Unmittelbar danach hatte Arthur Bromley Selbstmord begangen. Gerüchte über eine angebliche Entzweiung der beiden wurden auf den Titelseiten sämtlicher Londoner Blätter breitgetreten.
Die Schlagzeilen, die dem Mord oder Selbstmord folgten, waren jedoch nichts im Vergleich zu jenen, mit denen die Öffentlichkeit einen knappen Monat später bombardiert wurde, als Lucinda Bromleys Verlobter, ein junger Botaniker namens Ian Glasson, durch Gift den Tod fand.
In den Skandal mischten sich schmutzige Gerüchte, die sich um die Ereignisse unmittelbar vor Glassons Dahinscheiden rankten. Lucinda war gesehen worden, wie sie mit aufgerissenem Mieder aus einem abgeschiedenen Winkel der Gartenanlagen der Carstairs Botanical Society gelaufen kam. Als gleich darauf Glasson aus demselben einsamen Bereich der Anlage auftauchte, war er damit beschäftigt, seine Hose in Ordnung zu bringen.
Wollte man den reißerischen Zeitungsberichten glauben, hatte Lucinda ihrem Verlobten eine Tasse vergifteten Tee verabreicht. Die tödliche Dosis hätte sie in einem Geheimfach des Ringes, den sie ständig trug, versteckt.
Im Gefolge von Glassons Vergiftung hatte die Presse Lucinda mit dem Namen Lucrezia belegt, eine Anspielung auf die berüchtigte Lucrezia Borgia, der zahllose Giftmorde nachgesagt wurden. Wollte man der Legende glauben, hatte die Dame die tödliche Substanz in einem Ring verborgen.
Die Tür ging auf. Eine Respekt einflößende Haushälterin musterte ihn, als hätte er es auf das Familiensilber abgesehen.
»Ich möchte Miss Bromley sprechen«, sagte Caleb und überreichte der Frau seine Karte. »Ich werde erwartet.«
Die Haushälterin studierte die Karte mit missbilligendem Stirnrunzeln, ehe sie widerstrebend den Weg freigab.
»Sehr wohl, Mr Jones. Folgen Sie mir.«
Caleb betrat eine mit Marmor ausgekleidete Diele. Ein großer Spiegel in schwerem Goldrahmen hing über einem mit kunstvollen Intarsien verzierten Beistelltisch. Die für Visitenkarten der Besucher bestimmte silberne Schale auf dem Tisch war leer.
Er erwartete, in den Salon geführt zu werden. Stattdessen marschierte die Haushälterin in den rückwärtigen Teil des Hauses und durch eine mit Büchern, Landkarten, Globen und Papierstücken vollgestopfte Bibliothek.
Am anderen Ende des Raumes öffnete die Frau eine hohe Glastür, und Caleb blickte in ein großes Gewächshaus. Die kunstvoll entworfene Konstruktion aus Glas und Eisen barg einen üppigen grünen Dschungel. Feuchte Wärme hüllte ihn mit den Gerüchen fruchtbarer Erde und sprossender Vegetation ein.
Dem Raum entströmten aber auch andere Kräfte. Er fühlte das unverkennbare Knistern von Energie. Ein bemerkenswert belebendes Gefühl. Die ganze Atmosphäre wirkte auf alle seine Sinne wie ein Stärkungsmittel.
»Mr Jones möchte Sie sprechen, Miss Bromley«, meldete die Haushälterin in einem Ton, der bis ans andere Ende des Raumes zu hören war.
Das Meer an Grün war so dicht, dass Caleb die Frau mit der Gartenschürze und den Lederhandschuhen erst bemerkte, als sie hinter einem wahren Wasserfall purpurner Orchideen hervortrat. Erregung, die auf der Lauer gelegen hatte, durchzuckte ihn, spannte Muskeln und Sehnen. Ein unerklärliches Gefühl der Dringlichkeit flammte in ihm auf. Wieder kam ihm das Wort belebend in den Sinn.
Er wusste nicht, was er erwartet hatte, was immer es aber war, Lucinda Bromley hatte etwas sehr Seltenes bewirkt. Sie hatte ihn völlig überrumpelt.
Vermutlich hatte er aufgrund ihres Rufes eine geschmeidige, raffinierte Dame mit einer Fassade aus Charme und Schliff erwartet, unter der sich ein giftiges Herz verbergen mochte. Schließlich haftete Lucrezia Borgia ein gewisser Ruf an.
Lucinda aber glich eher einer zerstreuten, gelehrten Feenkönigin Titania, deren Haar ihn an einen explodierenden Sonnenuntergang erinnerte. Sie hatte vergebens versucht, die rote Lockenflut mit Nadeln und Bändern zu zähmen.
Intelligenz erhellte ihre Züge und verwandelte ein Gesicht, das ansonsten als passabel gegolten hätte, in eines, für das fesselnd das einzig richtige Wort war. Ihm war klar, dass er gar nicht mehr wegsehen wollte. Sie guckte ihn hinter den blitzenden Gläsern einer goldgerahmten Brille hervor an. Der tiefe Blauton ihrer Augen war faszinierend.
Sie trug eine lange, mit vielen Taschen bestückte Schürze über einem schlichten grauen Kleid. In einer Hand hielt sie eine Gartenschere, deren lange, scharfe Klingen wie die bizarre mittelalterliche Waffe eines gepanzerten Ritters wirkte. Zusätzlich war sie mit einer Anzahl anderer ähnlich gefährlich aussehender Gerätschaften behängt.
»Danke, Mrs Shute«, sagte Lucinda. »Wir nehmen den Tee in der Bibliothek.«
Ihre Stimme war gar nicht feenähnlich, stellte Caleb erfreut fest. Im Gegensatz zu den irritierend hohen Tönen von Elfenglöckchen, die sich so viele Frauen zulegten, war ihr Ton warm, selbstbewusst und entschlossen. Energie ging als unsichtbare Aura von ihr aus. Eine Frau mit Kraft, dachte er bei sich.
Er war anderen Frauen mit starken Begabungen begegnet, wie sie auf den höheren Ebenen der Arcane Society nicht selten anzutreffen waren. Aber etwas in ihm reagierte auf Lucindas Energie auf neue und merkwürdig beunruhigende
1. Auflage Deutsche Erstveröffentlichung Juni 2010 bei Blanvalet Verlag, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © 2009 by Jayne Ann Krentz
Copyright © 2010 für die deutsche Ausgabe by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House, München Umschlaggestaltung: © HildenDesign, München, unter Verwendungeines Motivs von Franco Accornero via Agentur Schlück GmbH
Redaktion: Regine Kirtschig LH · Herstellung: sam
eISBN : 978-3-641-04637-8
www.blanvalet.de
Leseprobe
www.randomhouse.de