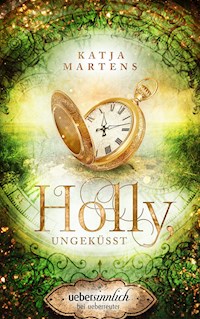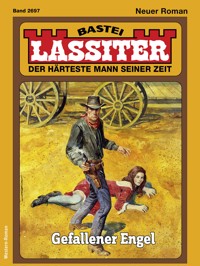Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
New York 1904: Als die junge Auswanderin Adeline schwer verletzt im Schneesturm zusammenbricht, scheint ihr Schicksal besiegelt zu sein. Sie kämpft sich zurück ins Leben, aber ihre Erinnerungen sind verloren. Auf der Suche nach der Vergangenheit begegnet sie Declan. Der Polizist hat den Glauben an das Gute längst verloren. Zu viel Elend hat er bereits gesehen, zu viel Schuld auf sich geladen. Doch er ist Adelines letzte Hoffnung: Nur mit seiner Hilfe kann sie herausfinden, wer sie angegriffen hat – und warum. Gemeinsam forschen sie nach und stoßen dabei auf ein tödliches Geheimnis: Ein Geheimnis, das nicht nur ihr Leben bedroht, sondern die ganze Stadt ins Unglück stürzen könnte! Er will nur vergessen. Sie muss sich erinnern. Sie haben nichts gemeinsam. Bis auf ihre Liebe ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
New York 1904: Als die junge Auswanderin Adeline schwer verletzt im Schneesturm zusammenbricht, scheint ihr Schicksal besiegelt zu sein. Sie kämpft sich zurück ins Leben, aber ihre Erinnerungen sind verloren. Auf der Suche nach der Vergangenheit begegnet sie Declan. Der Polizist hat den Glauben an das Gute längst verloren. Zu viel Elend hat er bereits gesehen, zu viel Schuld auf sich geladen. Doch er ist Adelines letzte Hoffnung: Nur mit seiner Hilfe kann sie herausfinden, wer sie angegriffen hat – und warum. Gemeinsam forschen sie nach und stoßen dabei auf ein tödliches Geheimnis: Ein Geheimnis, das nicht nur ihr Leben bedroht, sondern die ganze Stadt ins Unglück stürzen könnte!
Er will nur vergessen. Sie muss sich erinnern.
Sie haben nichts gemeinsam.
Bis auf ihre Liebe ...
Katja Martens
Im Herzen das Licht
Historischer Roman
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2018 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2018 by Katja Martens
Lektorat: Tatjana Weichel
Korrektorat: Cathérine Fischer
Covergestaltung: Marie Wölk, Wolkenart
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-125-6
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
Teil I Adelines Geheimnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Teil II In Gefahr
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Teil III Die Katastrophe
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Teil IV Das Licht
35. Kapitel
Nachwort: Fakten, Fiktion und Hintergründe
Prolog
New York ist eine Stadt mit vielen Geheimnissen. Heute sind Viertel wie Little Italy oder Chinatown wohlbekannt. Doch kaum jemand erinnert sich noch daran, dass es einmal eine blühende deutsche Gemeinde in New York gab. Little Germany gehörte zum Stadtbild. Bis zu einem verhängnisvollen Junimorgen im Jahre 1904 …
Teil IAdelines Geheimnis
1. Kapitel
New York, April 1904
Nicht stehen bleiben. Ich darf auf keinen Fall stehen bleiben! In einem für eine junge Dame absolut unschicklichen Tempo stürmte Adeline die Bowery entlang, sodass ihr langer Rock hinter ihr her wirbelte. Auf der belebten Geschäftsstraße kümmerte das allerdings niemanden. Jedermann schien es eilig zu haben. Da wurde gerempelt und geschoben, und unzählige Stimmen mischten sich zu einem dumpfen Getöse. Der vibrierende Ton des abendlichen New York war unbeschreiblich: bald ein leises Flüstern, bald anschwellend zu dröhnendem Tumult. Die Menschenmenge versprach Sicherheit, aber noch hatte Adeline ihren Verfolger nicht abgeschüttelt. Noch fühlte sie seinen Blick in ihrem Nacken.
Er konnte sie jeden Moment einholen!
Es schneite seit dem frühen Nachmittag, und der Schnee knirschte unter den Sohlen ihrer Schnürstiefel. Das Firmament spannte sich über der Stadt auf wie weißes Linnen, hinter dem ein orangefarbener Feuerschein flackerte. Das Farbenspiel kündigte weitere und stärkere Schneefälle an. Ein bitterkalter Wind fauchte zwischen den Häusern hindurch, zerrte an Adelines Kleidung und jagte ihr einen Schauer nach dem anderen über den Rücken. Sie war versucht, sich über ihre Schulter nach dem Verfolger umzublicken, aber das hätte wertvolle Sekunden gekostet. Sekunden, die sie womöglich nicht mehr hatte.
Weiter!, trieb sich Adeline in Gedanken an, während sie vorwärtshetzte. Oder vielmehr humpelte. Denn die spitz zulaufende Form ihrer schwarzen Stiefel war zwar modern, jedoch nicht zum Laufen geeignet, schon gar nicht zum Rennen. Ihre Zehen pochten, als wären sie in der Zange eines Schmieds gefangen. Obendrein verhedderte sich ihr Rock in ihren Beinen und brachte sie einmal mehr ins Straucheln. Der wollene Stoff ihres Paletots war eingerissen, weil sie auf ihrer Flucht an einem Mauervorsprung hängen geblieben war und sich hastig losgerissen hatte.
Adeline biss die Zähne zusammen und schob sich vorwärts. Ihre Lungen bettelten um mehr Sauerstoff. Die Mode diktierte ein Korsett, aber unterwegs war das noch schlimmer als die eingezwängten Zehen.
Zu ihrer Linken lockte eine rosafarbene Dekoration in eine Bakery. Der Duft frisch gebackener Kringel wehte ihr entgegen, als eine Kundin mit einem Korb aus dem Geschäft trat.
Ob ich dort Schutz finde?, schoss es Adeline durch den Kopf. Es könnte allerdings auch eine Falle werden. Besser, ich laufe weiter und schüttele ihn ab!
Eine Hochbahn ratterte polternd über das hohe eiserne Gerüst am Straßenrand. Im vergangenen Jahr waren die Dampfzüge von elektrischen Bahnen abgelöst worden, die mittels Stromschienen angetrieben wurden. Kurz nach ihrer Ankunft aus Deutschland hatte Adeline bei dem Getöse der Bahnen noch jedes Mal den Kopf eingezogen. Inzwischen nahm sie es kaum mehr wahr. Dass Tempo und Lärm das Leben in der Riesenstadt definierten, war ihr mit dem ersten Schritt vom Schiff aufgefallen, und jetzt wuchs New York rasant! Jeden Monat kamen mehrere tausend Einwanderer im Hafen an. Der Verkehr drohte zu kollabieren. Um die Fahrwege zu entlasten, sollte im Herbst die erste Untergrundbahn eröffnet werden.
Ob sie das noch erleben würde?
Adeline verbannte diese Frage hastig aus ihrem Kopf und eilte weiter. Es wurde früh dunkel zu dieser Jahreszeit, und sie tauchte ein in ein Meer von Reklameschildern und Plakaten. Zahlreiche künstliche Lichter lösten das Tageslicht ab. Die Straßenfront war eine ununterbrochene Folge von Schaufenstern. Jedes versuchte, seinen Nachbarn zu übertrumpfen, heller, bunter und einladender zu sein. Hier blinkten einhundert Lämpchen; dort lockte das rosabestrumpfte Bein einer Tänzerin in ein Varieté; da lagen zahlreiche Stoffe und Bänder zum Kauf ausgebreitet.
Adeline hastete daran vorbei und erhaschte aus dem Augenwinkel eine Auslage mit Jugendbüchern. Der Trotzkopf von E. v. Rhoden. An anderen Tagen wäre sie stehen geblieben, um die Bücher zu bewundern oder sich eine Lektüre auszusuchen. Das wagte sie jetzt natürlich nicht. Zu nah war der Verfolger ihr immer noch.
Doch sie nahm die Kälte wahr und ebenso die von den unterschiedlichsten Gerüchen geschwängerte Luft: warme Speisen und blumiges Parfum mischten sich mit Kohlenstaub und Schweiß.
Adeline ließ es auf einen Blick zurück ankommen. In der Menschenmenge war es beinahe unmöglich, ein bestimmtes Gesicht auszumachen. Aber halt! War das nicht das bärtige Kinn ihres Verfolgers unter dem schwarzen Filzhut? Neben dem Eingang zum Varieté? Adelines Herzschlag vervielfachte sich.
Sie wirbelte herum und prallte gegen einen pompösen, mit Messingblech verzierten Lehnstuhl, der vor einem Barbershop stand und mehr schlecht als recht von einer gestreiften Markise vor den wirbelnden Flocken geschützt wurde. Ein beleibter Kunde hatte auf dem Stuhl Platz genommen und den Gehstock quer über seine Oberschenkel gelegt. Er funkelte Adeline durch seine runde Brille an, als wäre es sein Knie, durch das gerade ein scharfer Schmerz fuhr. Vor ihm kniete ein spindeldürrer Schuhputzer und wedelte mit einem Lappen über seine Lederschuhe.
»Na, hören Sie mal!«, entrüstete sich der Beleibte.
»Entschuldigung«, stieß Adeline hervor und hastete weiter. Die Gedanken wirbelten durch ihren Kopf wie aufgescheuchte Möwen unten am Hafen. Wen könnte sie um Hilfe bitten? Sie war keine zwei Wochen in New York und kannte kaum jemanden. Außerdem würde ihr Verfolger nicht lange fackeln. Ob er einen Menschen oder zwei umbrachte, machte für ihn keinen Unterschied. Wo also sollte sie hin?
Wieder stieß sie in ihrer Eile gegen einen Passanten. Diesmal war es ein Matrose, der sie mit einem breiten Grinsen bedachte. »Bist du immer so stürmisch, Mädchen? Das gefällt mir! Komm, ich lade dich zu einem Glas Limonade ein!«
Adeline schüttelte nur den Kopf und lief weiter. Ihr Hut – ein hübscher Homespun-Bretonne, der mit Blüten aus schottischer Seide verziert war – saß eh schon schief auf ihren braunen Haaren und rutschte bei jeder Bewegung tiefer über ihr Ohr. Der Schnee machte den Untergrund glatt, sodass sie halb schlitterte, halb rannte.
Die Bowery war eine Geschäftsstraße im Süden von Manhattan. Mit ihren zahlreichen Kunsttempeln, Bordellen und Vergnügungslokalen bot sie Zerstreuung jeglicher Art. Vor Adeline wurde die Tür einer Bar aufgerissen, und ein bärtiger Hüne in zerlumpter Kleidung flog auf den Bürgersteig. Wüste Verwünschungen ausstoßend, rappelte er sich hoch. Adeline wich zur Seite aus und überquerte die Straße. Von links ratterte eine elektrische Straßenbahn auf sie zu. Rechts näherten sich zwei Pferde, die einen Lastwagen zogen. Adeline huschte zwischen den Fahrzeugen über die Straße und stieß auf der anderen Seite auf ein weiteres Hindernis: einen behäbig aussehenden Mann in einer weißen Schürze. Er hatte sich einen riesigen Kessel um seinen Bauch geschnallt: einen tragbaren Ofen! Sie konnte die glühenden Kohlen auf dem Rost darunter erkennen. Der Händler lief am Straßenrand auf und ab und rief: »Wiener Wurst! Schöne heiße Wiener Wurst!«
Die Anstrengung forderte allmählich ihren Tribut: Sein Anblick verschwamm vor ihren Augen. Der verschneite Boden schien unter ihr zu wanken. Taumelnd hetzte Adeline weiter. Vorbei an elegant gekleideten Männern mit Seidenhüten und Brillantnadeln, barfüßigen Kindern und leicht bekleideten Frauen. Endlich blieben der Lärm und die Menschenmassen hinter ihr zurück. Eine verschneite Grünanlage breitete sich vor ihr aus, umgeben von einem schwarzen Gitterzaun. Würde sie hier einen Unterschlupf finden? Sicherheit? An den Rhododendren zeigten sich dicke Knospen. Vereinzelt ragten Krokusse aus dem Schnee. Der Frühling wollte kommen, aber noch war der Winter nicht bereit, das Zepter zu übergeben.
Der Park war verlassen. Das Schneetreiben ließ alles verschwimmen – die tausend Lichtpünktchen im Hafen ebenso wie den hellen Bogenlampenschein an den Straßen. Unter den Bäumen herrschte diffuses Halbdunkel. Der Flockenwirbel wurde von Minute zu Minute dichter, und der Wind wuchs zu einem Sturm an, der in Adelines Haut schnitt wie Nadelstiche. Wenn sie keinen Schutz fand, war der Verfolger bald ihr geringstes Problem. Dann würde sie jämmerlich erfrieren!
Adeline bog von dem schmalen Weg ab, der durch den Park führte, eilte über die verschneite Wiese und blieb neben einer ausladenden Weide stehen, deren Zweige bis zum Boden reichten. Unter dem dichten Geäst lehnte sie sich an den Stamm und gestattete es sich endlich, kurz die Augen zu schließen und zu Atem zu kommen. An anderen Tagen hätte sie allein niemals einen Fuß in die Bowery gesetzt. Bei ihrer Flucht hatte sie jedoch nicht auf den Weg geachtet. Und nun stand sie hier mitten im Unwetter und hatte keine Ahnung, was sie tun sollte. Hatte sie ihren Verfolger abgeschüttelt? Oder war er näher, als ihr lieb sein konnte? Unwillkürlich schaute sie sich um. Nichts war zu sehen, bis auf das undurchdringliche Weiß des Schneesturms, das in ihren Augen schmerzte.
Sie musste jemandem anvertrauen, was sie herausgefunden hatte. Aber wer würde ihr das Ungeheuerliche glauben? Wer?
Die Wunde an ihrem Hals brannte. Adeline tastete danach und bemerkte einen dunkelroten Fleck auf dem Leder ihres Handschuhs. Sie zog ein Taschentuch hervor und tupfte das Blut ab. Das Messer hatte sie lediglich gestreift. Sie hatte noch einmal Glück gehabt. Aber wie lange durfte sie darauf zählen?
Welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch? Während sie überlegte, spürte sie auf einmal eine schwere Hand auf ihrer linken Schulter und schrie auf. »Gehen Sie weg!«
»Adeline, beruhige dich. Ich bin es.« Die Stimme war warm und vertraut. Sie wirbelte herum und sah in ein kantiges Männergesicht. Die Nase war ein wenig krumm und lenkte das Augenmerk auf eine Narbe am Kinn, ein Überbleibsel von der stürmischen Überfahrt nach Amerika. Eine dicke Schicht Schnee bedeckte seinen Hut und seinen Mantel. Sein Atem kam stoßweise und kräuselte sich sichtbar vor seinem Gesicht.
»Albert! Du bist das! Ich bin so froh!« Adeline fiel ihm um den Hals. Sein vertrauter Geruch nach Rasierwasser und Leder hüllte sie ein wie eine warme Umarmung.
Er schob sie sanft von sich. »Was um alles in der Welt treibst du denn hier im Schneesturm?« Er musste seine Stimme heben, weil der Sturm ihm die Worte schier von den Lippen riss. »Du bist ja ganz aufgelöst. Und … sag mal, ist das etwa Blut an deinem Kragen? Jesus, Adeline, bist du verletzt?«
»Das ist nur ein Kratzer, aber … Oh, Albert!« Adeline schluchzte auf. »Wie hast du mich gefunden?«
»Ich habe dich auf der Bowery gesehen und bin dir gefolgt. Du, das ist kein Viertel für dich. Schon gar nicht um diese Uhrzeit. Was hattest du in dieser Gegend zu suchen?«
»Ich musste fort!«
»Warum denn? Was ist passiert?«
»Etwas Schlimmes …« Tränen stürzten ihr aus den Augen. Nun brach sich die Verzweiflung Bahn, die sie die ganze Zeit mühsam zurückgehalten hatte. Furcht schlug über ihr zusammen wie eine eisige Welle und raubte ihr die Fähigkeit, klar zu denken. Sie zitterte unkontrolliert am ganzen Körper.
»Beruhige dich, Linnie. Ich werde nicht zulassen, dass dir ein Leid geschieht. Das verspreche ich dir.« Alberts Kopf ruckte hoch, als hätte er ein Geräusch gehört. Er wollte noch etwas sagen, aber da krachte es plötzlich von rechts! Etwas zischte an Adeline vorbei, streifte den Stamm der Weide und riss ein Stück Rinde ab. Holzstücke zackten in alle Richtungen, eines schnitt in Adelines Wange. Ihr entfuhr ein Schmerzenslaut.
»Grundgütiger, schießt da etwa jemand auf uns?« Sofort schob sich Albert vor sie, sein Rücken bildete einen breiten Schutzwall, aber er war nicht schnell genug! Wieder peitschte ein Schuss auf. Adeline spürte einen harten Ruck an ihrer rechten Schulter. Eine ungeheure Wucht riss sie von ihren Beinen. Rücklings landete sie im Schnee, sodass sämtliche Luft aus ihren Lungen gepresst wurde.
»Adeline!« Albert brüllte etwas.
Der nächste Schuss!
Wir müssen hier weg! Adeline wollte sich aufrichten, aber ihr Körper gehorchte ihr nicht mehr. Graue Schwaden waberten vor ihren Augen wie der Ruß, der aus den Schornsteinen der Dampfschiffe aufstieg. Er hat uns gefunden. Wenn wir hier nicht schleunigst wegkommen, ist alles aus!
2. Kapitel
Nach vierzehn Stunden auf den Beinen war Declan O’Sullivan am Verhungern. Sein Dienst hatte ihn den ganzen Tag auf Trab gehalten. So hatte er keinen Gedanken daran verschwendet, sich nach der Arbeit umzuziehen. Sein blauer Rock und der Knüppel am Gürtel wiesen ihn als Polizisten aus, und vermutlich lag es an seiner Uniform, dass ihm die entgegenkommenden Passanten bereitwillig Platz machten, wie Wasser, das um einen Felsen herumströmt. Möglicherweise aber wollten sie genauso wie er nur schleunigst aus dem elenden Schneesturm heraus.
Die Temperaturen waren schlagartig um zehn Grad gefallen. Dazu kamen der Sturm und das dichte Schneetreiben. Am kommenden Tag würden die Morgenblätter wieder voll mit Nachrichten über erfrorene Menschen sein. Declan hatte früher nicht einmal geahnt, dass die Winter in New York so bitterkalt sein konnten. Inzwischen war er eines Besseren belehrt worden.
Sein Ziel war ein viergeschossiges Haus aus rotem Backstein, über dessen Eingang auf einem roten Schild RESTAURANT geschrieben stand. In den oberen Etagen konnte man billige Zimmer mieten, unten standen kleine runde Tische hinter den Fenstern und luden zur Einkehr ein. Während die Hochbahn ungeachtet des furchtbaren Wetters vorbeidonnerte, nahm Declan am letzten freien Tisch Platz und klopfte sich den Schnee von der Uniform. Speisekarten gab es nicht. Ein Plakat neben der Tür wies jedoch darauf hin, dass jedes Essen fünfundzwanzig Cents kostete.
Ein Kellner mit weißer Schürze trat an seinen Tisch. Unter dem buschigen roten Vollbart zeichnete sich ein breites Lächeln ab. »Guten Abend, Declan. Eine fürchterliche Kälte, was?«
»Das kannst du wohl laut sagen. Schlimmer kann es im berüchtigten Sibirien auch nicht sein. Ich glaube, ich habe vor lauter Kälte heute Nacht sogar auf Russisch geträumt.«
»Dann wollen wir zusehen, dass wir dich rasch wieder aufwärmen. Was soll heute Abend das Deinige sein, Declan?«
»Ich hätte gern ein Beefsteak, bitte.«
»Medium wie immer?«
»Aye. Sag mal, was macht dein schlimmes Ohr, Ian?«
»Frag lieber nicht. Die Schmerzen treiben mich beinahe die Wände hoch und wollen einfach nicht vergehen.«
»Versuch es mit einem warmen Senfwickel. Meine Grandma hat uns Kindern damit geholfen, wenn wir zu lange im Wind unterwegs waren und Ohrenschmerzen hatten.«
»Das werde ich probieren. Inzwischen würde ich sogar Pferdepisse trinken, wenn das nur helfen würde.«
»Das wage ich zu bezweifeln.«
»Ich auch.« Der Kellner grinste schief. »Nimmst du einen Kaffee zu deinem Beefsteak?«
»Aye.«
»Kommt sofort.«
Während der Kellner davoneilte, lehnte sich Declan auf seinem Platz zurück und ließ den Blick schweifen, mehr aus Gewohnheit, denn aus wirklichem Interesse an seiner Umgebung. Der Anblick war jeden Abend derselbe.
An den Nachbartischen beugten sich Gäste über ihre Teller und schlangen ihr Essen hinunter, als gälte es einen Preis zu gewinnen. In New York schien es jedermann eilig zu haben. Immer. Je mehr sich der Tag dem Abend zuneigte, umso belebter wurde die Straße draußen. Niemand schien Anstoß an dem stürmischen Schneetreiben zu nehmen. Tausende Familienväter waren von der Arbeit heimgekehrt. Es war Brauch, nach dem Abendbrot einen Spaziergang mit Frau und Kindern zu machen und dabei die Einkäufe für den kommenden Tag zu besorgen. Paare strebten zu den Theatern und Varietés. Matrosen drängten in die Clubs und Bordelle. Sie liefen vornübergebeugt und stemmten sich gegen den Wind, kaum mehr als muskelbepackte Schemen im dichten Flockenwirbel.
Bei schönem Wetter fanden Orgeldreher und fahrende Musikanten an jeder Straßenecke ein dankbares Publikum. Dann boten Fruchthändler und Zuckerwarenverkäufer ihre Waren feil. Die pyramidenartig aufgestapelten Produkte lockten in der schummrigen Kienspanbeleuchtung zum Kauf. An diesem Abend blieben sie jedoch fern. Vermutlich wären sie im Schneetreiben ohnehin nur über den Haufen gerannt worden.
Declan hatte einem mageren Zeitungsjungen eine Depesche abgekauft und schlug sie nun auf. Das Papier war feucht und wellte sich, aber die Nachrichten waren durchaus noch lesbar. Das Abendblatt strotzte von schauerlichen Sensationen: Hausbrand in der Canal Street. Rattenplage im Kindergarten der Grace Church. Ein Toter bei einem Bankraub.
Er klappte das Blatt zusammen, weil der Kellner heraneilte – auf dem ausgestreckten Arm eine Pyramide aus hoch aufgetürmten Schüsseln und Schüsselchen balancierend, mit einer Selbstverständlichkeit, als sei für ihn das Gesetz der Schwerkraft aufgehoben. Er schob Declan die oberste Schüssel hin, die über die Tischdecke schlitterte und exakt vor ihm stehen blieb. In gleicher Art folgte eine Schale mit Kartoffeln. Die Tasse Kaffee stellte Ian ab. Anschließend legte er ihm ein rotes Pappstück mit dem gestempelten Aufdruck 25 Cents hin. Das war die Rechnung.
Declan nahm sich ein Besteck aus dem Humpen in der Tischmitte. Vor dem Fenster lief eine junge Frau in einem dunklen Paletot vorüber. Ihr Hut war verrutscht, und ihr kämpferisch vorgerecktes Kinn gefiel ihm. Sie schien in großer Eile zu sein und war an ihm vorbei, ehe er einen längeren Blick auf ihr Gesicht erhaschen konnte. Ihr langer Rock jedoch stach ihm ins Auge, denn er war von der Farbe weichen Mooses. Der Anblick versetzte ihm einen Stich, denn es glich dem, was er in New York am meisten vermisste: das weite Grün seiner irischen Heimat.
Hastig verbannte er die Erinnerungen in den hintersten Winkel seines Verstandes. Er tat besser daran, die Vergangenheit zu vergessen, und zwar für immer.
Declan stach gerade sein Messer in das Beefsteak, als von draußen ein spitzer Schrei hereinklang: »Meine Handtasche! Er hat meine Handtasche gestohlen!«
Eine silberhaarige Lady löste ihren Arm von dem ihres Begleiters und deutete die Bowery hinunter. Der junge Mann neben ihr konnte kaum älter als dreizehn Jahre sein und blickte verwirrt drein. Eine große Hilfe würde er ihr nicht sein.
Declan folgte ihrem Fingerzeig. Ein hagerer Mann in zerlumpter Kleidung schob sich hastig durch die Menge – unter dem Arm eine reizende, mit Blumen bestickte Tasche, die nicht zum Rest seines Aufzugs passen mochte. Declan sprang von seinem Stuhl auf. Verflixt noch mal! Den Burschen kannte er doch! Das war Seamus Flannigan, ein Galgenstrick, der sich gern an den Docks herumtrieb und schon öfter verhaftet worden war. Seamus besaß die Gabe, sich aus fast jedem Schlamassel herauszureden. Bisher war er einer längeren Haftstrafe immer entgangen.
Declan bedachte sein Abendessen mit einem bedauernden Blick, warf zwei Münzen auf den Tisch und stürmte los, um den Tunichtgut zu verfolgen. Er riss die Tür des Restaurants auf und schnappte nach Luft, weil ihm eine eisige Böe entgegenfauchte. Seamus war hochgewachsen und überragte die meisten Passanten um Haupteslänge, daher war er leicht zu verfolgen. Declan schob sich durch das Getümmel, sprang mit einem Satz über einen Stapel Kisten, die vor einem Laden lagerten, und schwenkte über auf die Straße. Sich zwischen einer Straßenbahn und einem Automobil hindurchschlängelnd, näherte er sich dem Flüchtenden. Seamus spähte im Rennen über seine Schulter, aber er schaute nur auf den Bürgersteig, nicht auf die Straße. So entging ihm, dass Declan näher kam.
Gleich hatte er ihn! Mit einem Satz sprang der junge Polizist dem Flüchtenden auf den Rücken und brachte ihn zu Fall. Seamus fluchte wie ein Matrose, aber das half ihm nicht. Die Handtasche rutschte ihm aus den Fingern. Declan zerrte die Handschellen aus seinem Gürtel und fesselte seinem Gefangenen die Hände, ehe er wieder aufstand und Seamus mit sich auf die Füße zog.
»Diesmal reicht es für das Arbeitshaus«, knurrte er. »Richte dich auf mehrere Monate bei Wasser und Brot ein.«
Seamus verzog das Gesicht, als hätte er soeben einen vereiterten Zahn in seinem Mund entdeckt. »Komm schon, Declan, lass mich gehen. Du kennst mich doch.«
»Eben darum weiß ich, dass du überfällig bist.«
»Soll ich unserem schönen Land wirklich zur Last fallen?«
»Das wirst du nicht, keine Sorge. Du wirst arbeiten. Vermutlich wird das eine völlig neue Erfahrung für dich.«
Seamus lachte dunkel und schien nicht im Mindesten besorgt zu sein. »Sag bloß, du nimmst es mir immer noch übel, dass ich damals bei der reizenden Betty Erfolg hatte und du nicht? Das ist Jahre her und war in einem anderen Leben. Betty ist vermutlich längst verheiratet und hat ein halbes Dutzend Kinder mit irgendeinem netten Farmer. Vergiss sie endlich.«
»Es geht nicht um Betty, sondern um das Gesetz. Du hast jemanden bestohlen, Seamus.«
»Eine Dame mit einem Pelzkragen und eleganten Lederschuhen, die vermutlich dreimal mehr als meine gesamte Habe gekostet haben. Sie wird die Tasche nicht vermissen.«
»Das glaubst du doch wohl selbst nicht.«
»Sie besitzt höchstwahrscheinlich mehr Geld, als wir beide in unserem ganzen Leben verdienen können. Es wird ihr nicht fehlen, glaub mir. Hör zu, ich bin wie dieser Robin Wood.«
»Du meinst Robin Hood?«
»Das Schlitzohr, das den Reichen nimmt und den Armen gibt.«
»So siehst du dich also, Seamus? Als Wohltäter? Und welchem armen Schlucker hast du deine Beute zugedacht?«
»Mir natürlich.« Die grünen Augen des Iren blitzten.
»Dir ist wirklich nicht mehr zu helfen.«
»Muss man auch nicht. Ich helfe mir schon selbst. Du darfst mir nur keine Steine in den Weg legen, Declan.«
»An Steine denke ich auch nicht. Eher an Gitterstäbe.«
Seamus zuckte zusammen. »Lass mich gehen, Declan. Wir teilen uns, was auch immer wir in der Tasche finden. Nimm es und geh zu Jolene und ihren Mädchen. Lass dich ein paar Stunden verwöhnen. Vielleicht bist du dann nicht mehr so verkrampft, als hättest du deinen eigenen Knüppel im …« Weiter kam er nicht, weil Declan ihn am Kragen fasste und ihn damit zum Schweigen brachte.
»Ge milis am fìon, tha e searbh ri dhìol«, knurrte er.
Seamus gab ein Geräusch von sich, das halb Stöhnen, halb Lachen war. »Der Wein ist süß, das Zahlen bitter«, übersetzte er. »Ist das wieder eine Weisheit deiner Grandma Molly?«
»Wage es nicht, ihren Namen in den Mund zu nehmen.«
»Warum denn nicht? Sie war eine kluge Frau. Ich mochte sie. War verdammt schade, dass sie damals verunglückt ist. Ohne sie war unser Dorf nicht mehr dasselbe.«
Ein wütender Schmerz zerriss Declan beinahe die Brust. Seine Grandma hatte ihn aufgezogen. Ihr Tod hatte eine Lücke hinterlassen, die sich nicht schließen mochte.
Seamus kniff die Augen zusammen. »Sie war eine gute Frau. Anständig. Deine Mutter war anders, nicht wahr?«
Declan brachte ihn mit einem Blick zum Schweigen, der das Wasser im Hafen zu Eis hätte erstarren lassen können.
In diesem Augenblick holten die Dame mit dem Pelzkragen und ihr Begleiter sie ein. Beide atmeten keuchend. Der Bursche bückte sich, hob die Tasche auf und klopfte Schnee und Schmutz von ihr ab, ehe er sie schnaufend an die Ältere weiterreichte.
Sie drückte ihre Habe an sich und atmete hörbar aus. »Haben Sie vielen Dank. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn Sie meine Tasche nicht gerettet hätten. Da drin ist unser Geld für den ganzen kommenden Monat. Hier, bitte, nehmen Sie das.« Sie klappte die Tasche auf und zog einen Geldschein heraus.
Declan schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht annehmen. Ich habe nur meine Pflicht getan.«
Seamus stülpte bedauernd die Lippen vor. Es war unmöglich zu sagen, ob er Reue empfand oder vielmehr Enttäuschung über die entgangene Beute.
»Du kommst jetzt mit mir«, sagte Declan und packte seinen Gefangenen fester, um ihn abzuführen. In diesem Augenblick krachte es ganz in der Nähe. Ein Schuss? Er war selbst über das Tosen des Sturms hinweg zu hören. Alarmiert fuhr Declan herum. Woher war das gekommen? Aus einem der Geschäfte? Nein, aus dem Park!
Schreie gellten. Passanten stoben eilig davon, drängelten und verschwanden in den Bars und Etablissements, welche die Straße säumten. Da! Noch ein Schuss! Und noch einer!
Oh, verdammt noch mal! Er musste nachsehen, was da los war! Declan löste eine Handschelle seines Gefangenen und führte dessen Arme um die Straßenlaterne herum, ehe er ihn wieder fesselte. »Du rührst dich nicht vom Fleck, hast du mich verstanden?«
Seamus verdrehte die Augen.
Declan warf der Lady noch einen Blick zu. Sie war kalkweiß und bebte vor Aufregung und wohl auch vor Entrüstung. Er tippte sich an die Mütze, ehe er mit langen Schritten losstürmte. Der Park war nicht weit. Wenige Minuten später tauchte er zwischen die dicht stehenden Stämme von Ulmen, Weiden und Kiefern ein. Sein Blick suchte die Umgebung ab, aber in dem Flockenwirbel schien alles weiß zu sein. Er konnte niemanden erkennen.
Da raschelte es plötzlich zu seiner Linken.
Sein Herzschlag vervielfachte sich. All seine Sinne waren in Alarmbereitschaft. Er hatte schon zu viel Leid auf den Straßen gesehen und wusste, wie zerbrechlich ein Leben war. Er zog den Knüppel aus dem Gürtel und näherte sich dem Gestrüpp. Zwischen den Zweigen konnte er eine schmächtige Gestalt ausmachen. Es war einer der Zeitungsjungen, die sich für ein paar Cents am Tag die Füße wundliefen und abenteuerliche Schlagzeilen brüllten, um Käufer anzulocken. Die Stiefel des Kindes starrten vor Dreck, und seine blaue Hose mit den Hosenträgern hatte mehr Flicken, als der Himmel Sterne zählte. Eine Jacke schien er nicht zu besitzen, zumindest trug er keine, und das bei diesem Wetter. Das Gesicht des Jungen war so schmutzig, dass man die Züge darunter nur erahnen konnte. Er drückte einen Armvoll Depeschen an seine Brust.
»Tun Sie mir nichts, Mister!«, rief er angstvoll aus.
»Ich werde dir bestimmt nichts tun. Hast du gesehen, wer hier geschossen hat?«
»Das nicht. Nein.«
»Oder auf wen geschossen wurde?«
»Eine Miss und ein junger Mann waren es. Sie hat geblutet. Er hat sie weggetragen.« Die Zähne des Jungen klapperten aufeinander. Ob vor Angst oder vor Kälte war schwer zu sagen.
»Hat der Mann auf sie geschossen?«
»Das glaube ich nicht. Er war auch verletzt.«
»Und wo sind sie hingegangen?«
»D-da lang!« Ein zittriger Zeigefinger wurde ausgestreckt und deutete tiefer in den Park hinein.
»Halte dich hier versteckt, bis ich wiederkomme und dir sage, dass du rauskommen kannst. Hier bist du sicher. In Ordnung?«
»V-verstanden, Sir.« Der Junge nickte und zog sich tiefer in das Gestrüpp zurück.
Declan wandte sich in die Richtung, die ihm das Kind gezeigt hatte, und stürmte los. Tief hängende Zweige peitschten sein Gesicht und zerrten an seiner Uniform, der Sturm stach wie Nadelstiche in sein Gesicht, wirbelte ihm Schnee in die Augen und machte ihn beinahe blind. Aber er achtete nicht darauf. Seine Sinne waren hellwach, und er nahm jedes Geräusch, jede Bewegung auf. Vor ihm gabelte sich der Weg durch den Park.
Wo lang nun? Wo lang?
Declan spähte umher, erhaschte links eine Bewegung und eilte los. Ein Mann krümmte sich im Schnee. Als er Declan bemerkte, wollte er sich hochstemmen, sank jedoch sogleich zurück auf den Boden. Auf seinem Hemd und dem abgewetzten Jackett zeichneten sich dunkelrote Flecken ab. Er war so bleich, dass seine dunklen Augen unheimlich zu glühen schienen. Ein struppiger grauer Bart wucherte an seinem Kinn. Er rollte ein Stück rückwärts weg, kam jedoch nicht weit.
»Bleiben Sie liegen. Ich muss mir Ihre Verletzung ansehen.« Declan beugte sich über den Mann und strich das Jackett zur Seite. Blut quoll ihm entgegen. Viel Blut. Declan hatte genügend Verletzungen in seinem Leben gesehen, um zu ahnen, dass diesem Mann nicht mehr zu helfen war. »Wo ist die Frau?«
»Das … sage ich … nicht.« Die Stimme des Mannes war so rau, als würde sie über ein Waschbrett gezogen. Neben ihm lag ein Revolver im Schnee. Ein 38-er. Declan hob ihn auf und schnupperte daran. Die Waffe war vor Kurzem abgefeuert worden. Er klappte sie auf. Drei Patronen fehlten.
Drei Schüsse. Drei Kugeln. Declan stutzte. Hatte der Zeitungsjunge nicht von einem jungen Mann gesprochen? Dabei konnte es sich unmöglich um diesen Verletzten handeln. Der Mann vor ihm hatte die fünfzig längst überschritten. »Sie waren das, nicht wahr? Sie haben die Schüsse abgefeuert. Aber was ist dann passiert? Haben sich Ihre Opfer gewehrt?«
»Die beiden?« Ein heiseres Gelächter schüttelte den Bärtigen, ging jedoch gleich darauf in ein schmerzerfülltes Stöhnen über. »Die könnten mich nicht verletzen. Dazu sind sie nicht fähig.«
»Aber wer dann? Wer hat das getan?«
»Er war es … hat sich abgesichert. Hat jemanden geschickt, der dafür sorgt, dass ich den Mund halte. Ich … hätte es wissen müssen.« Seine Stimme wurde leiser, war kaum noch zu verstehen.
»Wer hat auf Sie geschossen? Sagen Sie es mir!«
»Das würden Sie mir doch nicht glauben.«
»Lassen Sie es auf einen Versuch ankommen.«
»Es war …« Der Verletzte bäumte sich auf. Blutiger Schaum tropfte von seinen Lippen. Er wollte noch etwas sagen, aber sein Kopf sackte zur Seite. Er war tot.
Declan starrte ihn stumm an, wollte das Offensichtliche nicht wahrhaben, doch von diesem Mann waren keine Antworten mehr zu erwarten. Ein gedungener Mörder war tot. Das lag für ihn auf der Hand. Der Fremde hatte eine Frau und einen Mann umbringen sollen – und dafür mit seinem Leben bezahlt. Damit taten sich mehrere Fragen auf: Wo waren die beiden Menschen, die er töten sollte? Und wer hatte ihn auf dem Gewissen? Sein Auftraggeber? Dieser Verdacht lag für Declan nahe. Aber welcher Mann heuerte einen Mörder an und brachte diesen dann auch um?
Jemand, der eine Menge zu verlieren hat. Jemand mit genügend Macht und Einfluss, um einen Mord mit einem zweiten zu vertuschen. Oh, das gefällt mir gar nicht.
Declans Blick schweifte umher, suchte einen Anhaltspunkt. Irgendeinen Hinweis, dem er nachgehen konnte, um den Verantwortlichen zu finden. Und wo waren die beiden Opfer abgeblieben?
Ich werde Verstärkung rufen. Wir müssen hier alles absuchen. Es ist möglich, dass die beiden Opfer entkommen sind. Dann wird der Unbekannte es höchstwahrscheinlich nicht darauf beruhen lassen. Wenn wir den Auftraggeber nicht erwischen, könnte es noch mehr Tote geben.
Ich habe ein ganz mieses Gefühl …
3. Kapitel
Reverend George Haas war mit seinem Leben rundherum zufrieden. Das Schicksal hatte es gut mit ihm gemeint: Seit zweiundzwanzig Jahren war er der gute Hirte einer blühenden Gemeinde und kümmerte sich mit Hingabe um die Menschen, die ihm anvertraut worden waren. Er galt als fromm und ehrlich und hatte immer eine offene Tür für Hilfesuchende. Er war berühmt für seine Eloquenz bei den sonntäglichen Predigten, aber auch berüchtigt, weil er durchaus von seiner Kanzel wettern konnte, wenn er ein Unrecht erkannt hatte.
New York galt als deutscheste Stadt Amerikas.
Zahlreiche Einwanderer strömten jedes Jahr aus Deutschland nach New York, um ein neues Leben anzufangen. Es war die Hoffnung, welche die meisten von ihnen herführte. Hoffnung auf einen Neuanfang. Einen Platz zum Leben. Ein solides Auskommen. Eine neue Art von Freiheit.
Die meisten deutschen Einwanderer ließen sich in einem Teil der Lower East Side nieder, der als Little Germany bekannt war. Kleindeutschland, wie die Bewohner selbst ihr Viertel nannten, wurde im Osten vom East River und im Westen von der Vergnügungsstraße Bowery begrenzt. Das Herz dieser Gegend war die St. Mark’s Kirche, der George Haas vorstand. Er war kein auffälliger Mann, aber wenn er sprach, hörte man ihm zu. Etwas Bezwingendes lag in seinem Wesen, das seine Kraft entfaltete, wenn er das Wort ergriff. Man sah ihn nie anders als in Schwarz gekleidet. Ein gepflegter, graumelierter Bart zierte Oberlippe und Kinn, und seine braunen Augen blickten hinter einer runden Brille freundlich, offen und stets auch ein wenig nachdenklich.
In den vergangenen Jahren hatte er einen Chor und eine Bibelgruppe für die Erwachsenen gegründet, für die Kinder gab es einen Kindergarten und eine Sonntagsschule. Sein Anliegen war es, den neu Zugewanderten in seiner Gemeinde durch Kultur, Glaube und gemeinsame Erlebnisse zu helfen, in der Neuen Welt zurechtzukommen. Das hektische Leben in der Riesenstadt war ein anderes als daheim. Viele mussten erst lernen, damit zurechtzukommen.
Nicht immer verlief das Einleben gefahrlos. Diese Erfahrung hatte auch Charles Rosenagel machen müssen. Der Tischler war vor wenigen Wochen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern mit dem Schiff angekommen und kämpfte seitdem für das Auskommen seiner Familie. Just an diesem Morgen war er von einem Automobil angefahren worden. Nun lag er im Krankenhaus und würde auf unabsehbare Zeit bei der Arbeit ausfallen. Damit stand seine Familie ohne Einkommen da.
George Haas besuchte Dora und ihre Kinder und brachte ihnen nicht nur einen Korb mit Lebensmitteln, sondern bot Dora auch an, im Kindergarten zu arbeiten. Das würde ihr gestatten, ihren Nachwuchs im Auge zu behalten und ein paar Dollar in der Woche zu verdienen.
Die Familie lebte zu viert in einer Ein-Zimmer-Wohnung eines Mietshauses. Es gab kein fließendes Wasser, und die Außentoilette mussten sie sich mit den Nachbarn teilen. Der einzige Raum war vollgestopft mit Möbeln. Wäsche hing auf einer Leine über dem Waschtisch. Die Luft war schwer und roch nach dem Kohlefeuer im Ofen. In einer Ecke stand ein Schaukelstuhl aus altem Nussbaum mit zahlreichen Decken und Kissen darauf. Darüber war ein Tuch an der Wand festgemacht, welches mit blauem Garn bestickt war. Rings um einen Blumenkorb stand in verschnörkelten Lettern zu lesen: Ein jeder Schmerz lässt sich verwinden, und jede tiefe Wunde heilt, nur eine Seele musst du finden, die alle Schmerzen mit dir teilt.
Dora Rosenagel war unübersehbar schwanger, und es war offensichtlich, dass die Familie bald ein größeres Zuhause brauchen würde.
Sie trug ihre Jüngste auf der Hüfte und bot ihrem Gast höflich eine Tasse Kaffee an. Das Getränk schmeckte, als hätte sie den Kaffeesatz mehrfach aufgebrüht, aber er wurde in einer liebevoll bemalten Porzellantasse mit Goldrand serviert.
George Haas nahm einen langen Schluck. »Gibt es schon Nachricht, wie es deinem Mann geht, Dora?«
»Der Doktor weiß noch nicht, wie lange er im Krankenhaus bleiben muss. Charles hat viel Blut verloren.« Dora presste ihre Lippen zu einem Strich zusammen, sodass sie beinahe weiß erschienen. Ihre aschblonden Haare waren zu einem Knoten gebunden. Darüber trug sie eine weiße Haube. Der harte Zug um ihren Mund ließ sie älter wirken, als sie vermutlich war. »Charles hätte besser aufpassen müssen. Er ist direkt vor das Automobil gelaufen.«
»Die Straßen sind hier gefährlicher als daheim. Alles geht schneller. Darauf müssen wir uns einrichten.«
»Diese Automobile sind modern, aber ich glaube nicht, dass sie eine Zukunft haben werden. Sie sind viel zu gefährlich.«
»Wer weiß, wohin sich der Fortschritt entwickeln wird. Wir sollten mit offenen Herzen in die Zukunft gehen.«
»Ohne meinen Charles …« Sie stockte und legte eine Hand auf ihren Bauch, der sich deutlich unter der gestreiften Wirtschaftsschürze abzeichnete. Die zweijährige Lillian auf ihrem Arm hustete.
»Dora, ihr benötigt dringend eine größere und vor allem trockenere Wohnung.« George Haas blickte bezeichnend auf die dunklen Flecken an der Zimmerdecke. »Ich werde eine Anzeige im St. Mark’s Monthly veranlassen und nach einem neuen Zuhause für euch suchen. Mit Gottes Hilfe finden wir bald etwas Geeignetes für euch.«
»Eine größere Wohnung können wir uns nicht leisten«, flüsterte Dora.
»Auch da wird sich Rat finden. Vorerst kannst du im Kindergarten arbeiten, wenn du das möchtest.«
»Natürlich. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie an mich gedacht haben.«
»Dann ist das also abgemacht. Du kannst morgen anfangen.« George Haas leerte seine Tasse und setzte sie vorsichtig auf dem Holztisch ab. Die Tischdecke war sorgfältig geflickt und bestechend sauber. Er erhob sich von seinem Platz, zwinkerte dem vierjährigen Elias zu, der sich schüchtern hinter die Schürze seiner Mutter duckte, als diese ebenfalls aufstand, und verabschiedete sich mit dem Versprechen, in den nächsten Tagen wiederzukommen und sich nach dem Ergehen von Charles Rosenagel zu erkundigen.
Der Sturm riss ihm die Haustür beinahe aus den Händen. Es schneite heftiger als noch vor einer halben Stunde. Reverend Haas knöpfte seinen Mantel zu, senkte den Kopf und trat den Heimweg an. Der Geruch von Kohl, Urin und Kohlefeuer in der Wohnung war bedrückend gewesen. Dazu die feuchte Luft … Nein, gesund war das alles sicherlich weder für die schwangere Dora noch für ihre Kinder. Sie brauchten wirklich dringend ein anderes Zuhause. Er würde sich in seiner Gemeinde umhören, ob irgendwo zwei Zimmer für die Familie frei waren.
Solcherart in Gedanken versunken, kämpfte er sich gegen den Sturm nach Hause. Der April zeigte sich in diesem Jahr wechselhaft und launisch. Bald versprachen milde Temperaturen, dass endlich der Frühling anbrach, dann wieder fegten bitterkalte Stürme durch die Stadt und brachten späte Schneefälle und Kälte mit. Viele Einwohner von Little Germany litten an Fieber und einem hartnäckigen Husten. Nach dieser Nacht würden es sicherlich noch mehr werden.
Unterwegs kamen ihm einige Passanten entgegen, die nach dem Abendbrot noch Besorgungen machten, ganz ungeachtet des Wetters. Gewohnheiten waren den Bewohnern des Viertels wichtig. Sie hielten daran fest, da interessierte sie auch kein Schneesturm, der über ihre Stadt hinwegfegte. Grüße wurden gewechselt. Die Einwanderer brachten kaum Geld, dafür aber Fleiß, Ideale und ein gutes Handwerk mit. Und sie arbeiteten hart, um sich eine Zukunft in der Neuen Welt zu schaffen. Die Handelszweige waren nach den Regionen verteilt, aus denen die Zuwanderer kamen. Die Norddeutschen beherrschten den Kram- und Gemüsemarkt, während die Süddeutschen vorzügliches Bier lieferten. Die Fleischer und Bäcker kamen häufig aus dem Schwabenländle.
George Haas lenkte seine Schritte nach Hause. Er wohnte mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im Haus Nummer 64 in der 7th Street. Das Gebäude war aus rotem Backstein errichtet und verfügte über vier Etagen und hohe Fenster, die mit hölzernen Läden vor Wind und Wetter geschützt werden konnten. Zehn Stufen führten zum Hauseingang hinauf. Auch sie waren an diesem Abend tief verschneit.
Am Sonntag werde ich in meiner Predigt zur Vorsicht mahnen, sann der Reverend. Der Verkehr auf den Straßen wird immer schneller. Wir müssen Acht geben, dass wir … Weiter kam er mit seinen Überlegungen nicht, weil keine zwei Armlängen vor ihm ein Fremder um die Hausecke taumelte und geradewegs auf ihn zukam. Er war so blass, dass sein Gesicht mit dem weißen Schneegewirbel gespenstisch verschwamm. Auf seinen Armen trug er eine junge Frau. Sie schien nicht bei Bewusstsein zu sein. Sie rührte sich nicht, und ihr Arm hing schlaff herunter. Zudem blutete sie an der Wange und am Hals, und auch sie war erschreckend blass.
»Bitte, helfen Sie … Adeline!«, stieß der Unbekannte heiser hervor. Er sprach Deutsch, aber in Little Germany hatte der Reverend ihn noch nie gesehen. Plötzlich verließen den Fremden die Kräfte. Seine Beine knickten unter ihm ein wie Zündhölzer, und er hätte seine kostbare Last wohl auf den verschneiten Gehweg fallen gelassen, hätte der Reverend nicht die Geistesgegenwart besessen und seine Arme ausgestreckt, um ihn zu stützen. So sanken sie zusammen auf die Stufen vor dem Hauseingang. Der lange grüne Rock der Fremden und ihr Paletot waren feucht, aber die dunklen Flecken auf dem Stoff schienen nicht nur vom geschmolzenen Schnee zu kommen. Das war auch Blut!
Der Unbekannte kniete auf dem Boden und krümmte sich. Seine Schultern hingen schlaff nach unten. Sein Atem kam schwer und mit jedem Zug langsamer, als würde ihn das Luftholen zu sehr anstrengen. Er konnte nicht mehr als zwanzig Jahre zählen, aber in diesem Augenblick war sein Gesicht grau und zerfurcht wie das eines alten Mannes.
»Kommen Sie mit ins Haus. Ich werde einen Arzt rufen.«
»Adeline. Ihr Name ist Adeline. Helfen Sie ihr, bitte. Und keine … Polizei. Können denen … nicht … trauen.«
»Keine Polizei? Haben Sie beide etwas angestellt?«
»Wir …« Ein Röcheln schnitt dem Unbekannten das Wort ab.
»Sagen Sie mir doch, was Ihnen zugestoßen ist.«
»Er war es. Er …«
»Wer? Von wem sprechen Sie? Wer hat Ihnen das angetan?« George Haas wartete auf eine Antwort, aber es kam keine. »Wie heißen Sie?«
»Albert …« Der Unbekannte stöhnte etwas Undeutliches. Seinen Nachnamen? Das war unmöglich zu sagen.
»Ich nehme Sie jetzt erst einmal mit in meine Wohnung, Albert. Dort kann ich mir Ihre Verletzungen ansehen und jemanden nach dem Arzt ausschicken.« Der Reverend hob die junge Frau auf seine Arme und erschrak bis ins Mark, weil der Unbekannte auf einmal zur Seite kippte und reglos auf dem Bürgersteig liegen blieb. »Aber … nein! Kommen Sie, junger Mann, Sie können mir hier nicht einfach wegsterben! Sie müssen …« Er verstummte, als ihm dämmerte, dass es keine Hilfe mehr für den Fremden gab. Der junge Mann war tot. Reverend Haas senkte den Kopf und sprach ein leises Gebet.
Dem Unbekannten hatte er nicht mehr helfen können, aber er würde auf keinen Fall zulassen, dass ihm die junge Frau in den Tod folgte. Der Unglückliche hatte seine letzten Kräfte aufgebracht, um sie zu retten. Dieses Opfer durfte nicht vergebens gewesen sein!
Vielleicht hätte er überlebt, wenn er sich selbst Hilfe gesucht hätte, stattdessen hat er diese junge Dame hergebracht. Sie muss ihm wichtig gewesen sein. Er hat sein Leben geopfert, um ihres zu retten. Das Mindeste, was ich für ihn tun kann, ist, seinen letzten Wunsch zu erfüllen und mich um sie zu kümmern. Adeline braucht einen Arzt.
Und das schleunigst!
4. Kapitel
Heiße und kalte Schauer schüttelten sie. Sie schwitzte und fror gleichzeitig, zusätzlich verspürte sie ein scharfes Brennen in ihrer rechten Schulter. Weiße Schwaden waberten vor ihren Augen, als würde sie sich in einer Waschküche befinden, in der Weißwäsche ausgekocht wurde. Sie blinzelte, aber es war furchtbar anstrengend, die Augen offen zu halten. Ihre Lider sanken zugleich wieder nach unten. Verflixt!
Sie wollte unbedingt wissen, wo sie war, und kämpfte darum, die Augen wieder aufzuschlagen. Beim zweiten Versuch ging es leichter. Sie kannte das Zimmer nicht, in dem sie sich befand. Es war klein, aber behaglich eingerichtet: mit einer grün gestreiften Tapete und Möbeln aus Nussbaumholz. Ein Schreibpult stand am Fenster. Daneben war eine Staffelei aufgebaut. Das Bild war mit einem Tuch aus vergilbtem Linnen verhängt. Der schwache Geruch von Ölmalfarbe ging davon aus. Ein wuchtiger Kleiderschrank und eine Kommode vervollständigten die Einrichtung.
Den Boden bedeckte ein Orientteppich mit braunen und cremefarbenen Ornamenten. Eine Gaslampe baumelte von der Decke, brannte jedoch nicht. Stattdessen wurde der Raum von einer Petroleumleuchte erhellt, die neben dem Bett auf einem Hocker stand.
Wo bin ich hier nur?
Das Zimmer fühlte sich fremd an. Überhaupt alles fühlte sich fremd an.
Sie lag in einem weiß bezogenen Bett, und das eiserne Gestell quietschte unter ihr, als sie sich mühsam aus den weichen Federkissen hochkämpfte. Ein heftiger Drehschwindel erfasste sie. Sie stieß einen Wehlaut aus und sank zurück auf das Bett. Ich gehöre nicht hierher, ging es ihr durch den Kopf. Wenn ich nur wüsste, wo ich bin und … wer … Ein heißer Schreck fuhr ihr durch den Körper und vertrieb sekundenlang jede andere Empfindung. Sie zerbrach sich den Kopf, aber ihr wollte partout nicht einfallen, wie ihr Name war.
Das gab es nicht! Das konnte einfach nicht sein. Sie musste doch wissen, wie sie hieß! Doch so sehr sie auch grübelte, sie vermochte sich nicht darauf zu besinnen. Dabei hatte sie das Gefühl, ihr Name wäre hinter einem dichten Brokatvorhang verborgen, den sie nur zur Seite schieben musste, dann würde er ihr wieder einfallen. Doch es gelang ihr nicht. Eine Sperre in ihrem Kopf verhinderte, dass sie auf ihre Erinnerungen zugriff.
Unvermittelt klopfte es an der Tür. Sie schwang auf, und eine schlanke, hochgewachsene Frau trat ein. Sie mochte in mittleren Jahren sein und trug ihre dunklen Haare zu einem eleganten Knoten geschlungen. Mit den hohen Wangenknochen und den dunklen Augen war sie ausgesprochen hübsch. In den Händen trug sie eine Schüssel mit Wasser, und über ihrem Arm lagen mehrere Tücher. Ein erleichtertes Lächeln huschte über ihr schmales Gesicht.
»Du bist wach. Ich bin ja so froh! Aber du solltest noch nicht sitzen. Der Arzt sagt, du hast viel Blut verloren und brauchst Ruhe.« Die Unbekannte sprach Deutsch. Aus irgendeinem Grunde wunderte sie das.
»Wo …« Das Sprechen fiel ihr schwer. Jedes Wort kam so mühsam, als hätte sie einen Flusskiesel im Mund. »Wo bin ich?«
»Oh, natürlich, das weißt du nicht. Du warst nicht bei Besinnung, als man dich zu uns brachte. Hab keine Angst, du bist in Sicherheit. Ich bin Anna Haas. Mein Mann ist Reverend George Haas, der Pfarrer der Gemeinde St. Mark’s.«
Die Namen sagten ihr nichts. Sie tastete nach ihrer Schulter und zuckte zusammen. Sie spürte nicht nur einen Verband, sondern auch einen scharfen Schmerz.
Sorge huschte über das Gesicht der Pfarrersfrau. Sie stellte die Schüssel neben dem Bett ab und zog sich einen Stuhl heran. »Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Ich werde sie dir beantworten, so gut ich kann, aber nun leg dich erst einmal wieder hin, ehe deine Wunde aufbricht.«
»Welche Wunde?«
»Du wurdest angeschossen. Weißt du das nicht mehr?«
Sie schüttelte benommen den Kopf. Angeschossen? Wirklich? Sollte sie sich nicht daran erinnern? Aber da war nichts in ihrem Kopf. Kein Bild. Keine Erinnerung. Nur ein dichter, zäher Nebel und ein dumpfer Schmerz, der schlimmer wurde, während sie versuchte, Zugang zu ihrer Erinnerung zu erhalten.
»Die Kugel ist glatt durch deine rechte Schulter gegangen. Der Arzt hat die Wunde mit Lysollösung gereinigt und genäht. Er hat auch die Verletzungen an deinem Hals und deiner Wange versorgt.« Eine Furche grub sich zwischen den geschwungenen Brauen der Frau ein. »Du hast einiges mitgemacht, aber hier hast du nichts mehr zu befürchten, das verspreche ich dir.«
Verletzungen an ihrem Hals? Und an der Wange? Sie tastete nach ihrem Gesicht und zuckte zusammen. Die Berührung brannte.
»Hast du Schmerzen in der Schulter? Der Arzt hat mir eine Opiumtinktur für dich dagelassen. Ich darf dir mehrmals täglich einige Tropfen davon auf Zucker geben. Willst du gleich etwas davon einnehmen?«
Opium? Nein, lieber nicht! Die Tropfen würden ihren Verstand nur noch mehr umnebeln, deshalb hob sie matt abwehrend eine Hand. »Später«, wisperte sie. »Wo bin ich hier?«
»Du bist in unserem Haus. Dieses Zimmer bewohnt sonst mein Sohn, aber du kannst gern bleiben, solange es nötig ist. George Jr. schläft solange im Zimmer seiner Schwester.«
»E tut mir leid. Die Umstände …«
»Das macht doch nichts, Liebes. Gertrude ist selig, ihren Bruder bei sich zu haben. Sie hat oft Albträume. Es hilft ihr, nicht allein zu schlafen.« Anna Haas nickte ihr begütigend zu. »Mach dir keine Sorgen. Du bist uns willkommen, Adeline.«
»Adeline?« Der Name fühlte sich fremd an. Wie ein Mantel, der ihr nicht gehörte. »Heiße ich so?«