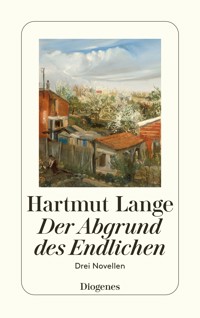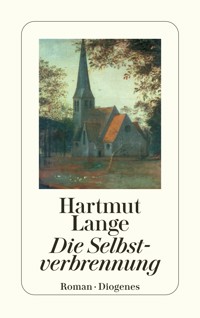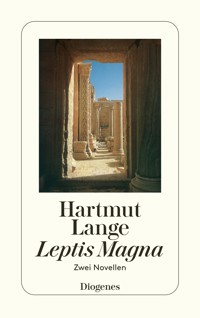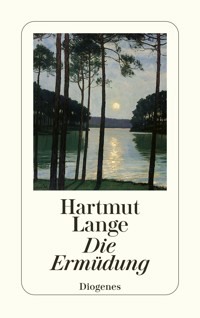8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Deutsche Historische Museum in Berlin – ein »Schuppen voller Plunder«? Oder ein Ort, der Geschichte sichtbar macht? Mit Sicherheit ein Ort der irritierenden Erscheinungen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Hartmut Lange
Im Museum
UnheimlicheBegebenheiten
Die Erstausgabe
erschien 2011 im Diogenes Verlag
Umschlagfoto von
Ralph Than (Ausschnitt)
Copyright © Ralph Than
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24228 7 (1.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60312 5
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Ich bedanke michfür die Mitarbeit meiner Frau
[7] Die Literatur hat ihreneigenen Wahrheitsgrund
[9] I
Das Deutsche Historische Museum ist eine touristische Attraktion. Man kennt die mehr oder weniger geschmackvoll dekorierten Hallen und Zimmer, die dem Besucher so etwas wie Geschichte vortäuschen sollen. Verrottete Tongefäße und Bestecke sollen an die Koch- und Essgewohnheiten des mittelalterlichen Aachen erinnern, verbeulte Blechhelme und Musketen an die Zerstörung Magdeburgs während des Dreißigjährigen Krieges. An den Wänden sind Bilder und Möbel, aber auch Landkarten verteilt, die dem biedermeierlichen Wien oder Leipzig oder Nürnberg die Aura des Unvergessenen oder Wiederentdeckten verleihen sollen. Sicher, die gereinigte, aber verfärbte Uniform Friedrichs des Großen verführt dazu, länger als nötig im grellen Licht eines Schaukastens zu verweilen, aber wenn man das obere Stockwerk und damit anderthalb Jahrtausend deutscher Geschichte durchschritten hat, wird man das Gefühl von Ernüchterung nicht los. Ist es wirklich möglich, denkt [10] man sich, die unendlichen Räume des Vergangenen mit ein paar restaurierten und zusammengetragenen Rudimenten herbeizuzaubern?
Das Gebäude selbst, in dem das Museum untergebracht ist, wirkt imposant. Es ist ein Barockbau, dessen Eingangsfront einhundert Schritte misst und dessen Bedeutung und Schönheit in allen einschlägigen Lexika nachzulesen ist, und wenn man es von der Straße Unter den Linden aus betritt, wenn man die Drehtür, die in den Kassenraum führt, hinter sich hat, bewundert man die Weitläufigkeit der Treppenaufgänge.
Dies geschieht am Tage, genauer zwischen zehn Uhr morgens und sechs Uhr nachmittags, solange das Museum geöffnet ist. Danach, wenn der letzte Besucher gegangen ist, werden die Kassenschalter geschlossen. Das Personal verschwindet, überall, in den Ausstellungshallen, den Treppenaufgängen, der Buchhandlung, aber auch in den Diensträumen, wird es still. Die Heizkörper werden allmählich kälter, und in den Sommermonaten dauert es lange, bis es zu dämmern beginnt. Jetzt aber, Anfang Januar, wird es, obwohl die Notbeleuchtung brennt, schlagartig dunkel, und nur über dem Glasdach im Schlüterhof hält sich ein schwacher Schein. Über den Erdgeschossfenstern erkennt man die Kartuschen mit den berühmten, von Andreas Schlüter [11] entworfenen Gigantenhäuptern: sterbende Gesichter mit qualvoll aufgerissenen Mündern, deren Anblick, und besonders in diesem Zwielicht, kaum auszuhalten ist. Eilig versucht man, über eine Rolltreppe hinweg in den angrenzenden Neubau zu gelangen, erreicht ein freundliches, in moderner, kühner Architektur errichtetes Vestibül. Hier setzt man sich, ist froh, dass man durch die Front unverhängter Glasscheiben endlich ins Freie, auf den von Straßenlaternen beleuchteten Festungsgraben sehen kann. Hat sich der Besuch gelohnt?
›Ja, doch‹, denkt man, aber natürlich: Die Unübersichtlichkeit eines solchen Gebäudes, das auf einer achttausend Quadratmeter großen Fläche achttausend Exponate ausstellt, ist derart, dass man zuletzt Mühe hat, die Eindrücke, denen man ausgesetzt ist, zu ordnen.
Achttausend Exponate! Dies ist allerdings ein Angebot, das verwaltet werden muss, genauer: Man muss dafür sorgen, dass die Hallen, Zimmer und Treppenaufgänge regelmäßig gesäubert und gelüftet werden. Das Personal muss, wenn der Besucherstrom einsetzt, pünktlich zur Stelle sein, um an den Kassenschaltern die Eintrittskarten auszugeben oder an der Garderobe Mäntel und Jacken in Empfang zu nehmen. Es muss darauf achten, dass nur [12] jene, die gezahlt haben, eingelassen werden, und in der Ausstellung selbst wird jeder, der sich darin bewegt, auf Schritt und Tritt beobachtet. Man kennt jene unauffälligen, sich diskret im Abseits haltenden Gestalten, die immer dann hervortreten, wenn der Verdacht besteht, man würde sich dem, was man betrachtet, allzu sehr nähern, und wer seinen Mantel, anstatt ihn an der Garderobe abzugeben, lose über dem Arm trägt, der wird höflich aufgefordert, ihn wieder anzuziehen.
Sicher, manchmal kann es vorkommen, dass jemand von dem Personal, zum Beispiel eine Frau, die stundenlang ihren Verpflichtungen nachgekommen ist, müde wird. Dann steht sie für Augenblicke im Weg, bemüht sich, in ihrem dunkelblauen Anzug besonders gerade zu stehen. Man lächelt ihr zu, ist versucht, ein paar Worte mit ihr zu wechseln. Sie aber, die verpflichtet ist, den Bereich, den man ihr zugewiesen hat, nicht aus den Augen zu lassen, geht weiter, und falls sie eine Gelegenheit findet, sie müsste nur wenige Meter vom Gang aus ins Innere, dorthin, wo man Stellwände errichtet hat, treten, könnte sie sich, obwohl es den Vorschriften widerspricht, setzen. Dies geschieht auch, und manchmal sieht man, wie sie mit jemandem, der ebenfalls zum Aufsichtspersonal gehört, leise redet, bis ein Besucher auftaucht. Dann trennen sich die beiden, und [13] jene, die einen guten Kopf kleiner ist als der andere und die das linke Bein leicht nachzieht, tritt auf den Gang zurück und stellt sich, ein Anblick, der etwas Komisches hat, neben die Statue Karls des Großen.
Sie sieht auf die Armbanduhr. Es ist fünf Uhr nachmittags, und in einer Stunde, so lange gilt es noch durchzuhalten, würde jene, die Margarete Bachmann heißt, wieder in der Garderobe sein, um die Kleider zu wechseln. Sie würde den Dienstplan für den nächsten Tag entgegennehmen, und vielleicht würde sie noch zum Discounter gehen, um dann gegen Abend endlich die Beine unter dem Sofatisch auszustrecken. Ihre Wohnung ist klein. Da ist das Zimmer mit dem Vertiko, auf dem allerlei Nippes steht: ein geschnitzter Engel aus Holz, daneben ein Elefant aus Porzellan und wieder daneben, in einem silbernen Rahmen, das Foto eines jungen Mannes. Das Sofa, auf dem sie sitzt, ist viel zu groß, so dass zwischen Lehne und Vertiko kaum Platz bleibt, um die Schubladen zu öffnen. Vor dem Fenster steht eine Zimmerpflanze, und die Tür zur Rechten führt in eine Art Kammer, in der sie schläft. Lebt sie allein? Allerdings. Margarete Bachmann ist seit über zehn Jahren geschieden, und ihr Sohn, der auf dem eingerahmten Foto zu sehen ist, wohnt irgendwo in der Nähe von Ingolstadt. Wo genau, kann sie nicht sagen. Der Wasserkessel pfeift. [14] Margarete Bachmann erhebt sich, geht in die Küche, um Kaffee aufzubrühen. Sie macht sich zwei Scheiben Brot zurecht, gießt etwas Milch in die Tasse, dann sitzt sie wieder auf dem Sofa und überlegt, ob sie den Fernseher einschalten soll. Und wenn jetzt das Telefon klingelt und der Sohn, was selten genug vorkommt, sich nach ihrem Wohlergehen erkundigt, dann, ja dann kann man sicher sein, dass sie für den Rest des Abends bessere Laune hat, und die Nacht über hat sie einen guten Schlaf. Dies macht Margarete Bachmann, bevor sie am nächsten Tag mit der Arbeit beginnt, gesprächig, so dass man sie, während sie mit den Kollegen die Treppe hinaufgeht, laut reden hört. Aber kaum beginnt sie mit ihrem Rundgang, lässt sie die Schultern hängen, blickt ohne Interesse hierhin und dorthin, als gäbe es in dem Haus überhaupt nichts, wofür es sich lohnte, aufmerksam zu sein, und eines Morgens war da etwas, das sie irritierte: Es zog von irgendwoher, so dass sie gezwungen war, den obersten Knopf ihrer Bluse zu schließen.
Das Areal, in dem Margarete Bachmann unterwegs war, befindet sich im ersten Stock. Hier wird das Vordringen der Römer bis zum Rhein und zur Donau dokumentiert. Man sieht Mosaiken und Grabstelen, findet Hinweise, dass die Kultur der Kelten [15] unterging, die der Germanen ihre Eigenständigkeit erst mit der Krönung Karls des Großen wiedererlangte. Man wird durch das Mittelalter geführt, sieht frei schwebende Spieße und Harnische, exotisch anmutendes Rüstzeug aus dem Iran, und hinter der Statue eines gotischen Reiters biegt man, dem Gang folgend, nach rechts ab und befindet sich schon im 17.Jahrhundert. Man geht weiter, sieht, wenn man die Längsfront des Museums hinter sich gelassen hat, eine Art Pavillon mit der Büste des Marquis de Lafayette und dahinter eine hölzerne Treppe, die auf eine Empore führt. Links die Portraits von Schiller, Goethe und Klopstock, auf der anderen Seite eine Vitrine mit Druckerzeugnissen aus dem späten 18.Jahrhundert und geradeaus, direkt vor dem Treppenabsatz, zwei Gemälde des Engländers John Opie. Das Licht ist hier erträglich, das Zeitalter irgendwie vertraut. Keine geisterhaften, frei schwebenden Gestalten mehr, und auch die wenigen Meter bis zur Französischen Revolution, zu den Gemälden Dantons, Robespierres und Napoleon Bonapartes, wirken keineswegs, obwohl sie an eine Schreckensherrschaft erinnern, einschüchternd oder ungemütlich. Und damit wären wir schon am Ende dessen, was Margarete Bachmann zu beaufsichtigen hatte. Über die Leuchttafel, die die Ära Metternichs und damit den [16] Beginn des Biedermeier signalisiert, ging sie nie hinaus, und hier hatte sie auch wieder eine Gelegenheit, sich zu setzen.
So vergingen der Januar und die erste Februarwoche, dann aber geschah etwas, womit Margarete Bachmann nicht gerechnet hatte, und es war ihr unmöglich, ihre Freude zu verbergen. Ihr Sohn hatte sie besucht, war auch bereit gewesen, ein paar Nächte die enge Wohnung mit ihr zu teilen, und am letzten Tag, bevor er wieder abreiste, hatte er darauf bestanden, mit ihr ins Museum zu gehen. Offenbar wollte er wissen, womit sie den Tag über beschäftigt war, und so sah man, wie die Mutter, nachdem sie den Sohn ihren Kollegen vorgestellt hatte, wie sie ihn mit sichtlichem Stolz, sie hatte rote Flecken im Gesicht, hierhin und dorthin führte, an enggestellten Wänden und Schaukästen vorbei, durch abseitsgelegene, spärlich beleuchtete Zimmer, die sie vorher nie betreten hatte, und dabei redete sie ununterbrochen.
Anfangs hörte der Sohn ruhig zu, auch noch, als sie an dem Gemälde Napoleon Bonapartes vorbei jene Abteilung betraten, die Margarete Bachmann immer gemieden hatte, aber weiter darüber hinaus, dort, wo flimmernde Leinwände die Kämpfe des Ersten Weltkriegs dokumentierten, begann er sich von der Mutter zu lösen. Sie blieb zurück, [17] während er, der Sohn, mit dem Anblick versinkender Schiffe beschäftigt war. Der Eifer des Dreißigjährigen wirkte komisch, und dass er sich besonders dort, wo irgendwelche Hebel und anderes Gerät zu bedienen waren, wo man alte Maschinen in Bewegung setzen konnte, dass er sich besonders dort länger als nötig aufhielt, dies veranlasste die Mutter zu erklären, dass es, und vor allem im Erdgeschoss, interessantere Dinge zu sehen gäbe.
»Zum Beispiel den Schlüterhof«, sagte sie, erklärte, dass es ihr leider nicht erlaubt sei, ihn dorthin zu begleiten, versicherte aber, dass sie an der Treppe auf ihn warten würde.
»Gut«, sagte der Sohn und ging die wenigen Stufen hinab ins Erdgeschoss. Eine halbe Stunde verging, und Margarete Bachmann stand immer noch da, wartete darauf, den Sohn wieder zu sehen, und je länger dies dauerte, desto ungeduldiger sah sie auf die Uhr.
›Was macht er dort unten so lange‹, dachte sie, entschloss sich, was sie doch hatte vermeiden wollen, ebenfalls in den Schlüterhof zu gehen.
Das Aufsichtspersonal stand gähnend herum und sah verwundert auf jene, die, kaum dass sie aufgetaucht war, wieder verschwand.
›Er wird im Nordflügel sein‹, dachte Margarete Bachmann, und Sekunden später fand sie sich [18] inmitten von Hakenkreuzfahnen und Spruchbändern wieder.
Man könnte jetzt ihre Aufregung beschreiben und dass die roten Flecken in ihrem Gesicht, da es ihr nicht gelang, den Sohn zu entdecken, immer stärker wurden oder dass sie, in die Eingangshalle zurückgekehrt, für Augenblicke versucht war, jenen, der an der Drehtür stand, zu fragen, ob ein junger Mann mit einer karierten Jacke vor kurzem das Museum verlassen hätte. Aber auch das hatte sich irgendwann erledigt. Zuletzt stand Margarete Bachmann wieder mit hängenden Schultern an der Treppe im oberen Stockwerk, an eben jener Stelle, an der sie sich mit ihrem Sohn verabredet hatte.
›Er ist längst in der Wohnung, um seine Tasche zu holen. Und er wird den Schlüssel in den Briefkasten werfen. Vielleicht hinterlässt er ein paar Zeilen‹, dachte sie, wusste aber, dass dies etwas war, worauf sie nicht hoffen durfte.
Seit diesem letzten Besuch ihres Sohnes, seit es Anlass gegeben hatte, sich zu empören, er war ohne ein Wort des Abschieds, hatte nicht einmal die Schlüssel in den Briefkasten geworfen, einfach verschwunden, seit Margarete Bachmann das hatte hinnehmen müssen, hielt sie sich ungern in ihrer Wohnung auf, und nun war ihr das endlose Auf-und-ab-Gehen in [19]