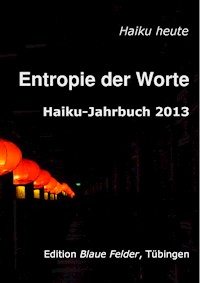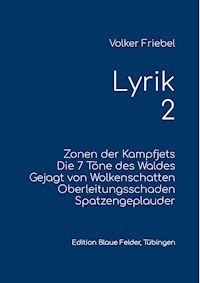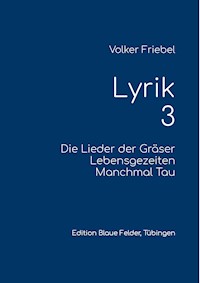9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Fachbuch über Imagination und imaginative Techniken. Die beiden ersten Teile stellen die wissenschaftlichen Grundlagen vor. Im dritten Teil wird die Verwendung imaginativer Techniken in psychotherapeutischen Schulen aufgezeigt. Der vierte Teil bietet Vorschläge und Materialen zur direkten praktischen Anwendung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Volker Friebel
Innere Bilder
Imaginative Techniken im Alltag
und in der Psychologie
Edition Blaue Felder, Tübingen
Edition Blaue Felder,
Denzenbergstraße 29, 72074 Tübingen (Deutschland)
www.Blaue-Felder.de
Texte, Fotografie und Gestaltung: Volker Friebel
Neuausgabe: Mai 2015
Die Erstausgabe erschien 2000 im Walter-Verlag, Düsseldorf
Alle Rechte vorbehalten
ISBN PapierBuch: 978-3-936487-79-4
ISBN eBuch, epub-Format: 978-3-936487-80-0
Inhalt
Vorwort
Grundlagen innerer Bilder
Die Innenseite der Welt
Gehirn und inneres Bild
Entwicklung der Imagination
Gedächtnis
Denken
Kreativität
Innere Bilder im Alltag
Körperschema
Icherfahrung
Beeinflussung biologischer Vorgänge
Mentales Training
Entspannungsförderung
Schmerzbeeinflussung
Immunsystem
Krankheitsverlauf
Sucht
Traum
Halluzinationen
Erscheinung Verstorbener
Drogenvisionen
Hypnagoge Halluzinationen
Erotische Bilder
Aufgedeckte Erinnerungen
Bilder in der Sprache
Werbung
Innere Bilder in psychotherapeutischen Schulen
Aktive Imagination
Gelenkter Wachtraum nach Desoille
Katathym-imaginative Psychotherapie
Gestalttherapie
Systematische Desensibilisierung
Verhaltenstherapeutische Techniken
Aus dem NLP
Hypnose
Entspannungsverfahren
Nach innen sprechen – Selbstverbalisation
Die Praxis der inneren Bilder
Indikation und Rahmen
Anleitung und Interpretation
Zwei Demonstrationen
Pendelversuch
Zitronenbeispiel
Übungen zur Förderung von Vorstellungsbildern
Ruheorte
Fantasiereisen
Geführte Imaginationen
Anwendung in der Psychotherapie
Anwendung in der Psychosomatik
Offene Imaginationen
Imaginative Techniken
In Bilder fassen
Imaginationen verändern
Problempersonifikation
Personifikation positiver Kräfte
Sprachbilder
Vergangenheitsimagination
Zukunftsimagination
Personifikationen innerer Kräfte
Personenimagination
Bewältigungsimagination
Übertreibung
Problemidentifikation
Zustandsimagination
Rollenimagination
Fahndung nach Selbstverbalisationen
Reale Bilder und Imagination
Körperempfindung
Spiegel
Entsorgung
Hinter den Bildern
Literatur
Zu Buch und Autor
Vorwort
„Die Berechenbarkeit der Welt, die Ausdrückbarkeit alles Geschehens in Formeln – ist das wirklich ein „Begreifen“? Was wäre wohl an einer Musik begriffen, wenn alles, was an ihr berechenbar ist und in Formeln abgekürzt werden kann, berechnet wäre?“
Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1886/87
Weshalb die Beschäftigung mit Imagination? Bilder und Vorstellungen sind unser Erleben, wir konstruieren in ihnen unsere Welt. Zeichen oder Worte bedeuten immer bereits eine Abstraktion von der persönlichen Erfahrung – sie sollen ja von anderen Menschen verstanden werden –, sie dienen der Mitteilung, der Kommunikation nach außen, müssen daher überindividueller Natur sein. Das Wort „Meer“ wird von allen Menschen etwa gleich verwendet. Die Vorstellungsbilder die sich dabei einstellen, unterscheiden sich aber sehr.
Innere Bilder sind immer privat. Wenn wir sie zu beschreiben versuchen, kommunikativ nach außen bringen wollen, geschieht das über weitgehend genormte Worte oder Zeichen. Die persönliche Erfahrung kann so nie ganz übermittelt werden. Vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig. Denn Bilder sind die Sprache nach innen. Sie sind genauer, lebendiger, empathischer als Worte zu sein vermögen. Wenn wir in unserer Sprache emotional werden, geschieht das deshalb über die Annäherung an Bilder, über eine Sprache in Bildern. Über diese Sprache der Bilder wirken wir am nachdrücklichsten auf andere ein – und auf uns selbst.
Mag die Beschäftigung mit inneren Bildern zunächst auch wie ein Rückzug ins Private erscheinen, reichen sie über ihren Ausdruck in einzelnen Menschen doch in alle Bereiche der Gesellschaft hinein. Als „Visionen“ religiöser und politischer Führer sind sie für die besten und schlimmsten Taten der Menschheit verantwortlich – denn Träume, denn innere Bilder bewegen die Welt; die Bemühungen der „Realisten“ hinken ihnen immer nur hinterher.
In diesem Buch soll eine Darstellung der Grundlagen von Imagination (Buchteil 1) und ein Abriss einiger anderer Bereiche erfolgen, in denen Imagination wichtig ist (Buchteil 2): Zwar können die Abschnitte über Imagination in den psychotherapeutischen Schulen (Buchteil 3) und über die Praxis der Imagination in der Psychologie (Buchteil 4) auch davon unabhängig gelesen werden, die beiden ersten Buchteile greifen aber doch immer wieder auch in anwendungsrelevante Themen hinein, so dass sich ihre Lektüre auch für Praktiker lohnen wird.
Die Beschäftigung mit inneren Bildern hat mich nun viele Jahre begleitet. Sie ist so wenig langweilig geworden wie das Leben und hat sich verändert mit ihm. In der Biologie bezeichnet „Imago“ das fertig ausgebildete geschlechtsreife Insekt nach der letzten Häutung. Eine Raupe, eine Puppe, ein Schmetterling, Imago: Wer weiß, wohin er fliegt in der Welt.
Volker Friebel, Tübingen im Frühling 2000
Zur Neu-Ausgabe 2015
Für die Neu-Ausgabe des Buchs wurde der Text durchgesehen und hier und da leicht überarbeitet.
Grundlagen innerer Bilder
Die Innenseite der Welt
„Gehirne – so lautet meine These – können die Welt grundsätzlich nicht abbilden; sie müssen konstruktiv sein, und zwar sowohl von ihrer funktionalen Organisation als auch von ihrer Aufgabe her, nämlich ein Verhalten zu erzeugen, mit dem der Organismus in seiner Umwelt überleben kann.“
Gerhard Roth, Das Gehirn und seine Wirklichkeit, 1997
„Die Welt, soweit wir sie erkennen können, ist unsere eigene Nerventhätigkeit, nichts mehr.“
Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1880-1881
Ein Schmetterling auf der Distel: Licht trifft auf ihn, manche Spektren werden aufgenommen, andere zurückgeworfen, je nach Form und Oberflächenbeschaffenheit des Falters. Lichtwellen der zurückgeworfenen Frequenzbereiche treffen auf die Sinneszellen meines Auges, reizen dort Fotorezeptoren. Chemische Veränderungen lösen Nervenimpulse aus, diese laufen über die Sehbahn in mein Gehirn, wo sie bearbeitet werden, hinter- und nebeneinander, rückbezüglich.
Die Impulse der Nervenzellen enthalten selbst keinen Schmetterling mehr, keine Form, keine Farbe, keine Struktur. Sie feuern oder sie feuern eben nicht. Das Gehirn empfängt eine Folge, ein Muster aus Nervenimpulsen und setzt daraus in vielen Verarbeitungsschritten in mir den Schmetterling und die Distel zusammen; erst jetzt, nach mehreren Umsetzungen in andere Modalitäten, „sehe“ ich ihn. Jedes Bild, das ich sehe, ist ein „inneres“ Bild: Wir sehen nur „innen“.
Der Begründer der Sinnesphysiologie, Johannes Müller (1801-1858), formulierte das „Gesetz der spezifischen Sinnesenergien“. Danach bestimmt nicht der Reiz die Natur der Sinnesempfindung, sondern die Sinnesrezeptoren, die durch diesen gereizt werden. Ob Fotozellen Licht empfangen, elektrisch oder mechanisch stimuliert werden: Jede Reizung der Fotozellen bewirkt eine visuelle Empfindung; und jede Reizung der Hörzellen ein auditives Erleben. Entsprechendes gilt für die weitere Verarbeitung: Auch Areale des Gehirns können elektrisch gereizt werden. Eine Stimulation der primären Zonen des okzipitalen Kortex, wo die ersten Verarbeitungszentren des visuellen Systems liegen, bewirkt das Auftreten einfacher visueller Halluzinationen wie Blitze, züngelnde Flammen oder farbige Flecke (Lurija 1992).
Wichtig ist, welche Zellen gereizt werden; wie diese Reizung zu Stande kommt, ist unwichtig. Das Gehirn kennt den Bauplan des Nervensystems: Einer Reizung der Sinnes- oder Verarbeitungszellen des visuellen Systems ordnet es „Sehen“, einer Reizung des auditiven Systems ordnet es „Hören“ zu – entsprechend erleben wir ein Bild oder einen Ton.
Die Wahrnehmungsmodalität (Hören, Sehen, Schmecken, Tasten, Riechen) ist ein Konstrukt unseres Gehirns, sie liegt nicht in den Nervenimpulsen begründet, sondern allein im immer schon vorhandenen Wissen des Gehirns vom Ursprung der Nervenimpulse. Die Impulse aber tragen kein Abbild eines Schmetterlings in sich. Bilder oder Töne müssen aus der Abfolge des Rezeptionsstroms und dem vorhandenen Wissen über die Herkunft der Nervenimpulse erst konstruiert werden.
Roth (1997) unterscheidet deshalb drei Welten: Die Außenwelt, die Welt der neuronalen Impulse im Gehirn, die Erlebniswelt. Unser Gehirn steht als neuronales System in der Mitte. Ihm sind nur die eigenen Erregungen bekannt, und es kennt seinen Bauplan. Aus diesen Vorgaben heraus erschließt es die Existenz eines Körpers und einer Welt um diesen Körper herum, und setzt das Erschlossene in sich als Erlebniswelt um.
Die innere Erlebniswelt ist dabei nicht etwa ein Abbild der äußeren Welt. Sie ist eine Interpretation von Nervenimpulsen und bezieht sich nur zum kleinen Teil direkt auf Außenreize. Einer Sinneszelle des Auges stehen etwa 100.000 Nervenzellen im Gehirn zur Auswertung der von ihr gelieferten Impulse gegenüber. Die massivsten Verbindungen im Gehirn sind Assoziationsfasern, Verbindungen zwischen einzelnen Hirnteilen, nicht etwa Verbindungen von außen nach innen oder umgekehrt. Wir nehmen nicht einfach das wahr, was „draußen“ ist, sondern interpretieren Impulse, die wir als aus der Außenwelt stammend einstufen.
Diese Interpretationen richten sich nach der Erfahrung, die im Laufe der Evolution in unserem Körper und Nervensystem Struktur angenommen hat, festgehalten in der Gestalt unserer Gene. Und da ist die subjektive Erfahrung des einzelnen Menschen. Wenn ich bestimmte Impulsmuster als rund interpretiere, danach greife und mich an Kanten verletze, wird sich meine Interpretation verändern. Wahrnehmungen sind so zu allererst einmal Hypothesen.
Im Alltag genügen mit einiger Vorerfahrung oft schon wenige Sinnesdaten, um in uns ein vollständiges Wahrnehmungsbild zu erzeugen. Fehlende Daten werden einfach aus dem Gedächtnis oder durch Spekulation ergänzt. „Je vertrauter mir eine Situation oder Gestalt ist, desto weniger „Eckdaten“ benötigt mein Wahrnehmungssystem, um ein als vollständig empfundenes Wahrnehmungsbild zu erzeugen, das zu diesen Eckdaten paßt.“ (Roth 1997): Innere Wahrnehmungsbilder entsprechen also nur teilweise äußeren Objekten; fast immer sind große Teile dessen, was wir erleben, Zutaten aus der internen assoziativen Aktivität des Gehirns.
Und nicht alles, was im „Originalbild“, im äußeren Objekt der Sinneswahrnehmung enthalten ist, wird in seine innere Repräsentation umgesetzt. Perrig, Wippich & Perrig-Chiello (1993) berichten über einen Versuch, bei dem ein Gesicht visuell dargeboten wurde, in das ein Ritter mit Lanze und Pferd eingearbeitet war. Der Ritter wurde von den Wahrnehmenden nicht erkannt. Das Bild wurde weggenommen, die Versuchspersonen gebeten, es sich nun innerlich vorzustellen. Das gelang. Aber niemand konnte in diesem Vorstellungsbild den Ritter entdecken, auch nicht als sie nun informiert wurden, dass so etwas in der visuellen Vorlage integriert war. Erinnerungsbilder enthalten also nur Elemente des Originalbildes, die vorher bewusst analysiert worden sind.
Aus den Analysen der Impulse unserer Sinneszellen, aus unseren Ergänzungen und Assoziationen dazu, konstruieren wir die Welt. Sie ändert sich mit unseren Erfahrungen. Unter den individuellen Erfahrungen unseres Menschenlebens aber liegen die Erfahrungen des Lebens selbst, wie sie sich festgeschrieben haben in unseren Genen.
„Unsere vor jeder individuellen Erfahrung festliegenden Anschauungsformen und Kategorien passen aus ganz denselben Gründen auf die Außenwelt, aus denen der Huf des Pferdes schon vor seiner Geburt auf den Steppenboden, die Floße des Fisches, schon ehe er aus dem Ei schlüpft, ins Wasser paßt“, so schrieb Konrad Lorenz bereits 1941 (nach Eibl-Eibesfeldt 1995): Und: „Die Evolution, obwohl grundsätzlich nicht zweckgerichtet, ist ein Erkenntnisvorgang.“ (Lorenz 1983).
Der Aufbau innerer Bilder (und Töne, Empfindungen) aus den Impulsen der Sinnes- und Verarbeitungszellen steht aber sicherlich nicht am Anfang der Evolution. Zunächst einmal scheint die Instanz, die die einzelnen Wahrnehmungen zusammenfasste, integrierte, das Verhalten gewesen zu sein: Der Einzeller, die Pflanze, das „niedere“ Tier nimmt etwas wahr und reagiert unmittelbar darauf.
Beim Menschen und den anderen Säugern, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch bei anderen Tieren, ist eine integrative Instanz zwischen Wahrnehmung und Verhalten getreten: das subjektive Erleben, wie es sich im Aufbau innerer Vorstellungen und ihrer emotionalen Bewertung ausdrückt. Und mindestens beim Menschen sind neben die Bilder, die sich aus den Impulsen von Sinneszellen aufbauen, Bilder getreten, die einen Ausfluss der internen Aktivität des Gehirns darstellen, ohne Bezug auf aktuell stattfindende Wahrnehmungen.
Entscheidend ist dabei gerade diese integrative Funktion von Bildern und Gefühlen. Organismus und Gehirn sind im Laufe der Evolution sehr komplex geworden, haben sich immer weiter differenziert und spezialisiert. Gefühle und Bilder sind wie notwendige Gegenströmungen zu dieser Entwicklung. Sie globalisieren, vereinheitlichen und stellen das Ergebnis ihrer integrativen Leistung, das Bild und das Gefühl, den vielen Untersystemen als Gesamtbild der gegenwärtigen Ereignisse im kognitiven System zur Verfügung.
Die Frage, ob das ganze subjektive Erleben nur eine Begleiterscheinung des materiellen Geschehens im Gehirn ist oder ob es die wirkende Kraft sein kann, der das materielle Geschehen lediglich folgt, stellt sich gar nicht, wenn das Gehirn nicht als geschlossene Einheit, sondern als Vielheit betrachtet wird: Bilder sind die integrative Begleiterscheinung der Arbeit vieler oder aller Untersysteme und wirken als integrative Gesamtdarstellung auf die Arbeit der einzelnen Untersysteme zurück.
Sowohl innere Bilder wie Gefühle können als integrative Gesamtdarstellung verstanden werden. Aber sie unterscheiden sich voneinander. Gefühle werden wesentlich mit dem limbischen System in Zusammenhang gebracht, einer weitgestreckten Struktur unterhalb der Hirnrinde. Dieses kann als Bewertungssystem betrachtet werden. Die Grundgefühle Glück, Traurigkeit, Wut, Furcht und Ekel und die ganze daraus abgeleitete Palette unseres Gefühlslebens sind eine Stellungnahme unseres Gehirns, unserer ganzen bisherigen Erfahrung, zum aktuell Erlebten. (In Klammern sei festgehalten, dass das relevante Bewertungssystem des Gehirns mit seinen wesentlichen Auswirkungen auf das Verhalten subkortikal angesiedelt ist, weit weg von allem, was mit Rationalität und Bewusstsein zu tun hat. Und in Klammern sei fortgesetzt, dass die Informationen für diese Bewertungen aus der Großhirnrinde bezogen werden und die Bewertungen selbst wieder in die kortikale Informationsverarbeitung einfließen.) „Das Wirken des limbischen Systems erleben wir als begleitende Gefühle, die uns entweder vor bestimmten Handlungen warnen oder unsere Handlungsplanung in bestimmte Richtungen lenken. [...] Wer nicht fühlt, kann auch nicht vernünftig entscheiden und handeln.“ (Roth 1997).
Bildhafte Vorstellungen sind offensichtlich nicht so unmittelbar als Bewertungen zu verstehen wie Gefühle. Sie können Ausdruck von Bewertungen sein – wie die Bilder, die sich bei der Vorstellung einer unangenehmen Situation einstellen –, und sie können Grundlage von Bewertungen sein – wie jede aktuelle Wahrnehmung oder jede Vorstellungsfantasie. Jedenfalls sind sie die Instanz, auf die sich die Bewertungen beziehen. „Unter“ den Gefühlen liegen die Bilder. Die stärkere Bildhaftigkeit von Wörtern geht mit stärkerer Emotionalität einher (Campos, Marcos & Gonzalez 1999).
Grundsätzlich sollten die Hirnprozesse auch hier interaktiv und nicht einfach sequentiell verstanden werden. So ist aus der Sozialpsychologie bekannt, dass Bewertungen durchaus bereits einen Einfluss auf die Wahrnehmung haben, beispielsweise schätzen arme Menschen ein Geldstück größer ein als reiche. Jede Vorstellung wird so auch Einflüsse des emotionalen Bewertungssystems zeigen und umgekehrt auf dieses zurückwirken. Beides baut sich miteinander, sich gegenseitig beeinflussend auf – mit dem Beginn bei den Bildern. Bilder und Vorstellungen aber sind konkreter als Gefühle, die eher eine vage Gesamtdarstellung des augenblicklichen Zustands abgeben. Um zielgerichtet handlungsleitend werden zu können, müssen sie sich in Bildern manifestieren. Und hier wird die enge Beziehung zwischen subjektiven Empfindungen und Motivation offensichtlich.
Bilder wirken so auch als Vermittlung zwischen dem Gefühl (der Bewertung) und einer zielgerichteten Handlung. Uns wird das nicht immer bewusst, wir werden eher einen direkten Zusammenhang beispielsweise zwischen dem Gefühl der Angst und einer Fluchtreaktion spüren. Dass sich in einer Befragung zur Situation Vorstellungsbilder einstellen, könnte so als Ergebnis eben der kognitiven Arbeit aufgrund der Befragung und nicht als automatischer selbstverständlicher Prozess, den es nur aufzudecken gilt, verstanden werden.
Hierzu sei auf die Übersichten von Kunzendorf (1991) sowie Dadds und Mitarbeiter (1997) verwiesen, die zeigen, dass selbst so „trockene“ Phänomene wie die klassische Konditionierung nach Pawlow durch innere Bilder vermittelt werden. Klassische Konditionierungen gelingen nämlich nicht immer bzw. bei allen Versuchspersonen gleich gut, und zwar weil manche Menschen (oder Tiere) nicht oder nicht lebendig genug antizipieren. Die klassische Konditionierung beispielsweise der Herzrate war erfolgreicher bei Menschen mit lebhafteren Bildern. Imagination kann klassische Konditionierung beim Menschen fördern oder hemmen, mentale Bilder können unkonditionierte und konditionierte Stimuli ersetzen. Kontingenzbewusstsein fördert zwar die Konditionierung, braucht nach der Konditionierung aber nicht mehr bewusst erinnert zu werden – die Assoziation bleibt trotzdem bestehen (Fulcher & Cocks 1997): Immer wieder wird von Asthmatikern oder Menschen mit Pollenallergien berichtet, deren Anfall bereits durch die Vorstellung beispielsweise einer frühlingshaften Blumenwiese ausgelöst werden kann.
Im Kino laufen die Bilder auf einer großen Leinwand, die Menschen sitzen in Reihen davor. Wir können diese Zuschauer als die vielen Untersysteme im menschlichen Gehirn betrachten, die über den Film in einen gewissen Einklang gebracht werden, deren Arbeit sich über diesen Bezugspunkt integriert. Nicht alle gehen ins Kino, manche verstehen Filme gar nicht. Die Anwesenden aber arbeiten – anders als im Hollywoodkino – am Film selbst mit. Ein interaktives Kino: In uns ist es schon immer Wirklichkeit gewesen.
Was gespielt wird, ist ein Film über die Welt. Selbst Wahrnehmungsbilder sind immer schon eine Interpretation, wie die Versuche von Libet zeigten (siehe in Roth 1997 oder Nørretranders 1994), sind der Versuch einer Integration, einer Simulation dessen, was sich tatsächlich ereignet. Unvermitteltes Erleben ist gar nicht möglich. Wir erleben immer schon die Bedeutung, die subkortikal die Neukonstruktion unserer Sinneserlebnisse aus den Impulsen unserer Nervenzellen begleitet und in diese Neukonstruktion Eingang findet. Wir sehen keine Lichtmuster, sondern immer schon den Schmetterling auf einer Distel. Und wir lächeln dabei.
Bilder ohne Beteiligung der Sinnesorgane sind „innere Bilder“ im engeren Sinne. So werde ich den Begriff künftig gebrauchen. Sie verfolgen sicherlich ähnliche Zwecke wie Wahrnehmungsbilder: Das Kino und die Zuschauer sind dieselben: Immer sind wir auf der Innenseite der Welt. Dabei gibt es auch Unterschiede. Um diese kennenzulernen, begeben wir uns weiter hinein ins Gehirn.
Gehirn und inneres Bild
„[...] Eine Unzahl von einzelnen Bewegungen werden vollzogen, von denen wir vorher gar nichts wissen, und die Klugheit der Zunge z.B. ist viel größer als die Klugheit unseres Bewußtseins überhaupt. Ich leugne, daß diese Bewegungen durch unseren Willen hervorgebracht werden; sie spielen sich ab, und bleiben uns unbekannt [...].“
Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1881
Für die Speicherung von Wissen wird ein Netzwerk kortikaler Areale im Frontal- und Temporallappen des Gehirns angenommen, das bei der semantischen Verarbeitung von Bildern und Wörtern gleichermaßen beteiligt ist. In diesem Netzwerk vollzieht sich die Verarbeitung und die Speicherung sowohl visuell-anschaulicher als auch abstrakt-funktionaler Wissensaspekte, wie sie sich etwa der analogen (sinneshaften) und der propositionalen (semantischen) Repräsentation zuordnen lassen (Kiefer 1998).
Die Existenz analoge Repräsentationen konnte im wissenschaftlichen Experiment erstmals bei Rotationsaufgaben nachgewiesen werden. Dabei muss von der Versuchsperson entschieden werden, ob eine um einige Grad gedreht abgebildete Figur die genaue Kopie einer normal stehend abgebildeten Figur ist oder ob es Unterschiede gibt. Es stellte sich heraus, dass die Zeit zur Beantwortung der Aufgabe vom Drehwinkel zwischen Original und Kopie abhängt Dies weist darauf hin, dass die Versuchspersonen die Kopie mental drehen, um den Vergleich anzustellen, dass sie also ein mentales Bild von ihr herstellen (Übersicht in Rösler & Heil 1998): Gute Imaginierer lösen solche Rotationsaufgaben besser als schlechte (Weatherly und Mitarbeiter 1997), ein weiterer Hinweis darauf, dass innere Bilder zum Einsatz kommen.
In der Folge wurde das Thema der mentalen analogen Repräsentation in einer Vielzahl von Untersuchungen behandelt. Gegenstand der Untersuchung ist nun meist die Veränderung von Gehirnaktivität bei der Hervorrufung von Vorstellungen (inneren Bildern) im Vergleich zu einer tatsächlichen Wahrnehmung oder einer tatsächlich durchgeführten Bewegung. Die Herangehensweisen sind verschieden, auch bei der Konzentration auf eine bestimmte Art von Imagination. Zu kinästhetischen Imaginationen verwendeten Deiber und Mitarbeiter (1998) die Positronenemissionstomografie (PET), um Veränderungen der Aktivation kortikaler Regionen festzuhalten: Versuchsteilnehmer sollten sich visuell die Bewegung eines ihrer Finger vorstellen, diese Bewegung zusätzlich tatsächlich ausführen, oder gar nichts tun. Pfurtscheller & Neuper (1997) verwendeten das Elektroenzephalogramm (EEG) zur Feststellung von Aktivitätsänderungen bei Vorstellung einer Handbewegung. Schnitzler und Mitarbeiter (1997) setzten Magnetoenzephalografie zur Untersuchung kinästhetischen Imaginationen von Fingerbewegungen ein.
Sowohl methodisch als auch theoretisch werden in Zukunft vermutlich Erweiterungen des Zusammenspiels Imagination – Hirnaktivität vorgenommen werden. Graf und Mitarbeiter (1998) fanden interessanterweise bei visuellen Imaginationsaufgaben, die eine mentale Rotation verlangten (entweder von sich selbst oder von Objekten), Mitbewegungen des Körpers. Bonnet und Mitarbeiter (1997) erhoben eine – allerdings nur schwache – Erhöhung der EMG-Aktivität bei der Imagination einer Bewegung: Manche eigentlich visuellen Vorstellungen (zumindest von Bewegung) können also auch eine psychomotorische Komponente enthalten. Zumindest teilweise scheinen wir bestimmte Imaginationen also auch über den Körperausdruck wahrzunehmen. Umgekehrt erhoben Sathian und Mitarbeiter (1997) bei einer taktilen Orientierungsaufgabe (Reizung des Zeigefingers) eine Erhöhung des regionalen zerebralen Blutflusses, dessen Lokalisation auf Visualisierungsprozesse zur besseren Diskrimination des Gebiets der taktilen Reizung hindeutet.
Trotz aller noch vorhandenen methodischen Probleme und zu erwartenden notwendigen Erweiterungen der Fragestellung gibt es Erfolge und Übereinstimmung in Forschungsergebnissen. Übersichten wie Decety (1996a, 1996b) gehen deshalb davon aus, dass imaginierte und tatsächliche Bewegung in gewissem Ausmaß dieselben zentralen Strukturen teilen. Cunnington und Mitarbeiter (1996) erhoben in den frühen Komponenten von bewegungsbezogenen kortikalen Potentialen, die etwa 1 bis 2 Sekunden vor Ausführung der Bewegung beginnen und wohl der Bewegungsvorbereitung dienen, keine Unterschiede zwischen tatsächlichen und imaginierten Bewegungen. Bewegungsausführung und Bewegungsimagination generieren ähnliche prämotorische Vorbereitungsprozesse in denselben kortikalen Gebieten. Höllinger und Mitarbeiter (1999) erhoben dies auch bei vorgestellten und tatsächlich ausgeführten Augenbewegungen. Stephan & Frackowiak (1996) zeigten, dass die motorische Imagination einige Charakteristiken mit der motorischen Vorbereitung und zusätzlich weitere mit der motorischen Ausführung teilt. Auch andere Studien bestätigen, dass imaginierte Bewegungen Hirnareale wie bei tatsächlichen Bewegungen aktivieren – im Ausmaß aber schwächer als diese. Die tatsächliche Bewegung aktiviert zumindest in ihren späten Komponenten aber zusätzliche Hirnareale, wie auch die imaginierte Bewegung Hirnareale aktiviert, die nicht an einer tatsächlichen Bewegung beteiligt sind. Aktivationen bei Bewegungsimaginationen betreffen dabei nicht nur das Groß-, sondern auch das für Bewegung besonders zuständige Kleinhirn (Luft und Mitarbeiter 1998): Imaginierte und tatsächliche Bewegung lassen sich so als zwei Kreise verbildlichen, die sich stark überschneiden, von denen aber jeder auch eigenständige Anteile an Gehirnaktivität hat.
Nicht anders ist es zu erwarten. Eine tatsächliche Bewegung muss im Gehirn motorische Durchführungsareale aktivieren, eine imaginierte Bewegung darf dies nicht. Die Beteiligung von Gebieten des Frontalkortex nur bei der imaginierten Bewegung, wie sie von Deiber und Mitarbeitern (1998) gefunden wurde, weist darauf hin, dass es eine lange gemeinsame Strecke von imaginierter und tatsächlicher Bewegung gibt, die letztliche Ausführung der Bewegung dann aber durch den Frontalkortex aktiv gehemmt wird, während die tatsächliche Bewegung von primären motorischen Strukturen aufgenommen und an die Körperperipherie weitergeleitet wird. Pfurtscheller & Neuper (1997) vergleichen ihre Funde – eine EEG-Synchronisation über dem primären sensomotorischen Areal – mit der Planung einer willentlichen Bewegung. Auch die von Kasai und Mitarbeitern (1997) bei Bewegungsimaginationen gefundenen Zunahmen der Amplituden von motorischen evozierten Potentialen, ohne Bewegungsausführung, passt in dieses Bild der Vorbereitung und Erleichterung einer späteren Bewegung durch Vorstellung.
Die Befunde lassen vermuten, dass innere Bilder im Sinne von nicht bewussten motorischen Imaginationen bei der kortikalen Vorbereitung von Handlungen eine Rolle spielen.
Ebenso wie das Verhältnis von Bewegung und Bewegungsvorstellung ist das Verhältnis von Wahrnehmung und bildhaften Vorstellungen einzustufen (Übersicht in Farah 1995): Es gibt starke Ähnlichkeiten und Überschneidungen – aber beide beanspruchen jeweils auch eigene Hirnareale, sind also keinesfalls identisch (so in Kosslyn, Thompson & Alpert 1997, Howard und Mitarbeiter 1998): Imaginierte Bilder und „echte“ Wahrnehmungen können manchmal als nicht oder nur schwer unterscheidbare Informationsquellen wirken: Anyanwu (1997) berichtet über einen Jungen mit lichtsensitiver Epilepsie, der durch mentale Imagination visueller Stimuli in der Lage war, Anfälle bewusst auszulösen. Und jeder Mensch kann durch geeignete Vorstellungsbilder motorische, vegetative und emotionale Veränderungen in sich hervorrufen: Stellen wir uns lebhaft vor, in eine Zitrone zu beißen, dann fließt Speichel und Enzyme werden ausgeschüttet.
Imaginations- und Wahrnehmungsfähigkeit können aber auch ganz auseinandergehen. So berichten Dalman, Verhagen & Huygen (1997) über eine Frau mit kortikaler Blindheit nach Infarkt, die zwar keine visuelle Wahrnehmung mehr hatte, deren visuelle Imagination jedoch intakt war. Chatterjee & Southwood (1995) berichten über drei Patienten mit kortikaler Blindheit, aber der Fähigkeit zumindest aus der Erinnerung visuelle Vorstellungsbilder abzurufen.
Dazu passen die Ergebnisse von D’Esposito und Mitarbeitern (1997): Sie ließen ihre Versuchspersonen Wörter hören, wobei eine Hälfte nur hören, die andere aber beim Hören Bilder zur Wortbedeutung generieren sollte. Es zeigte sich, dass nicht der primäre visuelle Kortex sondern der visuelle Assoziationskortex beim Generieren von Bildern beansprucht wird. Visuelle mentale Imagination scheint demnach eine Funktion des visuellen Assoziationskortex zu sein, wobei die Bildgenerierung asymmetrisch links (nicht etwa rechts) lokalisiert ist.
Wenn Imaginations- und Wahrnehmungsfähigkeit manchmal auch auseinanderfallen können, so zeigen die meisten Patienten mit selektiven visuellen Beeinträchtigungen nach Schäden des kortikalen visuellen Systems jedoch qualitativ ähnliche Beeinträchtigungen sowohl in der mentalen Imagination als auch in der Wahrnehmung (Farah 1995): Imagination und Wahrnehmung haben zumindest einige modalitätsspezifische kortikale Systeme gemeinsam, die bei beiden ähnliche Aufgaben wahrnehmen.
Viele Befunde sind aber oft schwer vereinbar, wahrscheinlich weil je nach genauer Aufgabenstellung und Sinnesmodalität unterschiedliche Hirnareale involviert werden. So ergab eine Studie von Fallgatter, Müller & Strik (1997), die Wörter mit visuellen, akustischen oder taktilen Vorstellungsinhalten verwendeten, in der P300-Komponente unterschiedliche Hirnlokalisationen. Meist rechts orientiert war die visuell-sensorische Modalität, meist links orientiert die taktile Imagination, die akustische lag in der Mitte. Die Autoren folgern daraus, dass den modalitätsspezifischen Imaginationen Aktivität unterschiedlicher neuraler Generatorensembles zugrundeliegt, die möglicherweise modalitätsspezifische primäre kortikale Areale umfassen. Solche Zuordnungen lassen sich dem derzeitigen Stand der Forschung nach aber nur als grobe Annäherung lesen. In Wahrnehmungen und Imaginationen sowie deren Verarbeitung sind sehr viele Hirnareale involviert. Je nach Fragestellung und besonderem Fokus der jeweiligen Studie müssen Ergebnisse so entweder sehr kompliziert oder wenig miteinander vergleichbar ausfallen.
Als Arbeitsmodell kann man davon ausgehen, dass innere Bilder nach ihrer Generierung (Farah 1995 zufolge wahrscheinlich in der posterioren linken Hemisphäre) eine ähnliche Verarbeitungsstrecke im Gehirn durchlaufen wie eine tatsächliche Wahrnehmung. McGuire und Mitarbeiter (1996a) erhoben in einer Aufgabe zur Imagination inneren Sprechens oder inneren Hörens, dass imaginierte Satzartikulation Aktivität in einem Gebiet bedeutet, das sich mit Sprachgenerierung beschäftigt, während Hör-Imagination mit zusätzlicher Aktivität in Gebieten der Sprachwahrnehmung verbunden ist.
„Echte“ Wahrnehmungen sollten überhaupt nicht als wesensverschieden von inneren Bilder betrachtet werden. Das Gehirn bildet die Welt nicht ab, sondern konstruiert sie (Roth 1997): Eingänge über die Sinneskanäle sind dabei Rohmaterial wie die inneren Vorstellungen. Einen wesenhaften Unterschied zwischen ihnen gibt es nicht. Im Gehirn ist jede Modalität nur das Feuern (oder Nichtfeuern) von Nervenzellen; ihre Qualität als Riechen, Hören, Schmecken, Sehen, Fühlen erhalten sie lediglich durch ein Vorwissen über die Lokalisation der Ursprungspotentiale. Etwas wird gehört, weil ein Vorwissen da ist: Diese feuernde Nervenzelle steht mit dem „Ohr“ in Verbindung. Etwas wird gesehen, weil ein Vorwissen da ist: Diese feuernde Nervenzelle steht mit dem „Auge“ in Verbindung. Etwas wird anders, blasser, unwirklicher gesehen, weil ein Vorwissen da ist: Diese feuernde Nervenzelle steht mit keinem Sinnesorgan in Verbindung.
Ein Fehlen dieser Unterscheidungsfähigkeit wird pathologische Auswirkungen auf die Weltkonstruktion der Betroffenen haben. Mit McGuire und Mitarbeitern (1996b) kann es für auditorische und visuelle Halluzinationen bei Schizophrenie verantwortlich gemacht werden: Innere Bilder und inneres Sprechen werden nicht mehr als solche markiert oder erkannt und ihr Ursprung deshalb fälschlicherweise in der Außenwelt postuliert.
Motorische innere Bilder werden wie Handlungsvorbereitungen, sinnesspezifische innere Bilder wie Außenreize unter selektiver Aufmerksamkeit bearbeitet (Frith & Dolan 1996, 1997): Bei tatsächlichen oder imaginativen Wahrnehmungen sind aber Einflussnahmen aus dem präfrontalen Kortex wesentlich, durch die Vorwissen (und sicherlich auch das Wissen um die Unterscheidung des jeweiligen Bildes als Wahrnehmung oder Imagination) je nach Aufgabe regulierend eingreift und so bei motorischen Imaginationen für die Hemmung der motorischen Endstrecke, bei wahrnehmungsartigen Imaginationen für deren Markierung als solche und für die Zuordnung nach „innen“ sorgt (siehe auch Decety 1996b).
Entwicklung der Imagination
„Ene mene mu
und raus bist du!“
Kinderreim
Wahrnehmungsbilder können fast von Geburt an mehr oder weniger gut aufgebaut werden – mentale Bilder vermutlich nicht, sie folgen nach, entwickeln sich aus dem Umgang mit Wahrnehmung heraus. Nach Piaget & Inhelder (1979) können bewegte innere Bilder erst von 7-8-Jährigen erlebt werden, da sie das Stadium der konkreten Operationen voraussetzen. Mentale Bilder sind nach Piaget operationalen Strukturen untergeordnet. Nach den Studien von Foulkes (1982) zeigen Kinderträume im Laufe der Jahre eine Entwicklung von eher statischen Bildern zu Geschichten (ab 5-7 Jahre): Tatsächlich können Kinder aber den Endzustand von Transformationen (beispielsweise Verschiebung einer Kiste auf einer anderen Kiste) oft schon in einem Alter vorhersagen, zu dem sie die Zwischenschritte nicht angeben können. Lautrey & Chartier (1991) halten die Piagetsche Unterordnung kinetischer und transformierender Bilder unter die konkreten Operationen deshalb für zweifelhaft. Vielleicht muss eine getrennte Entwicklung analoger und proportionaler Repräsentationen angenommen werden, wobei die analogen Repräsentationen letzteren vorausgehen und deren Entwicklung leiten, da sie für Transformationen korrekte Endzustände angeben können, zu einem Zeitpunkt zu dem noch kein Wissen darüber vorhanden ist, welche Operationen dazu wie durchgeführt werden müssen. Mit zunehmender kognitiver Entwicklung wird dann weniger auf mentale Bilder und mehr auf propositionale Verarbeitung zurückgegriffen.
Singer & Singer (1992) zeigen in ihrer Monografie zu Spiel und Imagination, dass die ersten Spiele, die – vermutlich – auf Imaginationen beruhen (eine Puppe füttern), bereits im Alter von 12-13 Monaten stattfinden. Zunächst ist die Puppe noch passiv, nur das fütternde Kind aktiv. Nach und nach agiert dann auch die Puppe: Sie redet, geht, füttert eine andere Puppe. Im Alter zwischen 3 und 6 Jahren beginnen gemeinsame Vorstellungsspiele, bei denen Kinder untereinander Rollen verteilen und sich auf verabredete Themen beziehen, beispielsweise die Suche nach einem Piratenschatz.
Solche Spiele mit imaginativem Charakter sind einer Studie von Singer & Singer zufolge positiv mit Freude und Lebhaftigkeit korreliert, negativ dagegen mit Furcht, Trauer oder Müdigkeit. Bei sehr zornigen, ängstlichen oder hyperaktiven Kindern konnte nur selten Vorstellungsspiel festgestellt werden. Kinder, die viel an Spielen imaginativen Charakters beteiligt sind, beteiligen sich auch mehr an tatsächlichem sozialem Spiel. Imaginative Kinder initiieren eher gemeinsame Spiele, sind weniger allein, weniger zurückgezogen oder abweisend. Wie es scheint, entwickeln Kinder, die gut imaginieren können, bessere soziale und kognitive Fertigkeiten: Sie können Erlebnisse besser integrieren, lernen Informationen zu organisieren, sind reflexiver, konzentrierter und anderen Kindern gegenüber sensibler.
Trotz breiter Angebote wählen Jungen lieber Abenteuerspiele mit verwegenen und konflikthaften Inhalten, während Mädchen zu Spielen neigen, die sich mit sozialen Themen beschäftigen, vor allem mit Familienthemen wie der Rolle von Vater, Mutter und Kind. Mädchen scheinen dabei intimer mit ihren Figuren als Jungen, die mehr von außen beschreiben. Interessanterweise hat die Veränderung in den Fernsehklischees im imaginativen Spiel der Kindergartenkinder ebenfalls eine Veränderung bewirkt: Mädchen neigen heute mehr als früher dazu, sich mit Heldinnen zu identifizieren, wie sie in Zeichentrickfilmen und Comics vermehrt auftauchen. Eine verstärkte Hinwendung von Jungen zu häuslichen Themen ist aber nicht zu beobachten.
Hoch differenziertes Spielzeug (wie perfekt vorkonstruierte Roboter) wird zwar anfänglich gern angenommen, erhält bald aber nur noch wenig Aufmerksamkeit. Offenbar bieten Materialien wie Legos oder Bauklötze längerfristig mehr Ansatzpunkte für die Imagination.
Im Alter zwischen 2 und 6 Jahren haben viele Kinder imaginäre Spielgefährten: andere Kinder oder Tiere oder Fantasiewesen. Bei jüngeren Kindern wird für imaginäre Gefährten manchmal auch ein Stuhl am Tisch sowie Essen und Trinken bereitgestellt. Siegel (1998) berichtet über EEG-Aufnahmen während halluzinierter Erscheinungen, die reduzierte evozierte Reaktionen auf ein blitzendes Licht hinter der Erscheinung aufzeichneten, ganz so, als reduziere die Halluzination die Wahrnehmung des hinter ihr blitzenden Lichts. Imaginäre Gefährten werden also offenbar von vielen Kindern nicht nur für wirklich gehalten, sondern auch wirklich gesehen.
Kinder mit imaginären Gefährten sind überwiegend Einzelkinder oder Erstgeborene, die noch keine Geschwister hatten, als der Gefährte erstmals auftauchte.