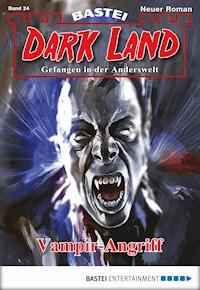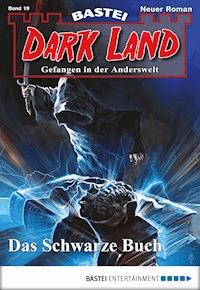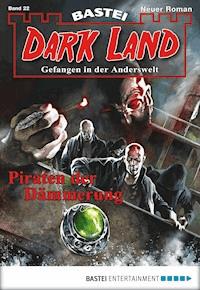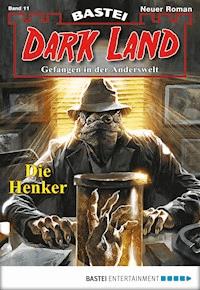1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair
- Sprache: Deutsch
Zeit, was bedeutete sie schon? Sie tropfte dahin, mal in strahlendem Sonnenschein, mal in der Dunkelheit. Tiere wurden geboren, wuchsen heran, wurden gefressen oder starben einfach.
Nicht wenige Fische sanken nach dem Ende ihres Lebenszyklus hinab auf den Meeresgrund, wo, versteckt in einer Felsspalte, ein stummes Wesen kauerte und mit leeren Augenhöhlen vor sich hinvegetierte.
Die Gestalt war tot und lebte trotzdem. Ihre Haut verweste, zerfiel und gab so den Blick auf die blanken Knochen frei. Einige Teile des Körpers waren jedoch vor dem Zersetzungsprozess geschützt, insbesondere der Bereich des Bauches, in dem eine gewaltige Kraft schlummerte und auf die Chance wartete, noch einmal in die Welt der Menschen zurückzukehren.
Manchmal, so wie in diesen Momenten, rieb der Untote seine knöchernen Finger über seinen Bauch und dachte dabei an das, was in ihm steckte. Es waren die Reste eines mächtigen Volkes, dem der Monsterfrösche ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Monsterfrösche aus dem All
Vorschau
Impressum
Monsterfröscheaus dem All
Von Rafael Marques
Zeit, was bedeutete sie schon? Sie tropfte dahin, mal in strahlendem Sonnenschein, mal in der Dunkelheit. Tiere wurden geboren, wuchsen heran, wurden gefressen oder starben einfach.
Nicht wenige Fische sanken nach dem Ende ihres Lebenszyklus hinab auf den Meeresgrund, wo, versteckt in einer Felsspalte, ein stummes Wesen kauerte und mit leeren Augenhöhlen vor sich hinvegetierte.
Die Gestalt war tot und lebte trotzdem. Ihre Haut verweste, zerfiel und gab so den Blick auf die blanken Knochen frei. Einige Teile des Körpers waren jedoch vor dem Zersetzungsprozess geschützt, insbesondere der Bereich des Bauches, in dem eine gewaltige Kraft schlummerte und auf die Chance wartete, noch einmal in die Welt der Menschen zurückzukehren.
Manchmal, so wie in diesen Momenten, rieb der Untote seine knöchernen Finger über seinen Bauch und dachte dabei an das, was in ihm steckte. Es waren die Reste eines mächtigen Volkes, dem der Monsterfrösche ...
Wie viele Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre vergangen waren, seit Nathaniel Conlon, dem ehemaligen Pfarrer von St. Theodor, als einzigem Diener der großen Königin Kongina die Flucht aus dem von ihr besetzten Wasserwerk gelungen war und er sich mit der in ihm schlummernden Brut ins Meer gerettet hatte, wusste er schon längst nicht mehr. Es zählte allein der Umstand, dass ihn die Magie der Frösche am Leben hielt und er damit auch die Brut in seinem Bauch. Irgendwann würde der richtige Moment kommen, um sie zu gebären, dann würden Raana und seine Froscharmee zurückkehren und diejenigen büßen lassen, die einst für ihre Vernichtung gesorgt hatten.
Immer wieder dachte der Untote an die Vergangenheit zurück, als Raana, der riesige Monsterfrosch aus Atlantis, mit seinen Truppen über das beschauliche St. Theodor hergefallen war und große Teile der Stadt zerstört hatte. Er selbst war nur mit knapper Not dem Tod entkommen, als die Kirche unter dem Druck des massigen Froschkörpers zusammengebrochen war.* Erst viele Monate später war er zu einem Diener der Frösche geworden, als es Kongina gelungen war, eine neue Brut zu legen und diese in das Trinkwassersystem der Stadt zu schleusen. Wieder hatte es viele Tote gegeben, und auch diesmal waren mehrere Männer und eine Frau erschienen, um die Macht des Bösen zu bekämpfen.
Nathaniel dachte besonders an den kleinen, grünhäutigen Magier und die dunkelhaarige Kriegerin mit dem goldenen Schwert. Sie hatten stark dazu beigetragen, dass die Monsterfrösche aus Atlantis zweimal besiegt worden waren.* Sollte es ihm eines Tages gelingen, an Land zurückzukehren und eine neue Frosch-Armee zu gebären, würde er nichts unversucht lassen, um diese beiden Personen für ihren Frevel bezahlen zu lassen.
Noch aber war er hier unten gefangen, als lebende, äußerlich zerfallene Leiche, die in einer Felsspalte kauerte und finstere Rachepläne schmiedete. Zu mehr war er nicht in der Lage, auch wenn er eine so mächtige Saat in sich trug.
Mit der Zeit war er immer weiter abgestumpft, sodass er nicht einmal mehr reagierte, wenn sich kleine, hungrige Fische an seinem Fleisch zu laben versuchten. Dass es schwarzmagisch vergiftet war, merkten sie meist viel zu spät. Nur wenige Sekunden später trieben sie reglos an die Oberfläche und fielen anderen Räubern des Meeres zum Opfer, welche später ebenfalls an dem untoten Fleisch zugrunde gingen.
Sein Zustand endete erst, als ein greller Scheinwerfer die nächtliche Finsternis durchstieß. Der gut zehn Meter breite Lichtkegel schreckte Fische und Krebstiere auf und ließ sie verwirrt in Kreisen schwimmen. Der Schein des Mondes war das auf keinen Fall, sondern sicher ein Licht künstlichen Ursprungs. Etwas oder jemand begann damit, den Meeresboden systematisch abzusuchen, eine Kraft, die Nathaniel auf seltsame Weise vertraut vorkam. Er war nicht in der Lage, dieses Gefühl näher zu bestimmen, dennoch fürchtete er sich nicht im Geringsten davor, irgendwann von dem Schein erfasst zu werden. Im Gegenteil, bald konnte er es gar nicht mehr abwarten, endlich Kontakt zu dem Fremden aufzunehmen, weshalb er sogar mit schwachen Bewegungen seine Knochenfinger nach dem Licht ausstreckte.
Endlich wurde die Felsspalte von dem grellen Schein erfasst. Ein langsam anschwellendes Summen erfüllte die Unterwasserwelt, während ein Schauer nach dem anderen über Nathaniels zerfallenen Körper rann. Die Kraft, die in seinem Bauch steckte, erwachte zu neuem Leben und sorgte dafür, dass sich seine Haut, die Sehnen und Muskeln nach und nach regenerierten und sich bald wieder ein normales, menschliches Äußeres über seine Knochen spannte. Nur seine Priesterrobe blieb weiterhin in ihrem teilweise verrotteten Zustand.
Das Summen nahm nicht nur an Intensität zu, es erzeugte auch zerstörerische Schallwellen, die die Felsen um Nathaniel herum beben ließen. Kleine Risse zogen sich durch das Gestein, Kiesel rieselten von den Spitzen herab, die langsam ihre Stabilität verloren und eine nach der anderen abbrachen. Schließlich wurde er Zeuge, wie die gesamte Gesteinsformation in feinste Körner auseinanderbrach und innerhalb weniger Sekunden von der Strömung weggetrieben wurde. Nur Nathaniel wurde von der Wirkung des Schalls nicht erfasst.
Seltsamerweise blieb er von der Strömung des Wassers verschont. Einige Sekunden lang blieb er wie eine Salzsäule auf dem Meeresboden stehen, bis kleine, silbrige Blitze über seine Haut zu huschen begannen. Es handelte sich wohl um ein elektromagnetisches Feld, das ihn nicht nur von dem Rest des Meeres isolierte, sondern auch dafür sorgte, dass er langsam den Kontakt zum Boden verlor. Wie in Zeitlupe schob sich sein Körper in die Höhe, immer näher an die Oberfläche und damit auch an die Quelle des grellen Scheins heran.
Nathaniel Conlon lächelte und streckte sehnsüchtig die Arme aus.
»Endlich«, flüsterte er. »Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Lasst uns das Reich der Frösche zu neuem Leben erwecken. Lang lebe Raana!«
Etwas erfasste ihn, ein fremder Geist, der von weit über ihn in seine Gedankenwelt eindrang und einen einzigen Satz in ihr formte: Lang lebe das Königreich der Frösche!
Hätte Mandragoro über einen festen Körper verfügt, wäre ihm das Eindringen der fremden Kraft in seine Welt wie ein Stich durch seine Haut vorgekommen. Gerade noch hatte er seinen allumfassenden Blick über das gerade in nächtlicher Dunkelheit liegende Paradies gleiten lassen, in dem er Tieren und Wesen eine Zuflucht gab, die auf der Menschenwelt entweder längst ausgerottet oder stark bedroht waren. Auch magische Pflanzenwesen tummelten sich hier, ebenso wie seine Puppen – künstliche Wesen mit menschlichen Gesichtern, die sich auf diese Weise spielerisch leicht zwischen die Menschen mischen konnten.
Der Angriff auf diese Welt, ein Frevel, den kaum jemand gewagt hätte, wirkte im Lichte vergangener Ereignisse wie ein erneuter Schlag in sein nicht existierendes Gesicht. Mehrmals war es zu Vorfällen beziehungsweise Anschlägen auf sein Leben gekommen, die andere Dämonen sicher nicht überlebt hätten. Erst war er von Hook, dem Monster-Troll aus Aibon, vergiftet worden, später war er mit dem untergehenden Schattenreich des Druidenparadieses in eine unendliche Finsternis gezogen und scheinbar vernichtet worden.* Eine Erinnerung daran existierte nicht mehr, er wusste dies nur aus Erzählungen anderer Wesen. Trotzdem existierte er weiter, was an seiner besonderen Existenzform lag, die ihn von allen anderen dämonischen Geschöpfen unterschied.
Auch sein Charakter war mit dem der Höllenwesen kaum zu vergleichen. Er sah sich selbst nicht als böse an, ganz im Gegenteil, denn er besaß einen moralischen Kompass und ein Ziel, das sich nicht an Mord, Blutlust und dem Sammeln menschlicher Seelen erschöpfte. Mandragoro wollte die Natur bewahren, sie schützen und heilen und gegebenenfalls ihre Gegner auch für ihre Verbrechen bezahlen lassen. Nicht wenige Menschen waren schon durch ihn oder die Hände seiner Diener gestorben, wenn sie es gewagt hatten, Tod und Grauen über schützenswerte Orte zu bringen. Manchmal schoss er dabei über das Ziel hinaus, was ihm spätestens dann vor Augen geführt wurde, wenn es zu einer Konfrontation mit dem Sohn des Lichts kam.
Das war diesmal nicht der Fall. Was immer gerade in seine Welt eingedrungen war, nahm er als gewaltige, schwarzmagische Kraft wahr. Insgeheim dachte der Umwelt-Dämon an frühere Zeiten zurück, als er mehrmals mit dem Druidenfürsten Guywano in Konflikt geraten war und sich ihre Diener in einem fortwährenden Krieg befunden hatten. Dieser Konflikt war mit dem Tod des bösen Wesens aus Aibon begraben worden, nicht jedoch sein Interesse an dem Druidenparadies. Sein Einfluss auf diese Dimension war allerdings vor einiger Zeit endgültig gebrochen worden. Dies spielte im Moment keine Rolle; jetzt ging es darum, sein Territorium zu verteidigen.
Als geisterhafter, unsichtbarer Hauch glitt Mandragoro über die Wipfel der Bäume hinweg. Immer wieder nahm er die sich im Wald versteckenden Geschöpfe wahr, manchmal entdeckte er auch besondere Exemplare wie die majestätischen Riesenhirsche, die mit ihren gewaltigen Geweihen die Welt der Menschen bis vor etwa 7.000 Jahren bevölkert hatten. Auch Alraunen nahm er wahr, die wunderbaren Wurzelmännchen, deren Fortbestand ihm besonders wichtig war.
Bald schon geriet ein gigantisches, blinkendes Objekt in sein Blickfeld, das etwa hundert Meter über dem Wald am Himmel schwebte. Aus der Mitte des Ungetüms war ein greller Strahl in die Tiefe geschossen und erfasste einen besonderen Teil des Waldes, den Mandragoro durch natürliche Hindernisse und magische Mauern vom Rest seiner Welt isoliert hatte.
Die unsichtbaren Wälle schienen für diese schwer einzuordnende Kraft kein Hindernis darzustellen. Dabei war er damals, als er sie entstehen ließ, davon überzeugt gewesen, dass nur er selbst sie überwinden könnte. Dort unten, auf der Spitze eines bewaldeten Hügels, stand ein unsichtbarer, über hundert Meter tiefer Brunnen, der nur an seinem Boden mit Wasser gefüllt war. Und genau in diesem Bereich vegetierte auch ein Geschöpf vor sich hin, das auf den ersten Blick wie ein völlig normaler Frosch erschien, in Wahrheit jedoch ein mächtiges, beinahe unzerstörbares Wesen war: Kongina, die Königin der Frösche.
Nachdem sie über Jahrtausende als verschollen gegolten hatten, waren ihr König Raana und sie vor einigen Jahren wieder vereint worden. Zwar existierte Raana inzwischen nicht mehr, doch Kongina hatte mit ihm in der kurzen gemeinsamen Zeit eine neue Brut gezeugt, der es beinahe gelungen war, die gesamte Bevölkerung des Ortes St. Theodor auszulöschen. Das hatten Myxin, Kara, John Sinclair und Suko verhindern können, und um sicherzustellen, dass etwas Derartiges nie wieder geschah, hatte Mandragoro eingegriffen und die Froschkönigin in seine Welt geholt.
Und nun wollte sie offensichtlich jemand befreien – oder zerstören?
Was auch immer mit Kongina geschah, er würde es sich nicht bieten lassen, dass eine fremde Macht in sein Paradies eindrang. Deshalb sorgte er dafür, dass die umliegenden Bäume zum Leben erwachten, ihre Wurzeln aus der Erde hoben und sie in Richtung des kleinen Brunnens streckten. Sie sollten die Öffnung endgültig verschließen, allerdings kam es dazu nicht. Aus dem Lichtstrahl schossen grünliche Blitze hervor, erfassten die Tannen und pulverisierten die Wurzeln. Auch die Bäume selbst zerfielen, einmal getroffen, in Sekundenschnelle zu Asche.
Umso mehr fühlte sich Mandragoro von der fremden Macht provoziert. Obwohl er bereits sah, wie die Königin der Frösche innerhalb des Strahls in die Höhe schwebte, sorgte er dafür, dass sich die Bäume miteinander vereinigten. Wurzeln schlossen sich mit anderen Wurzeln zusammen und schufen so ein bizarres Geschöpf, einen nur aus Tannen bestehenden Kraken, der seine monströsen Fangarme nach der so unscheinbaren Amphibie ausstreckte.
Als hätte die gegnerische Macht an einem Regler gedreht, intensivierten sich nun auch die grünen Blitze. Wie riesige Messer schnitten sie durch die Arme des Baumkollektivs, ließen dutzende Bäume auf einmal zu Asche zerfallen und sorgten so dafür, dass Kongina ungehindert in Richtung des schwebenden Objektes glitt. Schließlich tauchte sie in die Quelle des Lichts ein und verschwand aus dem Blickfeld des Umwelt-Dämons.
So einfach wollte Mandragoro nicht aufgeben. Trotz der Tatsache, dass er den von ihm geschaffenen Wald damit selbst zum Teil zerstörte, ließ er einen besonders langen, aus hunderten Tannen zusammengesetzten Arm in die Höhe fahren, um das mechanische Ungetüm noch irgendwie aufzuhalten. Diesmal drangen keine Blitze auf die Bäume ein, der Arm griff schlichtweg ins Leere. Das fliegende Objekt glitt innerhalb weniger Sekundenbruchteile hunderte Meter weit in die Höhe, durchstieß die Grenze der Dimension und verschwand in den Tiefen des Kosmos.
Der Angriff war damit beendet, doch der Umwelt-Dämon ahnte, dass Konginas Befreiung so etwas wie ein Anfang gewesen war. Wer auch immer ein Interesse an der Frosch-Königin hegte, würde versuchen, die Zeiten des alten Atlantis wiederauferstehen zu lassen, in dem sie gemeinsam mit ihrem König Raana über ein eigenes Reich geherrscht hatte.
Ohne die vor ihm liegenden Karten anzuheben, warf Sir James Powell einen Blick in die Runde, bis er an meinen treu schimmernden Augen hängenblieb. Wie der Superintendent es so oft tat, rückte er seine Brille zurecht, trank einen Schluck Wasser und schob geradezu aufreizend langsam seine Chips in die Mitte des Tisches.
Ein Raunen rann aus fast einem Dutzend Kehlen durch den Raum. Nicht alle Anwesenden nahmen an der Poker-Runde teil, einige saßen und standen auch rundherum und mimten die Kiebitze, wobei ich immer wieder den Blickkontakt zu Glenda suchte, die direkt hinter unserem Chef stand. Jedes Mal lächelte sie mir verkniffen zu, schüttelte den Kopf und legte einen Finger auf ihre Lippen. Nein, ich würde von ihr wohl keinen Tipp darüber erhalten, welches Blatt vor Sir James lag und warum es ihn dazu bewog, ›all in‹ zu gehen.
»Ich passe«, kündigte Suko an und schob seine Spielkarten von sich. Jane Collins tat es ihm kurz darauf gleich.
Ich warf meinen Freunden einen missbilligenden Blick zu.
»So viel zum Thema Loyalität«, stellte ich fest. »Am Ende muss ich es also wieder ausbaden.«
»Sie wollten es ja nicht anders, John.«
Sir James zeigte ein seltenes, verschmitztes Lächeln, das schnell wieder seinem ausdrucklosen Pokerface wich.
Keiner von uns war in der Lage, sein Spiel zu durchschauen, das hatte sich schon früh nach Beginn der Runde gezeigt. Insofern hatte er mit seinem Kommentar nicht ganz unrecht. Immerhin war ich auf die glorreiche Idee gekommen, ihn mit meinem unvergleichlichen Charme dazu zu bewegen, an der Feier im Haus der Conollys teilzunehmen. Vor allem, um zu verhindern, dass uns der Superintendent mit einem abendlichen Anruf aus dem seichten Vergnügen riss und auf einen neuen Fall ansetzte, so wie es bei unseren beiden Kämpfen gegen die Monsterfrösche von St. Theodor geschehen war. Dass ich uns dadurch den stärksten Pokerspieler, den Scotland Yard je gesehen hatte, ins Haus holen würde, hatte ich ja nicht ahnen können.
Für die Feier gab es – wie meistens – keinen besonderen Anlass. Es ging Bill und Sheila einfach darum, unsere Freunde so oft wie möglich zusammenzubekommen und das Leben zu genießen. Denn angesichts dessen, wie oft wir alle im Kampf gegen die Mächte der Finsternis dem Tod ins Auge sahen, wusste man nie, wie oft man mit seinem Gegenüber noch so ausgelassen lachen konnte. Wir alle kannten uns schon seit so langer Zeit, das allein sah ich schon als Geschenk an.
»So sieht es wohl aus«, erwiderte ich und warf einen Blick in die Runde. Neben Sir James, Suko, Jane und mir saßen noch Purdy Prentiss und Shao am Tisch, während unsere Gastgeber – Sheila und Bill – sich ebenso wie Chiefinspektor Tanner und seine Frau Kate dezent im Hintergrund hielten. Johnny und seine Freundin Cathy hatten dagegen dankend abgelehnt.
Keiner von uns hatte es so recht glauben wollen, als tatsächlich einmal die Zusage des alten Eisenfressers gekommen war. Es geschahen wohl wirklich noch Zeichen und Wunder, was wiederum bedeutete, dass es noch unwahrscheinlicher wurde, dass uns jemand mit einem Anruf belästigte.
Ich nickte. »Ich sehe schon, es bleibt wirklich an mir hängen. Also gut.«
Angesichts meines Blattes – zwei Könige, was mit den ausliegenden Karten einen Vierer bedeutete – erschien mir der gesamte Einsatz meiner Chips gar nicht mal so risikoreich. Allein die Souveränität des Superintendenten ließ mich an meinen Siegchancen zweifeln. Bisher hatte er noch jede Runde gewonnen, bei der er nicht frühzeitig ausgestiegen war. Sollte ihm das auch dieses Mal gelingen?
»Oh, oh, John«, richtete Shao einige mahnende Worte an mich. »Du glaubst doch nicht, dass du den Scotland-Yard-Meister besiegen kannst?«
Ich verschränkte demonstrativ die Hände vor der Brust. »Ich kann und ich werde.«
Suko winkte ab. »Das ist wohl wieder der Alkohol«, gab er mir zu verstehen.
»Hey, ich habe erst einen Becher von der Bowle getrunken.«