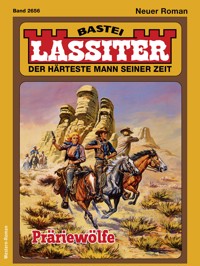1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lassiter
- Sprache: Deutsch
Was als Ausbildung für einen kleinen Kreis von Rekruten begonnen hat, entwickelt sich zu einem Kampf ums nackte Überleben. Für jene jungen Männer, die den Status eines Agenten der Brigade Sieben erlangen wollen, stehen die Zeichen auf Sturm, denn die Verschwörer im Hintergrund sind bestens aufgestellt.
Wie wird man in Washington auf die Zustände im Ausbildungscamp und den Tod eines Rekruten reagieren - und welche Konsequenzen wird der Senat daraus ziehen? Einflussreiche Militärangehörige, darunter der Vater des ermordeten Lawrence D. Foster, könnten eine Auflösung der Brigade Sieben fordern.
Politische Intrigen, angetrieben von General Wesley J. Ferguson, sind geeignet, den Initiatoren der Brigade Sieben das Genick zu brechen. Und in den Sümpfen von Louisiana lauert weiterhin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Feind in den Schatten
Interview
Vorschau
Impressum
Der Feind in den Schatten
Band 2 eines Zweiteilers von Des Romero
Die Rekruten waren nicht weit entfernt. Bestenfalls eine halbe Meile voraus. Normalerweise hätte Scott Beaver es vermieden, seine Schützlinge im Auge zu behalten, doch aufgrund des besorgniserregenden Vorfalls bei der ersten Prüfung hielt er es für angebracht, ihnen im Notfall Hilfe leisten zu können.
Einige Seile der zugebundenen Krokodilmäuler waren durchschnitten worden, was auf die Tat eines Unbekannten schließen ließ. Und diese Person mochte nun auch in den Sümpfen von Louisiana ihr Unwesen treiben. Ihre Motive waren Beaver nicht bekannt, aber er ahnte, dass sie sich nicht auf Sabotageakte beschränken würde. Seine Rekruten waren in Gefahr!
Es war dunkel, der Sumpf mit all seinen Tücken eine ständige Bedrohung. Wer sich in dieser Umgebung nicht auskannte, musste entweder überaus vorsichtig sein und jeden seiner Schritte abwägen – oder er würde im schlimmsten Fall elendig zugrunde gehen.
Im Nachhinein machte sich Beaver Vorwürfe. Er hätte diese Prüfung zurückstellen können in Anbetracht der Gefahr, wäre dadurch aber mit seinem Lehrplan in Verzug geraten. Ob man in Washington dafür Verständnis gezeigt hätte, war fraglich. Immerhin handelte es sich um ein Ausbildungscamp für angehende Agenten. Die Besten der Besten sollten unter widrigsten Umständen ausgewählt werden, denn sie würden immer wieder in ausweglos erscheinende Situationen geraten, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen mussten.
Mittlerweile fragte er sich aber, ob lebensbedrohliche Umstände Teil der Ausbildung sein sollten. Es lag allein in seiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Lage nicht eskalierte. Sobald er die Gruppe erreichte, würde er den Abbruch der Prüfung befehlen; egal, ob man ihn dafür zur Rechenschaft zog.
Wachsam schlich Beaver weiter, stapfte über moosbewachsene Erde und zwischen Büschen und Bäumen hindurch. Er kam rasch voran, merkte aber plötzlich, dass er nicht mehr allein war.
Scott Beaver hielt inne und duckte sich hinter einen Schleier aus Schlinggewächsen, die von einer Kiefer herabhingen. Angestrengt lauschte er in die Dunkelheit.
Es war ein flüchtiges Knacken gewesen, das er gehört hatte. Vielleicht war es nur eine Bisamratte oder ein anderes Tier, doch irgendetwas sagte dem Mann, dass mehr dahintersteckte.
Seine Ahnung sollte sich nur wenige Sekunden später bewahrheiten. Ganz kurz nur sah er eine Silhouette, die sich zwischen den Bäumen kaum von der Finsternis abhob, aber für die Dauer eines Lidschlages deutlich zu erkennen gewesen war.
Eine Weile noch verhielt sich Scott Beaver ruhig, doch niemand zeigte sich mehr in seinem näheren Umfeld. Vermutlich waren seine Sinne derart angespannt, dass er sich die Bewegung nur eingebildet hatte. In der Nacht sah vieles gänzlich anders aus als am Tage.
Seine Wachsamkeit vernachlässigte Beaver nicht, als er seinen Weg fortsetzte – und doch überraschte ihn der kaum wahrnehmbare Zischlaut. Gleich darauf verspürte er einen Stich in seinem Nacken und schlug instinktiv mit der Handfläche auf die brennende Stelle. Mit Daumen und Zeigefinger zog er einen kleinen Dorn aus seiner Haut und betrachtete ihn mit starrem Blick.
Verdammt!, fluchte er in sich hinein. Ein Giftpfeil!
Mit einem Mal spürte Beaver die Schwäche in seinen Beinen und musste sich an einem Baumstamm abstützen. Ein nebliger Schleier legte sich vor seine Augen, hinter dem plötzlich mehrere verwaschene Schattenrisse zu erkennen waren. Wie unheilvolle Boten einer düsteren Zukunft standen sie regungslos da und warteten darauf, dass ihr Opfer zusammenbrach.
Scott Beaver sah alles doppelt und hatte ein dröhnendes Rauschen in den Ohren. Das Gift in dem winzigen Pfeil tat seine Wirkung. An eine Gegenwehr war nicht mehr zu denken.
Halb gelähmt rutschte er am Stamm der Sumpfkiefer hinab und fiel anschließend zur Seite. Seine Fingerspitzen zuckten noch; den Rest seines Körpers konnte er kaum mehr spüren.
Aus unnatürlich geweiteten Augen sah er, wie die schattenhaften Gestalten ihre Starre ablegten und sich ihm näherten. Abwehrend wollte er eine Hand heben, doch längst hatte er die Kontrolle über seinen Körper verloren.
Der letzte klare Gedanke, der ihm durch den Kopf schoss, war die Frage, ob man ihn wohl lange leiden lassen würde...
✰
»Wir brauchen Hilfe!«, stieß Lassiter keuchend hervor, während er Clark Benedict mit sich zur Hütte des französischen Eremiten schleppte. Der stand mit einem Unbekannten auf der Veranda, der beim Anblick der Rekruten offenbar Erleichterung verspürte. »Mein Freund wurde von einer Schlange gebissen! Er braucht dringend ein Gegenmittel!«
Der Fremde neben dem Hüttenbesitzer trat einen Schritt vor und zog seinen Revolver. Wie selbstverständlich richtete er die Mündung auf Lassiter. »Wie wäre es mit dem hier? Damit kann ich ihn von seinem Leiden erlösen.«
Wie angewurzelt blieb Lassiter stehen. Benedicts Augen weiteten sich. Er zog sich an der Schulter seines Partners hoch. »Wir haben bereits einen Kameraden verloren«, ächzte er. »Was haben wir Ihnen getan, dass Sie uns bedrohen?«
»Lass es sein, Calhoun!«, schnarrte der Franzose mit deutlichem Akzent. »Ich habe alles hier, um den Jungen zu versorgen!«
Calhoun hob die freie Hand, um den Mann zum Schweigen zu bringen. »Halt einfach dein Maul, Jean!«, stieß er aus. »Du weißt, weshalb ich hier bin. Ein paar weitere Todesfälle werden meinem Auftraggeber eine gute Argumentationshilfe sein, dass dieses Ausbildungscamp geschlossen werden muss. Dafür werde ich bezahlt.«
Lassiter konnte kaum glauben, was er da gerade gehört hatte. Stumm betrachtete er den Schwarzgekleideten und zermarterte sich das Hirn, um einen Ausweg aus dieser Situation zu finden.
»Sie heißen Calhoun, ja?«, presste Clark Benedict hervor. »Habe ich Ihren Namen richtig verstanden?«
Calhoun grinste schäbig. »So schlecht scheint es dir noch nicht zu gehen, Freundchen. Deine Ohren funktionieren immerhin einwandfrei. Aber es wird dir nicht gelingen, mich umzustimmen. Euer Tod ist beschlossene Sache. Bringen wir es also hinter uns. Ich habe noch andere Dinge zu erledigen...«
Calhoun legte an und spannte den Hahn seiner Waffe. Auf seinen Lippen erschien ein bösartiges Lächeln.
Lassiter wollte Benedict einen Stoß verpassen, um ihn aus der Schusslinie zu schaffen. Doch noch bevor er sein Vorhaben umsetzen konnte, griff der Franzose ein und katapultierte sich wuchtig gegen Calhoun.
Die beiden Männer stürzten von der Veranda und landeten auf dem vom Regen aufgeweichten Erdboden. Dort rangen sie miteinander, doch keiner von beiden konnte erkennbar die Oberhand gewinnen.
Erst als Lassiter seinen Remington zog, um in den Kampf einzugreifen, wendete sich das Blatt. Calhoun versetzte dem Franzosen einen derben Tritt, sprang ihm entgegen und riss ihn auf die Füße, um anschließend seine linke Armbeuge um seinen Hals zu legen und ihn zu würgen. Die Faust mit dem Revolver hielt er auf den Kopf des Mannes gerichtet.
»Wollt ihr für seinen Tod verantwortlich sein?«, zischte Calhoun. »Dann kommt nur her!«
Der Kerl war ein gewissenloser Sadist. Er hätte den Franzosen erledigen und sich danach um Lassiter und Benedict kümmern können. Anscheinend aber liebte er es, ein grausames Spiel zu spielen und Hoffnung aufkeimen zu lassen, um sie im Anschluss brutal zu zerstören.
Lassiter konnte es nicht riskieren, von seinem Remington Gebrauch zu machen, obwohl er die Waffe bereits in der Faust hielt. Das Risiko, Jean anstelle von Calhoun zu treffen, war zu groß. Daher fällte er eine Entscheidung, die ihm als die einzig richtige erschien.
»Weg hier!«, zischte er Benedict ins Ohr und zerrte ihn mit sich. Aus dem Augenwinkel sah er, wie Calhoun seinen Revolver herumschwenkte und anlegte.
Die Flüchtenden durchbrachen ein Gebüsch, als der erste Schuss ertönte. Keuchend zogen sie die Köpfe ein, doch die Kugel kam nicht einmal in ihre Nähe.
»Weiter!« Lassiter stieß seinen Kameraden vorwärts und wagte einen flüchtigen Blick über die Schulter.
Erneut lagen Calhoun und der Franzose Jean im Clinch. Sie schenkten sich nichts und droschen aufeinander ein. Wer diesmal den Kürzeren zog, stand in den Sternen, doch Lassiter wollte das Ende des Kampfes nicht abwarten und rannte weiter.
Er hoffte inständig, dass sein Partner dem Schlangengift noch einige Zeit widerstehen konnte. Vielleicht ergab sich die Möglichkeit, zurückzukehren und ihm das Gegenmittel zu verabreichen. Wenn sie es geschickt anstellten, konnten sie Calhoun, sollte er sie verfolgen, in die Irre führen.
»Lass mich einfach zurück!«, japste Benedict. »Mit mir geht es zu Ende! Rette dich selbst!«
»Quatsch keinen Blödsinn!«, versetzte Lassiter ärgerlich. »Glaubst du im Ernst, ich lasse dich verrecken? Du solltest mich besser kennen!«
Unter Einsatz all ihrer Kräfte hetzten die jungen Männer durch die Sümpfe. Welche Strecke sie bereits zurückgelegt hatten, konnten sie nicht mit Sicherheit sagen, doch als sie die Erdhöhle unterhalb einer riesigen Baumwurzel entdeckten, strebten sie in stillem Einvernehmen darauf zu.
Lassiter zerrte loses Wurzelwerk herunter, um den Eingang der Höhle zu kaschieren. Dann hockte er sich mit Benedict in den Morast und holte seinen Remington hervor. Der Revolver war nass und verschmutzt, und er reinigte ihn mit seinem Hemdsärmel.
»Du willst dich wirklich mit diesem Killer anlegen?«, fragte Clark Benedict. »Dann musst du ihn schon mit dem ersten Schuss unschädlich machen, sonst feuert er einfach seine ganze Trommel in dieses Erdloch ab.«
»Mach dir darum keine Gedanken«, erwiderte Lassiter und steckte den Remington zurück ins Holster. »Eine gute Chance zu nutzen ist besser, als sie einfach verstreichen zu lassen.«
An Benedicts Gesichtsausdruck ließ sich ablesen, dass er Lassiters Ansicht nicht teilte. Doch er sagte nichts mehr, verbiss sich den Schmerz, der in seinen Eingeweiden wütete, und lehnte sich zurück. Dass ihm Schlamm auf Gesicht und Kleidung tropfte, bekam er schon gar nicht mehr mit.
✰
Es war eine eigentümliche Kälte, die von Scott Beaver Besitz ergriff, kaum dass er die Augen öffnete. Er lehnte an einem Baumstamm. Für kurze Zeit musste es heftig geregnet haben, denn seine Kleidung war von oben bis unten durchnässt. Und trotz der schwülen Hitze fror er.
Beaver führte es auf das Gift zurück, das man ihm mit dem Pfeil injiziert hatte. Zu seinem Glück hatte es ihn lediglich betäubt. Er wusste jedoch, dass die Houma-Indianer durchaus tödliche Substanzen herstellen konnten.
Denn sie waren es, die hinter dem Angriff steckten.
Nachdem sich sein Blick geklärt hatte, stellte Beaver fest, dass er von Eingeborenen umzingelt war. Offenbar befand er sich in ihrem Dorf. Sie umstanden ihn wie Statuen und sagten kein Wort. Als er sich erheben wollte, stellte er fest, dass man ihn an einen Baum gefesselt hatte.
»Was ist los mit euch?«, rief Beaver. »Warum habt ihr mich gefangen genommen? Ich dachte, wir arbeiten Hand in Hand!«
Ein Mann in farbenfrohen Gewändern trat aus einer Hütte hervor und musterte ihn mit undeutbarer Miene. »Du fragst nach dem Grund?«, erkundigte sich der Alte in ungewöhnlichem Dialekt. »Ich aber frage dich: Weshalb hast du uns verraten und großes Leid über mein Volk gebracht?«
Scott Beaver verstand nicht, was der Häuptling meinte. »Was redest du da, Outsukai?«, rief er aufgebracht und zerrte an den Stricken, die ihn hielten. »Warum sollte ich euch verraten? Und auf welche Art und Weise sollte ich es getan haben?«
Häuptling Outsukai senkte sein Haupt. »Es spricht nicht für dich, zu leugnen, was unübersehbar ist«, murmelte er. »Wir beklagen den Verlust eines jungen Korbflechters, der von zahllosen Messerstichen getötet wurde.«
Ungläubig stierte Scott Beaver sein Gegenüber an. »Wie kommt ihr darauf, dass ich das getan habe? Ich dachte, zwischen uns bestünden freundschaftliche Bande!«
Outsukai sah auf. Seine Miene spiegelte Trauer und Enttäuschung wider. »Ich habe nicht gesagt, dass du gemordet hast«, stellte er richtig. »Es waren diese jungen Männer, die du trainierst. Wenn du die Kontrolle über sie verloren hast, ist es letztlich auch deine Schuld.«
»Meine Rekruten würden niemals einen sinnlosen Mord begehen!«, verteidigte sich Beaver. »Ihr urteilt vorschnell und seht nur das, was ihr sehen wollt!«
Beschwichtigend hob der Häuptling eine Hand. »Niemand außer euch befindet sich auf diesem Gelände. Sie müssen den Mord begangen haben!«
»Wir sind nicht allein hier!«, stieß Beaver hervor. »Ihr kennt die Prüfung mit den Krokodilen. Jemand hat die Stricke um ihre Mäuler durchschnitten, sodass sie meine Rekruten hätten angreifen können. Derjenige, der das getan hat, muss auch für den Tod eures Stammesmitglieds verantwortlich sein!«
»Davon ist mir nichts bekannt«, entgegnete Outsukai skeptisch.
»Irgendwer sabotiert meine Prüfungen!«, beharrte Scott Beaver. »Jemand, der auch vor Mord nicht zurückschreckt! Ihn müssen wir finden! Damit klären wir auch den Mord an eurem Stammesmitglied auf!«
Outsukai winkte ab. »Du sprichst wie ein Ertrinkender, der sich an ein Schilfrohr klammert«, sagte er. »Dennoch kann ich deine Worte nicht unbeachtet lassen. Wir werden beraten, was mit dir geschehen soll...«
Die Houma-Indianer zogen sich in ihre Versammlungshütte zurück. Scott Beaver kam sich vor, als wäre er in einem Albtraum gefangen. Wie ein Damokles-Schwert schwebte das unausgesprochene Todesurteil über seinem Haupt.
Sollte er wirklich untätig warten, bis die Houmas eine Entscheidung gefällt hatten – die womöglich gegen ihn ausfiel? Keinesfalls! Er musste versuchen, von hier zu fliehen! Viel Zeit würde ihm dafür nicht bleiben.
Er ruckte an seinen ledernen Fesseln, die sich durch den Regen etwas geweitet hatten. Er drehte seine Handgelenke hin und her und versuchte die Finger der rechten Hand unter die Fessel um die Linke zu schieben.
Bald spürte er warmes Blut an Händen und Fingern, ließ aber in seinem Bemühen nicht nach. Er schabte sich regelrecht die Haut von den Knochen und riss sich die Handgelenke auf, bis er so viel Spielraum hatte, eine Hand aus der Schlinge zu winden.
Es hatte eine Viertelstunde gedauert, um sich zu befreien. Noch waren die Indianer nicht wieder aufgetaucht, aber es konnte jeden Moment so weit sein.
Als die Stricke endlich fielen, suchte Beaver sein Heil in der Flucht. Zwar hatte man ihm die Waffen abgenommen, doch er würde auch ohne sie in der Wildnis überleben.
Geduckt tauchte Scott Beaver im Wald unter. Ihm war klar, dass die Houmas ihn jagen würden, doch das war etwas, über das er sich gegenwärtig nicht den Kopf zerbrach. Wichtig für ihn war einzig, den unbekannten Saboteur zu finden und die Rekruten vor ihm zu schützen. Trotz der verlorenen Stunden war er überzeugt, sein Ziel noch erreichen zu können.
✰
Lassiter ruckte in die Höhe und lehnte sich gegen die schlammige Wand des Erdlochs. Er hatte Schritte gehört, die sich durch Morast und Wasser bewegten.
Auch Clark Benedict hatte es mitbekommen. »Ist das Calhoun?«, raunte er.
»Keine Ahnung«, gab Lassiter zurück. »Ich weiß nur, dass uns irgendwer auf den Fersen ist.« Vorsichtig lugte er durch das Wurzelwerk vor ihrem Versteck, verengte leicht die Lider und versuchte, jede Veränderung in seinem Blickfeld richtig zu deuten.
»Es kann nur Calhoun sein«, krächzte Benedict und kam auf wackligen Beinen zum Stehen. »Bestimmt hat er den Franzosen umgebracht und hat nun dasselbe mit uns vor.«
»Bleib ruhig!«, sagte Lassiter gedämpft. »Ich brauche nur ein Ziel, und unsere Probleme sind gelöst.«
»Das verschaffe ich dir«, zischte Clark Benedict, und bevor Lassiter reagieren konnte, warf er sich von hinten gegen ihn.
Der große Mann verlor das Gleichgewicht und landete bäuchlings im Morast, während Benedict aus der Wurzelhöhle torkelte und aus voller Lunge schrie: »Komm her, du verfluchter Bastard! Hier bin ich!« Er stapfte durch das kniehohe Wasser hinüber zum Ufer, stolperte und tauchte unter, kam aber gleich darauf wieder hoch und zog sich an Land.
»Dammit!«, fluchte Lassiter, erhob sich aus dem Schlamm und wischte sich übers Gesicht. Er hatte keine Ahnung, wo Calhoun sich befand, und es grenzte an Selbstmord, ihn auf diese Weise anzulocken.
Wütend wischte Lassiter die Wurzelfäden beiseite und trat ins Freie. Rechts von ihm, kaum dreißig Yards entfernt, befand sich sein Kamerad.
Da ertönte auch schon der erste Schuss. Von wo er gekommen war, ließ sich nicht feststellen, doch er verfehlte Clark Benedict zum Glück. Der junge Rekrut tauchte ins Unterholz ab und kroch weiter.
Lassiter feuerte mehrere Kugeln in die Richtung ab, in der er ihren Gegner vermutete. Als keine Gegenwehr erfolgte, glaubte er schon, Calhoun mit einem Zufallstreffer ins Jenseits befördert zu haben, doch die Realität holte ihn schnell wieder ein.
Ein regelrechtes Kugelgewitter brach los. Wasser und Morast spritzten und die Zweige kleinerer Sträucher flogen davon.
»Ist das alles, was du draufhast?«, krakeelte Benedict, stellte sich aufrecht hin und ruderte mit den Armen.
»Runter mit dir!«, blaffte Lassiter und tauchte selbst ab, um hinter einem Wurzelgeflecht Deckung zu suchen. Er konnte es nicht riskieren, zu Benedict aufzuschließen, wäre er doch ein zu gutes Ziel für einen geübten Schützen gewesen. Aber er wollte, so gut es ging, Feuerschutz leisten. Auch ein hartgesottener Hund wie Calhoun war nicht kugelsicher und musste irgendwann seinen Revolver nachladen.
»Mach schon, Calhoun!«, kreischte Clark Benedict schon fast hysterisch, schwankte dabei wie ein Blatt im Wind und schien nur eines im Sinn zu haben: das Feuer ihres Widersachers allein auf sich zu ziehen.
Dann machte Lassiter die entscheidende Entdeckung: Er sah Calhoun keine fünfzig Yards entfernt.
Gezielt jagte er die letzten Kugeln aus seinem Remington, verbarg sich erneut hinter dem Wurzelgeflecht und lud nach. Allzu viele Patronen hatte er nicht mehr in den Schlaufen seines Gürtels, doch für eine weitere Trommelfüllung würden sie reichen.