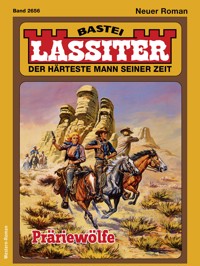1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lassiter
- Sprache: Deutsch
Mit gemischten Gefühlen betrat Lieutenant Jost van Zander das Office des Fortkommandanten und salutierte.
"Stehen Sie bequem", raunte Colonel Stephen Kirby. "Sie wissen, weshalb ich Sie rufen ließ?"
Unbehaglich nickte van Zander. "Natürlich, Sir! Ich möchte allerdings einwenden, dass..."
"Keine Einwände!", entfuhr es dem Colonel. Er schlug mit der flachen Hand auf seinen Schreibtisch und erhob sich. "Die Anweisungen des Oberkommandos sind eindeutig, stehen nicht zur Diskussion und müssen unverzüglich ausgeführt werden!"
Auf eine Geste seines Vorgesetzten hin nahm Jost van Zander auf einem Stuhl Platz. Er wusste, was von ihm erwartet wurde. Und genau dieser Umstand bereitete ihm Bauchschmerzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Die Squaw und der Killer
Vorschau
Impressum
Die Squaw und der Killer
von Des Romero
Mit gemischten Gefühlen betrat Lieutenant Jost van Zander das Office des Fortkommandanten und salutierte.
»Stehen Sie bequem«, raunte Colonel Stephen Kirby. »Sie wissen, weshalb ich Sie rufen ließ?«
Unbehaglich nickte van Zander. »Natürlich, Sir! Ich möchte allerdings einwenden, dass...«
»Keine Einwände!«, entfuhr es dem Colonel. Er schlug mit der flachen Hand auf seinen Schreibtisch und erhob sich. »Die Anweisungen des Oberkommandos sind eindeutig, stehen nicht zur Diskussion und müssen unverzüglich ausgeführt werden!«
Auf eine Geste seines Vorgesetzten hin nahm Jost van Zander auf einem Stuhl Platz. Er wusste, was von ihm erwartet wurde. Und genau dieser Umstand bereitete ihm Bauchschmerzen.
»Ich stelle Ihre Befehle nicht infrage«, ließ der Lieutenant verlauten. »Es geht mir nur darum, eine Strategie zu entwickeln, die allen Seiten gerecht wird. Dazu aber benötige ich Zeit.«
Unwillig verzog Colonel Kirby den Mund und schüttelte verhalten seinen Kopf. »Bei den Dingen, die uns nicht im Überfluss zur Verfügung stehen, nimmt die Zeit den ersten Platz ein«, versetzte er. »Die Comanchen müssen das Gebiet innerhalb von zwei Wochen räumen! In den nächsten Tagen erwarte ich einen vom Häuptling unterschriebenen Vertrag, ansonsten bin ich gezwungen, mit militärischer Gewalt vorzugehen.«
Lieutenant van Zander schnappte nach Luft. »Das ist vollkommen unmöglich! Die Indianer schließen keine Abkommen zwischen Tür und Angel. Wie soll ich ihnen erklären, dass sie weichen müssen, um Platz für eine neue Handelsroute zu schaffen? Das könnte nur jemand, dem sie vertrauen. Aber Vertrauen braucht Zeit. Sie ist der Schlüssel zum Erfolg!«
Colonel Stephen Kirby verschränkte die Arme hinter dem Rücken und ging einige Schritte durch sein Büro. Vor einem Bücherregal blieb er stehen, drehte sich seinem Adjutanten zu und schaute ihn durchdringend an. »Sehen Sie die Augenklappe in meinem Gesicht?«, fragte er. »Ich habe mein linkes Auge verloren, weil ich jemandem vertraute. Und von diesem Zeitpunkt an habe ich mir geschworen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und keinen Beteuerungen mehr zu glauben. Vertrauen ist die Abwesenheit eigener Initiative, Lieutenant! Wenn diese Rothäute also auf Vertrauen bauen, sind sie nicht wert, dass ich mich mit ihnen beschäftige.«
»Und ich bin nicht zur Armee gegangen, um Gewalt gegen friedliebende Menschen auszuüben!«, hielt van Zander dagegen. »Die Comanchen leben seit Urzeiten an diesem Ort. Sie sind mit der Natur verwachsen und haben eine spirituelle Bindung an sie. Und alles, was Ihnen dazu einfällt, ist der Einsatz von Schusswaffen, sollten sie sich weigern, ihren angestammten Lebensraum zu verlassen!«
Kirby schnellte vor und packte seinen Untergebenen beim Kragen. »Sie vertreten die Interessen von Washington!«, zischte er. »Aus keinem anderen Grund tragen Sie diese verdammte Uniform! Sie werden den Comanchen unser Ultimatum verkünden und den unterschriebenen Vertrag zur Umsiedlung bei mir abliefern.« Er zog seine Rechte zurück und wischte sich durchs Haar. »Ich verstehe sowieso nicht, weshalb man unbedingt Verträge mit Menschen schließen möchte, die nicht einmal schreiben können. Ginge es nach mir, würde ich diesen Wilden einen Arschtritt verpassen.«
Für Jost van Zander brach eine Welt zusammen. Für derartige Aktionen hatte er sich nicht gemeldet. Andererseits betrachtete er sich als die letzte Defensive, die zwischen den Indianern und der US-Army stand. Möglich, dass es ihm trotz aller Widernisse gelang, eine Einigung zu erzielen.
»Ich werde mit dem Häuptling reden«, hauchte er. »Eine Eskalation der Ereignisse muss auf jeden Fall vermieden werden.«
Ein mildes Lächeln huschte über Kirbys Züge. »Endlich nehmen Sie Vernunft an«, ließ er van Zander wissen. »Die Generalität sitzt mir im Nacken, wie ich Ihnen im Nacken sitze. Also, strengen Sie sich an, Lieutenant! Denn wie auch immer es ausgehen mag, wird es nicht mein Kopf sein, der rollt...«
Jost van Zander hatte verstanden. Der Dreck fiel immer von oben nach unten. Und wenn er nicht die Resultate lieferte, die sein Vorgesetzter erwartete, würde er ganz allein die Suppe auslöffeln müssen.
Und vielleicht war das exakt der Punkt, auf den es Colonel Kirby ankam. Der Mann hatte van Zander aufgrund seiner europäischen Herkunft nie wirklich akzeptiert. Es mochte ihm gelegen kommen, wenn der Niederländer bei seiner Aufgabe versagte.
Doch durch diese Rechnung wollte Jost van Zander ihm einen Strich machen. Nicht nur lag ihm daran, für die Comanchen faire Bedingungen auszuhandeln, er wollte sich auch in seiner Position behaupten. Kerle wie Kirby bildeten sich allzu viel auf ihre Abstammung ein und hielten sich für etwas Besseres. Für die Ureinwohner Amerikas hatten sie nicht mehr als Verachtung übrig und schreckten auch nicht davor zurück, Frauen, Kinder und Greise abzuschlachten.
»Gibt es noch irgendwelche Fragen?«, erkundigte sich Stephen Kirby und legte einen Tonfall an den Tag, der unmittelbar zur Ausgangstür wies.
»Ich werde mich unverzüglich zum Lager der Comanchen begeben«, versprach Lieutenant van Zander. Er erhob sich, ließ einen knappen Gruß folgen und verließ das Gebäude.
✰
Erneut hatte es Lassiter nach New Mexico verschlagen, ein Revier, in dem das Verbrechen zu sprießen schien wie kaum anderswo im Lande. Und wieder ging es um einen Galgenstrick, der die Nähe zur mexikanischen Grenze nutzte, um in den Vereinigten Staaten Terror zu stiften und sich anschließend bequem der amerikanischen Justiz zu entziehen. Nicht einmal ein Bundesmarshal besaß irgendwelche Befugnisse in Mexiko. Ging er über die Grenze, um einem Halunken das Handwerk zu legen, stand er bereits mit einem Bein im Grab.
Mexikanische Behörden sahen es nicht gerne, wenn man sich in ihre Angelegenheiten mischte. Und sie hatten auch kein Problem damit, sich von Banditen schmieren zu lassen. Nicht selten waren amerikanische Gesetzeshüter, die sich ihrer Berufsehre verpflichtet hatten, im Sand der Wüste begraben worden.
Für Lassiter war es ebenfalls eine besondere Herausforderung, in New Mexico zu ermitteln. Er wusste, dass sich ein Grenzübertritt nicht immer vermeiden ließ. Er wusste aber auch, dass er allein auf weiter Flur stand. Von der Brigade Sieben hatte er keinen Rückhalt zu erwarten. Die Agenten des Geheimdienstes agierten auf eigene Faust. Es lag in ihrem Ermessen, was sie sich zumuteten. Wer sich selbst überschätzte, fand ein namenloses Grab.
Lassiter hatte einen langen Ritt hinter sich und sehnte sich nach Entspannung. Ob dies auf einer Matratze oder einer jungen Frau standfand, überließ er dem Schicksal. Er tendierte allerdings dazu, der letztgenannten Möglichkeit den Vorrang zu geben. Und als er in eine Bodega einkehrte, dauerte es nicht lange, bis er sich in weiblicher Gesellschaft befand.
»Spendierst du mir ein Glas Wein?«, gurrte eine Schwarzhaarige, die wie die personifizierte Sünde wirkte. Ihr Gesicht und ihre nackten Arme waren zart gebräunt, ihr Körper mit den strammen Brüsten eine biblische Versuchung. Das Gemälde eines Künstlers mit all seinen auf Leinwand gebrachten Wunschvorstellungen einer perfekten Frau hätte nicht die Reize dieser jungen Göttin einfangen können.
»Du darfst darin baden«, erwiderte Lassiter und spürte gleichzeitig den Schub heißer Erregung, der seinen Körper durchlief. Er malte sich aus, diese Frau zu besitzen und mit ihr gemeinsam die Grenzen der Lust auszuloten.
»Ich heiße Tabia«, sagte das Girl. »Hast du auch einen Namen?«
Lassiter nannte ihn, bestellte eine Karaffe mit Wein und wies auf einen Tisch, der in den Schatten der Bodega lag.
Tabia ließ sich mitführen und setzte sich. In ihrem Blick lag unbändiges Verlangen. Lassiter war sicher, sie hätte sich ihm an Ort und Stelle hingegeben, hätte er nur mit den Fingern geschnippt. Dazu hätte er sogar auf die Privatsphäre verzichtet, die ihm ansonsten recht wichtig war.
»Meine Güte, ist das warm«, meinte Tabia und zog ihre Bluse ein Stück weit auf. Einen Zentimeter mehr, und die Ansätze ihrer Brustwarzen wären sichtbar gewesen.
Gönnerhaft lächelte Lassiter. »Wir können auf ein Zimmer gehen und den Wein dort trinken«, schlug er vor. »Hier sind einfach zu viele Augen.«
Die dunkelhaarige Tabia zuckte zurück und schaute Lassiter entsetzt an. »Glaubst du etwa, ich bin eine Hure?«, stieß sie hervor. »Muss ich bei dir für ein Glas Wein die Beine breitmachen?«
Für Lassiter kam die Eröffnung ebenso überraschend wie das Klicken eines Revolvers in seinem Rücken. Er drehte sich herum und blickte in die Mündung einer schussbereiten Waffe.
»Ihr Typen seid alle gleich«, knurrte ein Kerl, der nur unwesentlich älter als Tabia wirkte. »Ihr nutzt die Gutmütigkeit eines unschuldigen Mädchens aus, um eure schmutzigen Triebe auszuleben. Ein Glück, dass ich in der Nähe war, denn jetzt wirst du für dein widerwärtiges Ansinnen bezahlen!«
Lassiter war wie vor den Kopf gestoßen, wusste aber auch gleich, was die Stunde geschlagen hatte. »Du bist wohl ihr Freund, was? Dann wird es dich interessieren, dass Tabia mir Avancen gemacht hat. Nimm also den Revolver aus meinem Gesicht, schnapp dir deine Freundin und geht eurer Wege!«
»Penner!«, fauchte der junge Mann. »So einfach kommst du aus der Sache nicht raus! Für deine Frechheit wirst du bezahlen – und zwar in harten Dollars!«
Innerlich musste Lassiter schmunzeln, ging jedoch auf das Spiel ein. »Woran hattest du denn gedacht, um das Ansehen von Tabia wieder reinzuwaschen? Fünfzig Dollar? Hundert?«
Der Kerl mit dem lockeren Revolver wirkte überrascht. Aber nur für einen Augenblick. Rasch witterte er seine große Chance. »Für zweihundert Dollar kommst du mir heiler Haut davon! Dann will ich noch mal Gnade vor Rechte gehen lassen. Dafür verschwindest du aus der Stadt! Noch heute!«
Mit zu Schlitzen verengten Augen schaute Lassiter sein Gegenüber an. Dann schüttelte er seinen Kopf. »Das kann ich nicht machen«, raunte er mit fester Stimme. »Ich habe hier noch ein paar Dinge zu erledigen. Du wirst dir wohl oder übel einen anderen Dummen suchen müssen...«
Tabia sprang vom Tisch auf und schrie zu ihrem Freund herüber: »Der will's nicht anders, Ben! Schlag dem Bastard die Fresse ein!«
»Jetzt rück schon den Zaster raus!«, schnitt Bens Stimme durch die Luft. »Willst du wegen so einer Scheiße draufgehen?«
Die Bewegung, mit der Lassiter zum Gegenschlag ausholte, kam derart unverhofft und unvergleichlich schnell, dass nur ein Mann mit überragenden Instinkten und langer Kampferfahrung angemessen darauf hätte reagieren können. Allerdings gehörte Ben nicht zu dieser Sorte. Reflexhaft schrie er auf, als Lassiter mit beiden Händen zupackte, das Handgelenk des Kerls verdrehte und ihn in die Mündung seiner eigenen Waffe starren ließ. »Kein so schönes Gefühl, oder?«, fragte der Brigade-Agent.
»N-nein...«, stotterte Ben und geriet ins Schwitzen. »Warum vergessen wir die Angelegenheit nicht einfach? Ich habe einen Fehler gemacht und daraus gelernt. Es... es wird nicht wieder vorkommen. Ich verspreche es!«
Lassiter entwand dem Mann den Revolver, zerlegte ihn mit wenigen Griffen und warf die Einzelteile durch den Schankraum. »Such dir eine ehrliche Arbeit, Junge«, sagte er. »Du wirst sonst irgendwann auf jemanden stoßen, der keine Skrupel hat, dir und deiner Freundin jeden Knochen im Leib zu brechen. Und solltest du auf einen Kerl aus der Bande von Benicio Marquez stoßen, ist das noch das Netteste, was euch passieren wird.«
Tabia rannte hinüber zu Ben. Der packte seine Geliebte und zerrte sie aus der Bodega. Lassiter hoffte, dass die beiden ihre Lektion gelernt hatten. Alt würden sie nicht werden, sollten sie mit ihrer Masche fortfahren.
Lassiter setzte sich zurück an den Tisch und zündete sich einen Zigarillo an. Mit der ersehnten Entspannung würde es wohl vorerst nichts werden, was ihn dazu veranlasste, sich seinen Auftrag wieder ins Gedächtnis zu rufen. Die Mission, die ihm die Brigade Sieben auferlegt hatte, war heikel, denn sie mochte durchaus mit sich bringen, dass er sich auf mexikanischen Boden begeben musste.
Nicht ganz zufällig hatte er den Namen Benicio Marquez in Bens Gegenwart erwähnt. Der Banditenboss hatte sich in den letzten Jahren eine hartgesottene Söldnertruppe aufgebaut und überzog New Mexico mit Überfällen. Dabei ging er radikal und rücksichtslos vor und brachte lieber mehr als zu wenige Leute um. Der Blutzoll, den er bislang gefordert hatte, überstieg jegliche Toleranzgrenze. Und es war zu erwarten, dass er noch weitaus mehr Halunken um sich scharen und den Terror ausweiten würde.
Für einen einzelnen Mann war es nahezu unmöglich, Marquez auszuschalten. Erschwerend kam hinzu, dass niemand auch nur ansatzweise wusste, wo er sich aufhielt. Der Bandit schlug aus dem Nichts zu und verschwand auch wieder dorthin. Auf einer Grenzlinie von knapp fünfhundert Meilen war er schon überall gesichtet worden. Lassiter würde eine ordentliche Portion Glück benötigen, um seiner habhaft zu werden.
Dass die Göttin Fortuna es in diesem Fall gut mit ihm meinte, darauf hätte er sich im Traum nicht verlassen...
✰
Das Dorf der Comanchen war einen guten Halbtagesritt von Fort Marcy entfernt. Lieutenant Jost van Zander machte sich keine allzu großen Hoffnungen, ein positives Ergebnis zu erreichen, und hatte genügend Proviant dabei, um einen Tag in der Wildnis zu überleben. Es mochte nämlich sein, dass die Indianer allergisch auf seine Anwesenheit und seine Forderungen reagierten und ihn achtkantig des Landes verwiesen. Sollte van Zander mit solcherlei Neuigkeiten vor seinen Vorgesetzten treten, würde ein militärischer Eingriff unausweichlich sein.
Doch noch machte sich der junge Offizier keine großen Sorgen. Vielleicht gelang es ihm ja auch mit geschickter Rede, das stolze Volk der Comanchen zu überzeugen. Nach den großen Indianerkriegen der vergangenen Jahre gelang es unter Umständen, einen Kompromiss zu erreichen. Die Ureinwohner des Kontinents mussten inzwischen begriffen haben, dass sie der Feuerkraft der US-Army hoffnungslos unterlegen waren.
Jost van Zander war kein Mann des Krieges, und es tat ihm in der Seele weh, wenn er daran dachte, wie ungehemmt und in der Überzeugung, ein Anrecht auf alles Land zu haben, sich der weiße Mann ausbreitete.
Sicher, es gab stets zwei Seiten einer Medaille. Auf beiden Seiten war viel gemordet worden. Letztlich aber fühlte der Lieutenant mit den Indianern, denn ihr einziger Fehler war, dass sie dort lebten, wo sich Fremde niederlassen wollten.
War es diese Einstellung gewesen, die Colonel Stephen Kirby veranlasst hatte, ausgerechnet ihn zum Unterhändler zu machen? Bei genauer Überlegung musste van Zander verneinen. Kirby hatte immer schon unterschwellig seine Abneigung gegen den Niederländischstämmigen zum Ausdruck gebracht, seit er von Fort Sully im Department Dakota in den Süden der Vereinigten Staaten versetzt worden war. Hier lagen die Offizierspatente seit Generationen in denselben Familien und wurden sozusagen weitervererbt. Wer von außerhalb der Südstaaten kam – geschweige denn aus einem anderen Land oder gar Kontinent – wurde argwöhnisch beäugt und kaum respektiert.
Hoffte Colonel Kirby darauf, dass van Zander scheiterte? Ging es ihm einzig darum, vor dem Oberkommando eine gute Figur zu machen, um die Rechtfertigung einzuholen, einen erbarmungslosen Krieg vom Zaun brechen zu können?
Der Lieutenant wollte sich nur ungern vorstellen, dass es in den Reihen der Armee Menschen mit solcher Gesinnung gab, doch vermutlich würde man ihn eines Besseren belehren. Umso wichtiger war es, die Comanchen auf eine friedliche Umsiedlung einzustimmen.
Mit derart guten Vorsätzen im Gepäck, erreichte Lieutenant Jost van Zander die Hügelkette, hinter der das Comanchendorf lag. Doch als er vom Felsengrat einen Blick hinunter ins Tal warf, wollte sein Herz vor Grauen seine Brust sprengen.
Mehrmals musste der junge Offizier hinsehen, um sich zu vergewissern, dass seine Sinne ihm keinen Streich spielten. Dann trieb er seine Stute an und preschte über die dürre Steppe.
Dichte Qualmwolken lagen in der Luft; die meisten Zelte waren nur noch rauchende Trümmer. Reglose Gestalten lagen am Boden, und das Jammern der Hinterbliebenen wurde lauter, je näher van Zander kam. Er wusste genau, dass die Kavallerie noch nicht ausgerückt war, doch irgendwer musste das Dorf überfallen haben. Es gab keine andere Erklärung für die Verwüstungen und die Toten, die mit jedem zurückgelegten Yard mehr zu werden schienen.
Einige Krieger formierten sich, um Jost van Zander in Empfang zu nehmen. Man konnte ihnen nicht verübeln, dass sie jedem Fremden mit Feindseligkeit entgegenblickten.
»Ich komme in Frieden!«, rief der Lieutenant aus, zügelte sein Pferd und hob beide Arme. Schließlich stieg er aus dem Sattel und kam mit erhobenen Händen heran.
»Wer bist du und was willst du?«, schnarrte die Stimme einer Frau. Sie war hochgewachsen und allem Anschein nach eine durchtrainierte Kämpferin. Und so ungewöhnlich es auch war, dass eine Frau sich als Sprecherin ihres Stammes präsentierte, brachte der Offizier ihr die nötige Achtung entgegen.