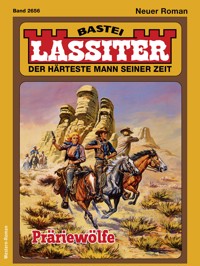1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Für Earl Fenton war Twin Oaks eine Station von vielen, an denen er sein Pokertalent unter Beweis stellte. Eines Tages, da war er sich sicher, würde er es auch an die großen Tische im Norden und Osten des Landes schaffen.
"Wie sieht's aus?", schnarrte John Waxford, der den Pot in die Höhe getrieben und die restlichen Mitspieler zum Aufgeben gezwungen hatte. "Gehen Sie mit?"
Fenton schaute auf seine Karten, danach in das Gesicht seiner Geliebten Sherry-Belle. Die schenkte ihm ein zuversichtliches Lächeln.
Zweihundert weitere Dollars wanderten in den Pot - und Fenton deckte auf. Kaum lag sein Blatt offen sichtbar auf dem Tisch, wurde dem Spieler beim Blick in Waxfords Miene klar, dass er einen unverzeihlichen Fehler begangen hatte...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Spiel ohne Sieger
Vorschau
Impressum
Spiel ohne Sieger
von Des Romero
Für Earl Fenton war Twin Oaks eine Station von vielen, an denen er sein Pokertalent unter Beweis stellte. Eines Tages, da war er sich sicher, würde er es auch an die großen Tische im Norden und Osten des Landes schaffen.
»Wie sieht's aus?«, schnarrte John Waxford, der den Pot in die Höhe getrieben und die restlichen Mitspieler zum Aufgeben gezwungen hatte. »Gehen Sie mit?«
Fenton schaute auf seine Karten, danach in das Gesicht seiner Geliebten Sherry-Belle. Die schenkte ihm ein zuversichtliches Lächeln.
Zweihundert weitere Dollars wanderten in den Pot – und Fenton deckte auf. Kaum lag sein Blatt offen sichtbar auf dem Tisch, wurde dem Spieler beim Blick in Waxfords Miene klar, dass er einen unverzeihlichen Fehler begangen hatte...
»Ich glaube nicht an Glück oder Zufälle«, sagte John Waxford, während Fenton das Geld in der Spieltischmitte einsammelte. »Und beides haben Sie an diesem Abend überstrapaziert.«
Irritiert schaute Earl Fenton sein Gegenüber an. »Pokern hat in den wenigsten Fällen mit Glück oder Zufall zu tun«, versicherte er.
»Tatsächlich?« Waxford zeigte ein eigentümliches Grinsen, das abschätzig die Worte seines Mitspielers infrage stellte. »Würden Sie dasselbe auch von einem Würfelspiel behaupten?«
Nun war es Fenton, der sich ein Lächeln nicht verkneifen konnte. »Würfel besitzen keine Charaktereigenschaften, die man sich zunutze machen könnte. Menschen schon.«
Wütend sprang Waxford auf, streckte seinen rechten Arm aus und deutete mit dem Zeigefinger auf Fenton. »Ich bezichtige Sie des Falschspiels!«, posaunte er. »Jedem an diesem Tisch ist klar, dass Ihre vermeintliche Glückssträhne nicht mit rechten Dingen zugeht! Daher werden Sie Ihren Gewinn auf der Stelle zurückgeben und die Stadt verlassen!«
»Das sehe ich genauso«, sagte ein zweiter Spieler. »Ich kenne John schon seit den Tagen des Bürgerkriegs und weiß genau, dass er keine ungerechtfertigten Bezichtigungen aussprechen würde. Sie tun also besser, was er sagt.«
Unerwartet mischte sich Sherry-Belle in das Streitgespräch ein. »Einen Moment noch, meine Herren!«, rief sie laut aus. »Sie können meinen Partner durchsuchen – er wird sich nicht dagegen sträuben! Und sollte er gezinkte Karten haben, können Sie mit ihm machen, was Ihnen beliebt.«
»Wer sagt uns, dass du bei dem Betrug nicht mitgeholfen hast?«, versetzte John Waxford. »Vielleicht sollten wir lieber dich durchsuchen! Falls wir unter deiner Bluse keine Asse und Könige finden, dann ganz sicher ein paar pralle Euter!«
Earl Fenton riss der Geduldsfaden. Er stieß seinen Stuhl zurück und fuhr in die Höhe. »Es reicht!«, brachte er zornig hervor. »Nicht nur, dass Sie mich einen Lügner und Betrüger schimpfen – Sie beleidigen auch noch die Frau an meiner Seite! Und ich verlasse diesen Saal nicht eher, bis Sie sich bei ihr entschuldigt haben!«
Für Waxford war es ein Affront, den er nicht so leicht schlucken konnte. »Ich soll mich entschuldigen?«, ächzte er ungläubig. »Ausgerechnet bei denen, die mich bis aufs Hemd ausgenommen haben?«
»Sie sollten nicht mehr Dollars verspielen, als Sie sich auch wirklich leisten können«, gab Fenton zurück.
Mittlerweile hatte sich auch der Spieler zu John Waxfords Linker erhoben. »Mein Name ist Art Grindel«, sagte er in ruhigem Tonfall. »Wie ich bereits andeutete, ist mein Kriegskamerad ein Mann, dem ich mein Leben anvertrauen würde. Und ganz gleich, ob er im Recht ist oder nicht, stehe ich ihm bei. Geht es in Ihren Kopf, was ich Ihnen damit sagen möchte?«
Earl Fenton nickte. »Sie verteidigen eine haltlose Behauptung, weil Sie denjenigen, der sie ausgesprochen hat, gut kennen...«
»Ich kenne ihn nicht nur gut!«, schrie Grindel plötzlich. »Wir sind wie Brüder, die füreinander einstehen, komme, was da wolle! Sie mit Ihrem geleckten Anzug und Ihren Taschenspielertricks werden niemals verstehen, was echte Freundschaft ist! Und das ist auch gar nicht nötig, denn wenn das Geld nicht in den nächsten fünf Sekunden auf dem Tisch liegt, werden Sie für den Rest Ihres Lebens bedauern, Twin Oaks betreten zu haben!«
Fenton zitterte am ganzen Körper und regte sich nur wenig ab, als Sherry-Belle ihre Arme um ihn legte. »Gib ihnen die Dollars zurück«, flüsterte sie ihrem Geliebten zu. »Es gibt noch andere Städte, in denen du spielen kannst. Es ist kein großer Verlust.«
Mit sanfter Gewalt befreite sich Earl Fenton aus der Umarmung und zischte: »Es waren ehrliche Gewinne, Honey! Warum soll ich auf etwas verzichten, das mir zusteht?«
»Die Zeit läuft!«, erinnerte ihn Grindel. »Wenn Sie nicht mit Knochenbrüchen und Blutergüssen zum nächsten Doc transportiert werden wollen, sollten Sie sich endlich entscheiden!«
Ehe Fenton überhaupt reagieren konnte, schritt Waxford ein. »Mir reicht's jetzt mit dieser Mäusekacke! Freiwillig wird der Bastard die Moneten nicht herausrücken! Und ein Falschspieler ist für mich ein ebensolcher Drecksack wie ein Pferdedieb!«
Im Nu hatte er einen Revolver in der Hand und schoss. Das Brüllen seiner Waffe kam zeitgleich mit der von Fenton. Beide Männer zuckten unter den Kugeleinschlägen zusammen, doch nur Waxford ging in die Knie, stürzte vornüber und schlug mit seinem Schädel gegen die Tischkante. Als er auf dem Boden ankam, lebte er schon nicht mehr.
»Schnappt ihn euch!«, stieß Art Grindel aus, und sofort stürzten mehrere Männer vor, die Fenton auf die Dielen zwangen. Für einen Moment spielte Grindel mit dem Gedanken, den Spieler kaltblütig abzuknallen, doch er ließ seinen Revolver im Holster.
»Holt den Sheriff!«, schrie einer aus der Menge.
Während kräftige Kerle Earl Fenton niederrangen und Sherry-Belle von ihm fernhielten, wandte sich Grindel an den Barkeeper. »Hast du gesehen, was passiert ist?«, fragte er.
Der Schankwirt nickte hastig, gab aber nicht die erwartete Antwort. »Dieser Fenton hat in Notwehr gehandelt! Waxford hat zuerst gezogen!«
Ein düsterer Zug huschte um Art Grindels Mundwinkel. »Du weißt genau, dass John der beste Freund war, den ich jemals hatte. Jeder verdankt dem anderen mehrfach sein Leben. Und solltest du bei deiner Aussage vor dem Sheriff seinen Namen in den Schmutz ziehen, kann es durchaus geschehen, dass du ihm in der Hölle Gesellschaft leistest. – Habe ich mich klar und verständlich ausgedrückt?«
»Fenton hat zuerst geschossen!«, presste der Barkeeper hervor.
Grindel lächelte. »Das ist genau das, was du auch einigen deiner Gäste stecken wirst. Ich will, dass dieser Kerl eingebuchtet und danach am nächsten Galgen aufgeknüpft wird. Er soll noch ein wenig leiden, bevor ihn der Tod ereilt. Das ist der einzige Grund, warum ich ihn nicht auf der Stelle fertiggemacht habe.«
✰
»Brigade Sieben?«, hakte Town-Marshal Brewster nach. »Und diese schwammige Bezeichnung gibt Ihnen die Rechtfertigung, Jagd auf einen Outlaw zu machen?«
»Ich brauche keine Rechtfertigung«, erwiderte Lassiter. »Ich wollte Sie nur nicht im Unklaren darüber lassen, dass ich eine gewisse Legitimation habe. Betrachten Sie es als kameradschaftlichen Dienst. Schließlich sind wir hinter demselben Kerl her.«
Brewster verzog die Mundwinkel. »Ist wohl eine geheime Organisation, was? Ich habe nämlich nie von ihr gehört.«
»Geheimer, als Sie es sich vorstellen können«, bestätigte Lassiter.
»Und wieso erzählen Sie mir dann davon?«
Lassiter sah den Marshal nicht an, sondern fixierte mit brennendem Blick das Farmgebäude voraus. »Keiner würde Ihnen abnehmen, dass es eine Brigade Sieben gibt. Es ist nur der Name einer Gesellschaft, die offiziell gar nicht existiert.«
»Und das soll mich jetzt wohl beruhigen, oder?«, feixte der Marshal.
Schmunzelnd erwiderte Lassiter: »Wenn Sie mir vertrauen, wissen Sie, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Fragen Sie mich aber nicht nach einem Abzeichen oder Ausweis – derartiges stellen die Herren in Washington nicht aus. Ich bin aber auf Ihrer Seite, Brewster, das dürfte schwer zu übersehen sein.«
»Wie sollen wir vorgehen?«, fragte der Marshal und ging nicht weiter auf Lassiters Aussagen ein. »Connelly hat mehrere Geiseln und ist vermutlich nicht allein.«
»Ich gehe vorne rein und stelle mich ihm«, gab Lassiter zurück. »Sobald er sich in Sicherheit wiegt, können Sie zuschlagen, Marshal.«
»Das gefällt mir nicht«, versetzte Brewster. »Connelly könnte durchdrehen und wild um sich schießen.«
Lassiter nickte. »Ich nehme die Hintertür!«
Schon wollte er sich an das Gebäude heranschleichen, da wurde die Tür aufgestoßen. Ein fettleibiger Kerl im verschwitzten Unterhemd erschien im Eingang und feuerte wahllos seine Rifle ab. »Versucht nur, mich zu holen!«, schrie er. »Ich knalle nicht nur euch, sondern auch die ganze verdammte Farmerfamilie ab! Meine Jungs warten bloß noch auf ein Zeichen von mir!«
Lassiter warf einen Seitenblick auf Brewster. »Was die Frage beantwortet, ob der Hundesohn weitere Unterstützung hat.«
»Überstürzen Sie jetzt bloß nichts, Lassiter!«, entfuhr es dem Marshal. »Ich will die Familie retten und kein Risiko eingehen, dass einer von ihnen draufgeht!«
»Da sind wir ja einer Meinung!«, versetzte der Brigade-Agent. »Das Problem ist nur, dass Connelly nicht nach unseren Regeln spielt.« Ein harter Zug umspielte Lassiters Mundwinkel. »Ich ziehe ihn aus dem Verkehr!«
Immer noch stand Connelly in der Tür, hatte den Gewehrkolben in die Schulter gepresst und ließ den Lauf der Waffe wandern. »Ihr zwei könnt mich nicht kriegen!«, verkündete er lauthals. »Sobald ihr mich angreift, sind die Frau und die Kinder tot!«
Lassiter huschte hinüber zu einem Karren und legte mit seinem Remington auf Connelly an.
»Sind Sie verrückt geworden?«, zischte Marshal Brewster. »Sie haben doch gehört, was der Bastard gerade gesagt hat!«
Abfällig schüttelte Lassiter seinen Kopf. »Wenn der Anführer tot ist, machen sich seine Schoßhündchen in die Hose. Ich habe das tausend Mal erlebt.« Kaum war die letzte Silbe verklungen, feuerte Lassiter zweimal kurz hintereinander. Die beiden Kugeln hackten in Connellys Oberkörper, ließen ihn wanken und erstickt aufschreien. Die Rifle entfiel seinen Händen, und gleich darauf krachte sein schwerer Körper auf die Dielen der Veranda.
»Rupert?«, folgte ein Schrei aus dem Haus. »Was ist passiert? Hast du einen der Schleimscheißer erledigt?«
»Er hat Blei gefressen!«, rief Lassiter. »Und das werdet ihr auch, wenn ihr euch nicht auf der Stelle ergebt!«
Marshal Brewster schoss vor und suchte neben Lassiter Deckung. »Was stimmt denn nicht mit Ihnen?«, presste er ärgerlich hervor. »Das Pack wird die ganze Familie hinrichten, ohne dass wir irgendwas dagegen tun könnten!«
»Das Pack«, wiederholte Lassiter, »hat mehr Angst als Vaterlandsliebe. Und sobald sie die Geiseln gegen uns einsetzen, haben sie bereits ihr Todesurteil unterschrieben!«
Brewster zuckte zurück. »Ich bin kein Mörder!«, stieß er aus. »Ich will die Kerle in Gewahrsam nehmen und der Justiz überstellen.«
Kalt blickte Lassiter den Mann mit dem Stern an. »Sie wollen die Familie retten«, hielt er ihm vor. »Das waren Ihre Worte, Marshal. Leider wird das nicht funktionieren, wenn Sie die Kriminellen verschonen!«
Ehe sich die Diskussion ausweiten konnte, erschien einer der Gangster an der Vordertür. Er hielt ein kleines Mädchen im Würgegriff und hatte den Lauf seiner Waffe auf den Kopf des Kindes gerichtet. »Ihr tut jetzt alle genau das, was ich euch sage!«, keifte er. »Werft eure Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen aus eurem Versteck! Ich spaße nicht! Bei drei seid ihr hier, sonst stirbt das Goldlöckchen!«
»Und jetzt?«, zischte Brewster verärgert. »Die werden uns fertigmachen, sobald wir mit heruntergelassenen Hosen vor ihnen stehen!«
Lassiter machte eine abwehrende Handbewegung und signalisierte dem Marshal, sich zurückzuhalten. Dann trat er hinter dem Karren hervor, hielt seinen Remington aber immer noch vorausgerichtet.
»Du dämliches Arschloch!«, kreischte der Geiselnehmer. »Willst du, dass das Kind stirbt? Schmeiß deine verdammte Kanone weg und reck die Hände zum Himmel!«
Lassiter schleuderte weder seine Waffe davon, noch verhielt er im Schritt. Unaufhaltsam näherte er sich der Farm.
»Ich mache ernst! Wäre nicht das erste Gör, das ich abgeknallt habe!« Der Kerl presste den Lauf seines Revolvers gegen die Schläfe des Mädchens, das zu schluchzen begann und nach seiner Mutter rief.
Mit einem Mal blieb Lassiter stehen. Nur noch etwa zehn Yards trennten ihn von dem Verbrecher. »Typen wie du sind ein Geschwür in unserer Gesellschaft«, raunte der Mann der Brigade Sieben düster. »Ich bin einer von denen, die Geschwüre rückstandslos ausbrennen...« Mit höchster Präzision ruckte der Remington in seiner Faust nur wenige Zentimeter in die Höhe. Noch in der Bewegung drückte Lassiter ab und stanzte seinem Gegner ein Loch in die Stirn. Der verdrehte noch kurz die Augen und machte für ein, zwei Sekunden den Anschein, als befände sich noch ein Hauch von Leben in seinem Körper. Schließlich versteifte er sich und polterte rücklings auf die Dielen im Flur.
»Einer noch«, sagte Lassiter und winkte den Marshal heran. »Den holen wir uns auch noch.«
Doch es kam anders.
Plötzlich ertönte ein Schuss, dann noch einer sowie der kreischende Aufschrei einer Frau und gleich im Anschluss ein ersterbendes Stöhnen.
Mit gezogenem Revolver rannte Lassiter los, pfiff auf jede Vorsicht und stürmte in die Wohnküche, um seinen letzten Widersacher gnadenlos niederzuschießen. Was er sah, ließ ihn jedoch innehalten.
Zwei Männer lagen am Boden. Der eine schien von einer Kugel getroffen worden zu sein, der andere hatte ein Messer im Unterleib stecken und eine klaffende Schnittwunde von der Brust abwärts. Seitlich von den Toten kniete eine junge Frau, hinter der ein kleiner Junge mit kalkweißem Gesicht stand und aus ungläubig geweiteten Augen auf die Szenerie starrte.
»Er... er hat meinen Mann erschossen, als er seinen Kumpan sterben sah«, gab die Frau mit stockender Stimme von sich und presste ihre Linke auf eine blutende Wunde an der Hüfte.
Der Marshal trat hinter Lassiter ins Haus und hatte das weinende Mädchen an sich genommen. Es vergrub sein Gesicht in Brewsters Schulter und klammerte sich krampfhaft an ihn. »Es hätte nicht auf diese Weise enden müssen«, knurrte der Sternträger und warf Lassiter einen vorwurfsvollen Blick zu. »Hätte ich gewusst, dass Sie alles wegschießen, was Ihnen vor die Flinte kommt, hätte ich Ihre Hilfe erst gar nicht angenommen.«
»Nein, das hätten Sie nicht«, bestätigte Lassiter. »Und vermutlich gäbe es jetzt eine tote Farmerfamilie und einen zum Krüppel geschossenen Marshal.«
Brewster gab darauf keine Antwort, streichelte dem Mädchen über den Rücken und flüsterte ihm beruhigende Worte zu. Dann setzte er das Kind ab und überließ es seiner Mutter. Einmal noch aber wandte er sich an Lassiter. »Sie können die Prämie für Connelly kassieren«, sagte er. »Für seine beiden Begleiter gibt es nach meinem Dafürhalten kein Kopfgeld. Begleiten Sie mich in mein Office, und ich zahle Sie aus.«
»Ich bin kein Headhunter«, erwiderte Lassiter. »Wenn Sie zu viele Dollars in der Kasse haben, geben Sie sie den Armen und Bedürftigen. Außerdem muss ich rasch weiter. In Forbush erwartet mich ein Notar mit Dokumenten.« Zum Gruß tippte er kurz mit zwei Fingern an die Krempe seines Stetsons und verließ das Farmgebäude. Wenige Minuten darauf saß er im Sattel seines Grauschimmels und preschte davon.
✰
Der Kratzer, den Waxfords Kugel ihm zugefügt hatte, war vom hiesigen Doc noch in derselben Nacht behandelt worden. Nun graute der Morgen des nächsten Tages, und Earl Fenton konnte immer noch nicht fassen, was geschehen war.
Er schwang sich auf seiner unbequemen Pritsche in die Höhe und stierte auf die Gitterstäbe, die seine Zelle begrenzten. Völlig unschuldig war er in diese Lage geraten. Er hatte lediglich sein Leben verteidigt und dabei einen Angreifer getötet. Aber offenbar zählte die Wahrheit nichts in Twin Oaks, denn seine Version der Geschichte hatte auch der Sheriff nicht hören wollen.
Fenton stand auf, ging zur Zellentür und umklammerte die Eisenstäbe. Mit einem Mal zerrte er daran, als könnte er sie mit bloßer Körperkraft aufbrechen. Das Schloss rasselte laut, wollte aber nicht aufspringen. Stattdessen wurde Sheriff Warren Green von dem Gepolter angelockt und schnauzte lautstark: »Lassen Sie den Unsinn bleiben, Fenton! Sie haben mir schon genug Ärger bereitet, da will ich wenigstens im Office meine Ruhe haben!«
»Aber ich bin kein Mörder!«, versuchte sich Earl Fenton zu verteidigen. »Es waren doch genügend Leute anwesend, die bezeugen können, dass ich nicht zuerst geschossen habe!«