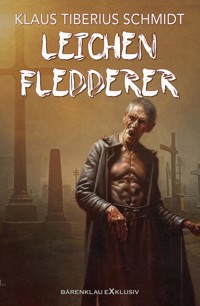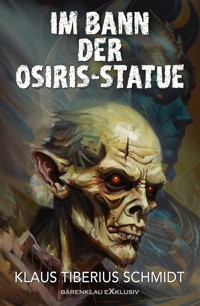3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Bergromane von Wem der Berg zürnt (Glenn Stirling) Denk nicht mehr an die Schatten (Glenn Stirling) Gegen den Willen der Väter (Klaus Tiberius Schmidt) Wenn jemand zu Erika Dammeier gesagt hätte, sie würde einmal allen Grund haben, auf eine andere Frau eifersüchtig zu sein und an Trennung von ihrem Ferdl zu denken, hätte sie nur gelacht. Aber dann wurde die Fernsehschauspielerin Sonja Bergheim ins Krankenhaus von Sankt Hildegard eingeliefert ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Glenn Stirling, Klaus Tiberius Schmidt
Inhaltsverzeichnis
Liebe im Schatten der Berggipfel: 3 gefühlvolle Heimatromane
Copyright
Wem der Berg zürnt
Denk nicht mehr an die Schatten
Gegen den Willen der Väter
Liebe im Schatten der Berggipfel: 3 gefühlvolle Heimatromane
Glenn Stirling, Klaus Tiberius Schmidt
Dieser Band enthält folgende
Bergromane von
Wem der Berg zürnt (Glenn Stirling)
Denk nicht mehr an die Schatten (Glenn Stirling)
Gegen den Willen der Väter (Klaus Tiberius Schmidt)
Wenn jemand zu Erika Dammeier gesagt hätte, sie würde einmal allen Grund haben, auf eine andere Frau eifersüchtig zu sein und an Trennung von ihrem Ferdl zu denken, hätte sie nur gelacht. Aber dann wurde die Fernsehschauspielerin Sonja Bergheim ins Krankenhaus von Sankt Hildegard eingeliefert ...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Wem der Berg zürnt
von Glenn Stirling
Der Umfang dieses Buchs entspricht 115 Taschenbuchseiten.
Verträumt liegt das Rudeggertal in den Alpen. Obwohl am Talende ein Stausee und ein Kraftwerk entstehen, scheint es oft so, als sei die Zeit hier stehen geblieben. Doch wie überall, ist auch das Leben der Leute im Rudeggertal stets voller Probleme, und einer hat mit allem zu tun, mit Freundschaften und Feindschaften, Glück und Leid:
Dr. Dammeier, der als Arzt ursprünglich die Arbeiter der Kraftwerkbaustelle betreuen sollte, doch nun auch für die übrigen Bewohner des Tals zur Verfügung steht. Er stammt aus St. Hildegard, das in diesem Tal liegt, und alle nennen ihn da den Ferdl-Doktor.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
© dieser Ausgabe 2017 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Prolog
Es war ein strahlend schöner Sonntagmorgen. Blauer Himmel wölbte sich über dem Rudeggertal. Die Vögel zwitscherten in den blühenden Obstbäumen, Insekten summten um die Blüten, und aus der Kirche St. Hildegard drang leises Orgelspiel bis hinaus auf den sonnenüberfluteten Platz und vermischte sich mit dem gelegentlichen Glockengeläut der Kühe auf den Hofweiden.
Aus der Küche des Wirtshauses erscholl das Geklapper und Geschepper von Geschirr, ertönte ab und zu die schrille Stimme der Wirtsfrau, die ihrem Personal Anweisungen erteilte, denn in knapp zwei Stunden musste das Mittagsmahl gerichtet sein. Viele Gäste würden heute am Sonntag kommen. Selbst von Innsbruck kamen sie neuerdings hier herein ins Rudeggertal, um die herrliche Natur zu genießen.
Aber manche von ihnen kamen mit Ach und Krach nur bis zu Dagobert Hofers Wirtshaus und blieben dann bei diesem herrlichen Essen, das so viel billiger war als in der Stadt und so viel besser. Vor allen Dingen, wenn der Dagi seinen Sonntagswein aus dem Keller heranschaffte. Das ließ so manchen den Spaziergang vergessen. Und draußen im Biergarten zu sitzen, war auch ein herrliches Erlebnis für sich.
1
Roswitha war das letzte Stück des Weges zu Fuß gegangen, hatte ihren Wagen vorn am Dorfeingang stehen lassen und erreichte nun den Marktplatz.
Sie stand im Schatten und lauschte dem Gesang der Gemeinde, der jetzt, begleitet vom Orgelspiel, aus der Kirche herausdrang, und dieses Bild des Sonntagsfriedens, der über St. Hildegard lag, nur unterstrich. Drüben an der Kirche scharrten ein paar Hühner, weiter links marschierte eine Ente, gefolgt von sechs Jungen, auf den Dorfweiher zu.
Die junge und sehr hübsche Dunkelhaarige in heller Bluse und dunklem Faltenrock blickte durch die Gassen hinüber zu den noch immer schneebedeckten Bergriesen, die das Tal säumten.
Sie kannte die Namen alle. Drüben im Nordwesten der Glemmer, ein Dreitausender wie sein Nachbar zur Linken, der Pilzkogel, und ein Stück weiter, nicht ganz so hoch, die Kalkspitz Alpe. Darüber wölbte sich die Kuppel des azurblauen Himmels, nur weiter im Norden durch die hauchdünnen Schleier zweier Föhnwolken unterbrochen.
Nach zwölf Jahren der Abwesenheit war. Roswitha Lienzer wiedergekommen, zurück in das Tal, zurück in die Heimat.
Und sie war überzeugt davon, dass sie das Tal nie mehr verlassen würde. Ebenso überzeugt wie von ihrem nahen Tod.
Jetzt, wo sie an das scheinbar Unabänderliche dachte, spürte sie auch das Herzklopfen wieder, empfand diese schwäche, die in der letzten Zeit immer häufiger gekommen war und entsann sich der Worte ihres New Yorker Arztes, die sie wie ein Todesurteil empfand.
Ich bin daheim, dachte sie. Aber bin ich es wirklich? Die Eltern leben nicht mehr. Nur die Tante ist noch da, die beim Pfarrer als Haushälterin arbeitet. Eigentlich war sie sogar ihre Großtante.
Und dann wäre noch Tante Johanna gewesen, die Roswitha eigentlich auch sehr mochte. Nur hatte die einen reichen Bauern zum Mann, und den hatte Roswitha schon als Kind nie leiden können, diesen herrschsüchtigen, cholerischen Anton Kemmelmeier, der alle, die schwächer waren als er, seine Macht spüren ließ.
Am meisten aber freute sich Roswitha auf das Wiedersehen mit einem Menschen, dem sie damals vor einem Dutzend Jahren anlässlich des Begräbnisses ihrer Mutter nähergekommen war, obgleich sie ihn schon als Kind gekannt hatte.
Sie mochte es sich selbst kaum zugeben. Aber im Grunde war die Rückkehr hierher nur seinetwegen geschehen. Sie wusste nicht einmal, ob er noch hier lebte. Aber sie hoffte es.
Sie hoffte es so sehr, wie sie das Gesicht von Timo nie vergessen hatte. Ein Dutzend Jahre lang nicht.
Langsam überquerte sie den sonnenüberfluteten Platz und ging direkt auf das Pfarrhaus zu. Sie war sicher, dass Tante Sopherl nicht am Gottesdienst teilnahm. Sie hatte bestimmt, wie früher schon, die Frühmesse besucht und bereitete jetzt das Mittagsmahl für den Pfarrer vor, denn sie war ja seine Haushälterin.
Der Geruch von duftendem Braten drang Roswitha in die Nase. Sie brauchte nur diesem Geruch zu folgen. Unverwechselbar. Sie kannte keine bessere Köchin als Tante Sopherl. In Amerika hatte sie so manches Mal von den herrlichen Gerichten Tante Sopherls geträumt.
Und dann hörte sie das Geklapper aus der Küche. Die Fenster standen offen. Und sie beschloss, nicht an der Tür zu schellen, sondern um das Haus herumzugehen zum offenen Fenster der Küche hin, in die man hineinschauen konnte.
Aus einem Blumenkasten im Küchenfenster grünten Gewürze. Es hatte sich auch da nichts geändert. Und sie hörte das Summen einer Frauenstimme. Sie summte die Choräle, die von der Kirche herüberschallten, mit.
Und dann stand Roswitha am Fenster, schaute zwischen den grünenden Gewürzen hindurch in die Küche hinein und sah Tante Sopherl. Sie war ein wenig runzliger, ein wenig grauer geworden, und doch schien auch sie sich kaum verändert zu haben. Im Augenblick schnitt sie etwas auf einem Brett. Hurtig, wie früher schon, bewegten sich ihre Hände.
„Tante Sopherl“, sagte Roswitha mit gedämpfter Stimme.
Die alte Frau hielt sofort in der Bewegung inne und lauschte, ohne zum Fenster zu blicken. Dann aber richtete sie sich ein wenig auf, schaute zu Roswitha herüber und erkannte sie sofort, obgleich doch so viele Jahre dazwischen lagen. Damals war Roswitha neunzehn gewesen, hatte noch ihr langes Haar gehabt, dass sie meist zu Zöpfen flocht.
„Ja, da schau her!“, rief Tante Sopherl und legte das Messer beiseite, wischte sich die Hände an der Schürze ab. „Roswitha!“, rief sie. „Gell, du bist’s?“
„Ja, Tante Sopherl, ich bin’s.“
„Ja, sag Madel, wo kommst her? Ist das eine Freud!“
Da war Tante Sopherl schon am Fenster. Sie strahlte vor Freude, und so trübe die Gedanken von Roswitha bis vorhin noch gewesen waren, jetzt konnte sie gar nicht anders. Sie freute sich ebenfalls, die geliebte Tante wiederzusehen.
„Dass du den Weg zu uns findst, das hätte ich nie nimmer gedacht. Bist allein hier?“
Roswitha nickte. „Ja, Tant, allein. Ich möcht auch keine Umständ nicht machen. Nur Grüß Gott wollte ich dir sagen.“
„Ja, Grüß Gott, mein Kind. Nun komm herein. Was stehst da draußen? Gut schaugst aus, Madel. Dass ich dich noch einmal seh? Da wird er Augen machen, unser Herr Pfarrer, wenn er dich sieht. Wart nur, bald schon ist die Messe vorbei. Aber dann geht er meist noch ins Wirtshaus. Aber wenn Mittagszeit ist, dann kommt er dann. Nur gut, dass ich mehr gemacht hab heut. Für dich reicht’s mit.“
„O Tant, ich ess nicht viel.“
„Magst net, oder kannst net?“, fragte das Sopherl.
„Ich mag net.“
„Ein Braten vom Rosenspitz ist’s. Da wirst schlecken. Hochwürden red allweil am Samstag von nix anderm.“
„Wie schaut er denn jetzt aus, der Herr Pfarrer?“, erkundigte sich Roswitha.
Sopherl lachte. „Allweil dicker ist er worden. Es schmeckt ihm halt so gut. Aber es gibt schon Tag, da steigt er auf die Berg, und da macht ihm kein Junger was vor. Höchstens der Ferdl-Doktor.“
„Der Ferdl-Doktor? Wer ist das?“
„Ja, weißt nicht, Madel, dass die Talsperre oben, wo Mühlauer gewesen ist, gebaut wird?“
„Mühlauer ist nimmer?“, fragte Roswitha.
Das Sopherl schüttelte seinen grauen Kopf. „Nein. Eine Talsperre haben sie baut. Noch net fertig ist’s. Aber nächstes Jahr wird’s fertig sein. Fürs Elektrische ist das, weißt. Und eine Menge Leut schaffen da droben. Fremde eben. Auch Welsche sind dabei. Nur der Ferdl-Doktor, den musst doch kennen, den Dammeier. Erinnerst dich net?“
„Der Bub von den Wagners Leuten?“
Sopherl nickte. „Ja, vom Wagner der Bub. Doktor ist er. Der ist damals schon früh weg. Ein studierter Bub ist das. Ein guter Doktor. Ein Glück für das Tal, daß er jetzt hier ist. Eigentlich ist er ja nur für die Bauleut kommen. Aber nun hat er zusammen mit dem Bürgermeister durchgesetzt, dass die Krankenstation auch für die Leut vom Tal is. Weißt, hier hat’s nie einen richtigen Doktor gehabt. Viele von die Leut sind zur Tränkl-Jule gegangen. Die kennst doch noch?“
„O ja, Tant. Die Tränkl-Jule kenn ich. Ist die auch noch am Leben?“
„Natürlich. Und weißt, es ist eine Hetz. Aber der Ferdl-Doktor und die Tränkl-Jule, die streiten gar net. Nur der andere Doktor, der Fellau. Weißt, das ist ein Chirurg, für die Unfälle ist er eben da. Aber der mag die Tränkl-Jule net. Ein Kräuterweibel ist's, hat er gesagt. Na ja, und es ist ja auch richtig. Aber sie weiß viel von den Kräutern, weißt. Sogar Hochwürden sagt, dass sie ein Gspür für die Kräuter hat. Sie helfen net allweil, aber bei mancher Sach schwör ich auf die Tränkl-Jule, auch wenn Hochwürden sagt, dass viel Larifari dabei ist.“
„Und Aberglauben“, meinte Roswitha lachend.
„Das darfst net so laut sagen. Wenn die Tränkl-Jule das hört, wird sie fuchtig.“
Roswitha wollte etwas sagen, aber da entdeckte Sopherl, dass der Braten gedreht werden musste. „O je“, rief sie, „jetzt muss ich gschwind den Braten wenden. Wennst willst, Madel, mach mir den Salat zurecht. Das wirst doch können?“
„Freilich kann ich das, Tant.“
Und Roswitha kam sich die nächsten zwanzig Minuten vor wie früher, wenn sie als Kind oder als junges Mädchen zur Tante gekommen war. Die hatte sie jedes Mal eingespannt zum Helfen in der Küche oder zum Obstpflücken. Aber es hatte immer Spaß gemacht. Eigentlich mehr Spaß als daheim. Der Vater war lange krank gewesen. Nach seinem Tod hatte auch die Mutter lange leiden müssen, bis sie erlöst worden war. Mit Hilfe eines Stipendiums hatte Roswitha erst ein Internat und später ein Konservatorium besuchen können.
Die Tante stellte Fragen, wollte wissen, was denn Roswitha all die Jahre getrieben hatte. Offenbar kamen die Nachrichten aus der weiten Welt nur sehr spärlich ins Rudeggertal, sonst hätte die Tante wissen müssen, dass aus dem kleinen Mädchen aus dem Kirchenchor draußen in dieser fernen Welt eine berühmte Sopranistin geworden war, die zuletzt sogar in der berühmten Met, der Metropolitan Opera in New York, gesungen hatte ... bis zum totalen Zusammenbruch vor vier Monaten.
Seitdem war Roswitha nicht mehr aufgetreten.
Aber daran dachte sie jetzt nicht. Ihre Gedanken konzentrierten sich auf Timo. Sie wusste nur nicht, wie sie nach ihm fragen sollte. Die Tante, daran erinnerte sie sich gut, konnte sehr hellhörig sein und reimte sich zwei und zwei zusammen.
Aber schließlich fasste sich Roswitha ein Herz und fragte: „Was ist aus dem Timo geworden?“
„Welchen Timo meinst?“, fragte das Sopherl. „Den Knecht vom Wallbergbauer?“
„Nein, den nicht.“
„Ach, den Verwalter vom Grafen meinst, den Veith Timo.“
„Genau den, Tant.“ Roswitha blickte die Tante gespannt an. Aber die würzte erst einmal die Soße, kostete, und als sie zufrieden den Löffel beiseite legte und sich der Vorbereitung zum Dessert zuwandte, da sagte sie:
„Ja, der Veith. Er ist immer noch beim Grafen. Wanns das Heu auf der Schwerdtner Alp machen, dann wird er wieder hier sein. Aber sonst ist er drunt im Innsbruckschen, da hat der Graf sein großes Gut. Das weißt du doch.“
„Ja, ich weiß. Kommt er nimmer herauf? Nur zur Heumahd?“
„Gewiss, zur Heumahd, da kommt er ins Tal. Aber sonst ist er drunt auf dem Gut. Den Graf kümmerts Gut nimmer. Das macht der Veith jetzt. Inspektor heißen sie ihn. Aber er ist nicht anders worden all die Zeit. Er ist noch immer so, wie er früher war.“
Eine ganz bestimmte Frage bedrängte Roswitha schon die ganze Zeit. Aber nun hatte sie doch Furcht, sie zu stellen. Denn da würde die Tante ganz sicher ahnen, warum Roswitha das wissen wollte. So zögerte sie und überlegte, wie sie es anstellen konnte, ganz unverfänglich danach zu fragen, ob der Timo verheiratet war oder nicht.
Ich sollte es nicht fragen, dachte sie. Bestimmt ist er verheiratet. Er ist damals ja schon ein Mann gewesen, wo die meisten eine Frau nehmen. Ende dreißig müsste er sein, der Timo. Ja richtig, zehn Jahre ist er älter als ich. Bestimmt hat er eine Frau. Vielleicht auch Kinder. Ich sollte wirklich nicht fragen. Aber dann kam ihr die Tante unbewusst zu Hilfe, indem sie sagte:
„Ein feiner Herr ist er worden, der Inspektor. Als sie abtrieben haben von den Almen im letzten Jahr, da ist er hier gewesen. Mastvieh hat er kauft. Der Ferdl-Doktor ist auch da gwesen. Und beim Dagi drüben haben die beiden und Hochwürden die ganze Nacht geredt. Und natürlich getrunken, bis in den Morgen. Hochwürden ist vom Dagi direkt zur Messe gangen. Und die beiden haben beim Dagi im Stadl gelegen und ihren Rausch ausgeschlafen. So ist’s, wenns keine Frau haben. Da könnens das machen. Ich, wenn ich ein Mannsbild hätt, das die ganze Nacht wie die drei redt und säuft, ich würd ihn schon heimholen und ihm was derzählen. Z’wegen die ganze Flasche nach der anderen vom Kälterer trinken, bis der Dagi keinen Tropfen mehr davon hat.“
Also ist er nicht verheiratet, dachte Roswitha erleichtert. Doch gleichzeitig sagte sie sich, dass es im Grunde ja gar keine Bedeutung hat. Für sie war doch sowieso alles vorbei.
„Hat er keine Frau?“
Sopherl schüttelte den Kopf. „Nein. Wird wohl die Richtige net gfunden haben. Jesses, jetzt läuts schon auf Mittag. Hochwürden wird gleich kommen. Madel, schaug, dass die Teller eini trägst.“
„Mach ich, Tant“, sagte Roswitha und blickte zum Fenster hinaus. Da sah sie einen breitschultrigen, aber doch schlanken Mann vorbeikommen. Sein Gesicht erinnerte sie sofort daran, wer er war, obgleich er die Jahre ebenfalls älter geworden war. Zwölf Jahre älter ...
Da war er schon vorbei, und Roswitha sagte: „Der Wagner Bub, ich meine, der Dammeier-Ferdl ist eben vorbeigangen.“
„Zu seine Leut wird er gehn. Alt sinds worden, die beiden. Nach der Messe schaut er immer nach ihnen, und sein Mutter kocht für ihn mit. Für die alten Leut ist es immer eine Freude, wenn der Bub bei ihnen ist.“
„Gut sieht er aus. Es ist lang her, dass ich ihn gesehn hab. Damals ist er noch ein Student gwesen“, erinnerte sich Roswitha.
„Und nun ist er der beste Doktor, der wo jemals im Tal gelebt hat“, stellte das Sopherl fest und fischte die Klöße aus dem großen Topf, um sie in die Schüssel zu tun.
„Wann wird denn in diesem Jahr Heumahd sein?“, erkundigte sich Roswitha.
„Unten am Bach“, sagte Sopherl, ohne in ihrer Tätigkeit innezuhalten, „habens schon die letzt Woch mit der Mahd angefangt. Aber droben auf den Almen und an der Schwerdtner Alp wirds gewiss noch gut zehn Tag dauern.“
Zehn Tage also, dachte Roswitha, bis ich den Timo wiedersehe. Hoffentlich halte ich durch …
2
„Das Schlimmste“, sagte Dr. Jürgen Fellau, „sind die Wochenenden, wenn hier auf der Baustelle alles wie tot ist und man herumlungert, als wenn man die Zeit im Lotto gewonnen hätte.“
Bernhard Kreuzbechner, der dem blonden zweiunddreißigjährigen Arzt zuhörte, grinste über sein breites Gesicht. Die ohnehin schmalen Augen waren nur mehr Striche. „Ja, was glaubst, Herr Doktor“, sagte Kreuzbechner, „auf Pfingsten, also nächste Woch, sollst sehn, wies Volk aus der Stadt umeinand rennt. In jede Schlucht kraxelns eini. Und nauf auf die Berg müssens auch. Und kein End findens net. Und plötzlich, wenns dunkel is, stehns droben und wissen net, wies abikommen sollen. Dann schreins nach der Bergwacht. Und unsereins muss aufi. Aufn Sonntag. Verstehst, Herr Doktor. Und deswegen hat der Ferdl-Doktor das mit'm Notdienst eingericht.“
„Ach was“, meinte Fellau, und sah den untersetzten, vierschrötigen Kreuzbechner missmutig an. Er wusste ja, dass der Zweiundvierzigjährige zur Bergwacht gehörte und schon manchen Bergsteiger, vor allen Dingen aber Touristen, aus dem Berg geholt hatte, wenn sie nicht mehr herunterkamen oder sich verletzt hatten. Und natürlich sah er ein, dass der Notdienst am Wochenende sein musste, wenn die Touristen kamen. Aber heute waren, soviel er wusste, gar keine Touristen gekommen.
„Hast du denn überhaupt Touristen gesehen, Kreuzbechner? Ist überhaupt jemand nach St. Hildegard gekommen?“
„Touristen vielleicht net“, sagte Kreuzbechner, der sich immer sehr bemühen musste, Hochdeutsch zu sprechen, so gut er das konnte, wenn er mit Dr. Fellau sprach, der ja aus dem Rheinland stammte. „Aber jemand ist doch gekommen.“
„Jemand? Wer denn?“, fragte Fellau, der sich so sehr langweilte, dass er schon froh war, den Kreuzbechner zur Gesellschaft zu haben.
„Als ich von der Messe kommen bin, hab ich sie gesehn, die Roswitha, die Lienzer Roswitha.“
Fellau hatte nur mit einem Ohr hingehört, verstand aber plötzlich, was Kreuzbechner gesagt hatte und sah ihn verwundert an. „Lienzer Roswitha? Sie wollen doch nicht etwa sagen, Roswitha Lienzer, die Sängerin?“
„Ja mei, eine Sängerin ist sie auch? Sie hat allweil gesungen. Früher im Kirchenchor. Und dann hat ihr reicher Onkel aus Innsbruck das Geld für das Internat gegeben. Und im Internat hat sie so schön gsungen, dass sie das Stipendium bekommen hat. Und danach ist sie auf einem Konservatorium gewesen. Ein blitzgescheites Madel ist sie, die Roswitha. Und ich hab sie gsehn.“
„Moment mal“, sagte Fellau und hob beschwörend die Hände. „Sie wollen doch nicht sagen, dass die berühmte Roswitha Lienzer hier aus dem Ort stammt?“
„Freilich will ich das sagen“, beteuerte der Kreuzbechner. „Die Eltern sind schon lang tot. Aber deswegen ist sie doch von hier.“
„Ich kann nicht glauben, dass wir von derselben Frau sprechen. Roswitha Lienzer hat an der Hamburger Staatsoper gesungen. Sie ist in Wien gewesen, und zuletzt war sie an der Metropolitan Opera in New York. Ich habe Platten von ihr.“
„Kann schon sein“, meinte der Kreuzbechner. „Aber sie ist es. Ich habe auch gehört, dass sie in Amerika drüben ist. Aber nun ist sie wieder heimkommen. Heim nach St. Hildegard.“
„Ich werde verrückt“, meinte Fellau. „Roswitha Lienzer stammt aus St. Hildegard. Das darf doch nicht wahr sein. Leute gibt’s hier! Der Dammeier ist von hier, und nun noch als Krönung Roswitha Lienzer. Haben Sie die schon mal singen hören, Kreuzbechner?“
„Ja freili. Lang ist’s her. Da ist sie noch ein junges Madel gewesen. Da hab ich sie singen hören. Schön hat’s gesunge.“
„Ich meine in einer Oper? Oder in einem Konzert?“
Der Kreuzbechner schüttelte traurig den Kopf. „Das ist für feine Leut. Dafür hab ich kein Geld net.“
„Aber im Radio. Man hat sie auch im Radio hören können.“
„Ja mei! Wissens, Herr Doktor, solche Musik ... die versteh ich net. Schlager, die mag ich schon. Oder ein Lied von hier. Das mag ich auch. Na ja, und sonntags in der Kirchen. Das hab ich schon als Kind glernt. Aber so feine Musik, so von Schubert, Beethoven und wie die alle heißen. Nein, Doktor, davon versteh ich nix.“
„Also, ich würde etwas dafür geben, dieser Frau zu begegnen. Solchen Leuten gehört ein Denkmal gesetzt. Das sind Genies. Die machen den Menschen Freude. Aber die bekommen nie ein Denkmal. Eher setzt man irgendeinem General oder einem Politiker ein Denkmal, denen die Menschheit meistens nur Blut und Tränen verdankt. Aber wer den Menschen Freude schenkt, den vergessen die Leute schon, wenn er erst ein paar Monate tot ist. Ich würde wirklich etwas dafür geben, sie singen zu hören.“
Hätte der Kreuzbechner nicht gewusst, dass Dr. Jürgen Fellau ein hervorragender Chirurg war und wirklich kein Spinner, so hätte er jetzt gedacht, dass der Doktor verrückte Einfälle hat. Aber so sah er den Arzt nur zweifelnd an und schwieg.
„Erzähl doch mal mehr von ihr! Du weißt das doch. Du bist doch von hier.“
„Ja scho. Aber da gibt’s net viel zu verzähln. Sie war ein Kind gwesn, da ist sie schon nach Innsbruck ins Internat. Und nachher, als sie wiederkommen is, da war’s auch net lang, da ist sie fort zum Konservatorium. Zuletzt hab ich sie gsehn, als die Mutter gestorben ist. Da ist die Roswitha kommen, war beim Begräbnis. Da ist sie erst kurze Zeit beim Konservatorium gewesen. Sie ist dann wieder weg, nach Wien. Und dann hab ich sie nie nimmer in St. Hildegard gesehn, bis heut. Fast hätte ich sie net erkannt. Ein schmuckes Madel ist’s, die Roswitha. Die tat dir auch gefallen, Doktor.“
„Mir geht es doch nicht um solche Dinge. Sie hat eine göttliche, eine begnadete Stimme, Kreuzbechner.“
Der Kreuzbechner konnte nicht begreifen, wie einem gestandenen Mannsbild, wie der Dr. Fellau eins war, die Stimme einer Frau wichtiger sein konnte als ihr Äußeres. Aber der Doktor war ein studierter Mann, der musste es ja wissen.
Sie saßen beide vor der Krankenstation. Fellau hatte beide Füße auf das Geländer der kleinen Holzveranda gelegt und blickte jetzt über seine Fußspitzen hinweg auf die noch immer schneebedeckten Berge, beobachtete den Flug eines Greifvogels, doch seine Gedanken kreisten immer wieder um die Musik und den Gesang von Roswitha Lienzer.
Schade, dachte er, dass ich die Platte nicht hier habe. Ich würde sofort eine spielen. Dann könnte der Kreuzbechner einmal hören, was richtiger Gesang ist. Eine Schande, dass die Leute hier so etwas gar nicht kennen.
„Da schau“, sagte der Kreuzbechner und deutete talwärts an der Baustelle vorbei, wo die Zufahrt zum Barackenlager heraufführte.
Dr. Fellau blickte in diese Richtung und entdeckte ebenfalls die Staubwolke. Ein Auto kam herauf.
„Wird der Ferdl-Doktor sein“, meinte Kreuzbechner.
3
Hochwürden war das, was man allgemein als ein gestandenes Mannsbild bezeichnet. Eine Persönlichkeit zumal, die sich nicht nur darin verstand, die Messen zu lesen und Predigten zu halten. Er sah sich als Christ der Tat und fühlte sich nicht nur mit dem Land hier, sondern ganz besonders mit den Menschen im Tal verbunden. Er war einer der ihren, auch wenn er im Grunde gar nicht aus dem Rudeggertal stammte, aber niemand hätte ihm sich hier noch wegdenken können.
Groß und wuchtig saß der zweiundfünfzigjährige Pfarrer am Tisch, und in seinem Gesicht war vorhin schon bei der Begrüßung Roswithas die Sonne aufgegangen. Unter seinen buschigen blonden Augenbrauen leuchtete ein blaues Augenpaar, und mit Wohlgefallen schaute er Roswitha an.
Vorhin hatte sie ihn gebeten, doch wieder du zu sagen wie früher. Aber das wollte er nicht. Im Gegensatz zu den meisten hier im Tal wusste er, dass sie eine Berühmtheit geworden war, und er fand es wohl nicht richtig, sie einfach zu duzen.
Ganz unbewusst mühte er sich auch, Hochdeutsch zu sprechen, obgleich ihm doch klar war, dass Roswitha aus diesem Tale stammte.
Sie hatten diese meisterlich zubereitete Mahlzeit hinter sich, nur noch ein Schluck vom herrlichen Rotspon befand sich im Glas des Pfarrers. Und nun schmauchte er seine Pfeife. Der Tabakrauch kräuselte sich zur Decke. Hochwürden hatte sich zufrieden zurückgelehnt, die Welt um ihn herum war heil, und er freute sich darüber.
Sopherl, die Haushälterin werkelte schon wieder in der Küche draußen und hatte es sich nicht nehmen lassen, die beiden miteinander allein zu lassen, weil sie sich doch, wie sie meinte, gar so viel zu erzählen hätten.
Sehr bescheiden war in der bisherigen Unterhaltung von Roswithas Lebensweg die Rede gewesen. Allzu viel jedoch hatte sie nicht erzählt, schon gar nicht von dem Zusammenbruch vor vier Monaten und der Zeit danach. Darüber schwieg sie. Auch der Grund ihres Hierseins war noch nicht zur Sprache gebracht Worden.
Aber Kernmoser wollte es gern wissen. Es interessierte ihn, ob Roswitha länger bleiben wollte. Und außerdem hatte ihm Sopherl vorhin etwas vom Gutsinspektor Veith zugeraunt. So richtig war ihm noch nicht klargeworden, wie sie das wohl gemeint hatte.
Sich diese Klarheit zu beschaffen, fragte er nun:
„Und warum sind’S in die Heimat zurückgekommen?“
Roswitha lächelte. „Um wiederzusehen, wie’s einmal war, und weil ich mich hier wohlfühle.“
„Ja, wohl fühlt sich, so glaube ich, jeder hier. Für mich sind die Berge das Schönste. Und die Leut hier. Das ganze Land. Ich versteh’s schon, warum’S wiedergekommen sind. Werden’S denn länger bleiben?“
Roswitha zögerte mit der Antwort. Dann sagte sie: „Ich denk schon.“ Sie vermied es, Hochwürden dabei anzusehen, blickte auf ihre Fingerspitzen, und ihm entging nicht, wie nachdenklich sie das gesagt hatte. Aber er konnte sich keinen Reim darauf machen.
„Also, einen Urlaub, wenn ich’s richtig versteh.“
Wieder dauerte es ein paar Sekunden, ehe sie antwortete:
„Ja, so könnte man sagen.“
Er spürte ganz deutlich, dass da nicht alles so war, wie es sein sollte. Er konnte sich aber wirklich keinen Reim darauf machen, ergründete die Ursache nicht, brachte es aber andererseits nicht übers Herz, ihr neugierige Fragen zu stellen. Bei seinen Leuten hier, da tat er das schon zuweilen. Aber die Roswitha, die war doch irgendwie etwas anderes. Die hatte den Sprung nach draußen geschafft und Berühmtheit erlangt.
Er lächelte. „Wenn ich an die Leut im Tal denk, die wissen nix von dem, was Sie draußen geschafft haben, Roswitha.“
„Alles ist vergänglich, Hochwürden.“
„Mögen’S net für die Leut hier einmal singen? Die Kirche hat eine gute Akustik. Ein Sopran, wie der von Ihnen, der würde schön klingen. Und eine Freud für die Menschen im Tal wär’s schon.“
Sie sah ihn erschrocken an. Mit einem solchen Angebot hatte sie keine Sekunde gerechnet. Aber dann dachte sie: Vielleicht könnte ich doch irgendetwas singen, was nicht zu lange dauert, obgleich es mir der Arzt streng verboten hat. Nur ein einziges Lied.
„Vielleicht“, sagte sie schließlich ausweichend und hoffte, dass er nun auf ein anderes Thema kommen würde.
Das tat er auch. Aber seine Frage nun war ihr im Grunde noch mehr peinlich als die Aufforderung, in der Kirche zu singen. Obgleich er durchaus nicht neugierig sein wollte, bemerkte er:
„Ein schönes Madel waren’S ja früher schon, Roswitha. Haben’S denn draußen in der Welt keinen Mann net gfunden, der zu Ihnen gepasst hätt?“
„Zur Liebe gehören zwei, Hochwürden“, entgegnete Roswitha und lachte.
„Na, hier im Tal täten die Burschen sich derreißen für ein hübsches Madel wie Sie.“
Sie sagte gar nichts dazu und dachte an die Zeit in der Fremde. Die zwölf Jahre draußen, wo sie eine steile Karriere gemacht hatte.
Natürlich gab es Episoden, Liebeleien, aber die große Liebe ...? Nein, die große Liebe hat es nicht gegeben, oder es gab sie schon immer. Seit zwölf Jahren dachte Roswitha nur an einen Mann, diesen einen, den sie hier wiederzusehen hoffte.
Eine Erfüllung würde es nicht geben. Da war sie sicher. Aber nur noch einmal sehen in diesem Leben, das bald vorbei sein sollte, wenn die Ärzte recht hatten. Sie wollte mit ihm sprechen, ihn anschauen. Dafür, eigentlich nur dafür, war sie hergekommen. Diesen Wunsch, den hatte sie sich erfüllen wollen.
Sie würde noch drei Wochen warten müssen. Aber das mochte sie nicht. Sie wollte zu ihm fahren. Morgen schon vielleicht. Bestimmte Pläne gab es nicht für diese Fahrt. Sie konnte nicht mehr planen. Verpflichtungen hatte sie auch nicht mehr. Ihr Agent, der sie noch bis vorige Woche bestürmt hatte, doch wieder aufzutreten, tat ihr leid. Er wusste nicht, wie es um sie stand. Und sie meinte auch, er brauchte es nicht zu wissen.
Das, was auf sie zukam, ging nur sie selbst etwas an. Sie hatte niemand, dem sie verpflichtet gewesen wäre. Und mit dem einen, falls sie ihn wiedersah, würde es nichts weiter als ein Gespräch geben. Vielleicht sogar ein kurzes Gespräch. Das waren Dinge, die sie nicht voraussehen konnte und auch nicht wollte.
„Sie schaun so traurig drein, Roswitha. Haben’S Sorgen?“
Sie lächelte, schüttelte den Kopf und sah Pfarrer Kernmoser an. „Eigentlich nicht.“
Jeden anderen im Tal hätte er jetzt gefragt, ob er sich nicht bei einer Beichte erleichtern wollte. Aber hier ließ er es. Er dachte viel mehr an ihren Gesang und nahm sich vor, daraus ein richtiges Fest zu machen, wenn sie in der Kirche ihren glockenhellen Sopran erklingen ließ. Auch er hatte zwei Schallplatten von ihr. Aber das sagte er ihr nicht. Sie brauchte nicht zu erfahren, wie sehr er schöne Musik liebte. Das waren Dinge, die nur ihn selbst etwas angingen.
„Das Sopherl“, sagte Hochwürden, „hat noch eine Weile zu tun. Wollen’S mit mir ein wenig in den Garten gehn? Es ist herrlich da draußen. Die Bäume blühn. Die schönste Zeit vom Jahr.“
Sie nickte. Dann standen sie auf, gingen hinaus, schlenderten durch den großen Obstgarten der Pfarrei. Und sie bewunderte Blüten, roch, wie es duftete und lehnte sich dann verträumt an einen Stamm, schloss die Augen, und es sah aus, als habe sie die Gegenwart von Kernmoser völlig vergessen.
Der große, stattliche Mann schmunzelte zufrieden vor sich hin und ging dann weiter nach hinten, wo seine Bienenstöcke standen. Er war kein sehr begnadeter Imker, aber für das Pfarrhaus hatte der Honig noch allemal gereicht, sogar darüber hinaus.
Er hoffte ja, dass Roswitha nachkommen werde, damit er ihr von seinen Bienen erzählen konnte. Doch sie kam nicht. Sie stand noch immer an diesen Baum gelehnt und schien zu träumen.
In diesem Augenblick rief eine Männerstimme vom Haus her: „Ja, da schau her, die Roswitha! Das hab ich mir doch gleich denkt. Und ich hab net falsch geschaut.“
Roswitha war zusammengezuckt, blickte aufs Haus und sah den Mann in der Tür stehen. Sie erkannte ihn sofort, den Wagner Bub, den Dammeier-Ferdl. Da also war er. Im Grunde hatte er sich wirklich gar nicht verändert. Nur älter war er geworden, ein paar graue Haare an den Schläfen, aber gut sah er aus.
„Ferdl“, rief sie, stieß sich vom Baum ab und ging ihm entgegen.
Er streckte die Hände nach ihr aus, und sie entsann sich in diesem Augenblick, wie sie damals in den Weiher gefallen war. Sechs Jahre war sie gewesen. Aber sie erinnerte sich ganz genau an jede Einzelheit. Und er hatte sich mit einem Hechtsprung damals ins Wasser gestürzt und sie gepackt und aufs Trockene geschafft. Ja, sechzehn war er damals gewesen. Schon ein großer Kerl. Aber mit einem Herz für Kinder, für kleinere.
In diesem Augenblick fiel ihr auch ein, dass er vor zwölf Jahren, als sie ihn zum letzten Mal gesehen hatte, gar kein Student mehr gewesen war. Schon ein richtiger Arzt. In Innsbruck am Krankenhaus hatte er gearbeitet. Jetzt fiel es ihr ein. Und zum Tode ihrer Mutter war er gekommen. Nur zum Begräbnis. Genau wie der Timo. Alle waren sie gekommen. Die Mutter Lienzer war beliebt im Dorf gewesen, und nicht nur im Dorf, im ganzen Tal und darüber hinaus. Noch mit sechzig hatte sie als Hebamme gearbeitet. Und der Dammeier-Ferdl war genau durch ihre Hilfe auf die Welt gekommen wie so mancher andere, der jetzt schon längst erwachsen war. Sie alle hatten damals keinen Weg gescheut, um der Frau die letzte Ehre zu erweisen, die ihnen ans Licht der Welt geholfen hatte.
In diesem Augenblick, als der Ferdl vor ihr stand und ihre Hand schüttelte, sie umarmte und auf beiden Wangen küsste, da fiel ihr all das schlagartig ein.
Sie schaute ein wenig verklärt drein, als der Ferdl dann von ihr ließ, einen Schritt zurücktrat und sie anschaute.
„Gut siehst aus“, meinte er. „Wirst länger bleiben?“
Sie nickte und gab beinahe dieselbe Antwort, die sie schon Hochwürden gegeben hatte.
„Eine Bereicherung ist’s fürs Tal, wenn du hier bleibst.“
Sie lächelte müde. Gedankenverloren schaute sie ihn an.
„Und du?“, fragte sie. „Ich hab schon gehört von dir.“
„Hoffentlich nix Schlechts.“
Sie lachten beide. Und da kam der Pfarrer.
„Ein hübsches Paar seid’s“, meinte Kernmoser.
Roswitha wurde rot, und Dr. Dammeier meinte lachend: „Seit wann versucht sich der Pfarrer als Eheanbahnungsinstitut?“
„Ein Pfarrer muss sich eben um alles kümmern“, meinte Kernmoser verschmitzt. „Kommt's eini ins Haus! Ich habe einen Obstler, den werd ihr mir net ausschlagen.“
Roswitha tat es dennoch. Sie trank keinen. Und dann wollte ihr Dr. Dammeier unbedingt die Talsperre zeigen, nachdem er erfahren hatte, dass sie die noch gar nicht kannte.
„Zwölf Jahre sind eine lange Zeit“, meinte er, als er ihr in seinen Jeep half, der direkt vor dem Pfarrhaus stand.
„Fahr net so gschwind“, bat ihn Roswitha, als sie losfuhren. Und er ließ sich wirklich Zeit. Es gab für Roswitha so viel zu sehen. Nicht nur die Berge und die schön Landschaft. Da und dort war ein neues Haus. Es gab ein Hotel.
„Da hat der Kemmelmeier seine Finger drin“, meinte Dr. Dammeier. „Überall, wo was ist, da mischt er mit.“
„Ich habe ihn nie leiden mögen. Ist er immer noch so grantig?“
„Grantig?“ Ferdl lachte. „Schön wär’s. Aber er ist schlimmer. Er macht seine Geschäfte, und da ist ihm nix mehr heilig. Gar nix mehr. Da drüben, siehst, zum Glemmer aufi haben’s eine Seilbahn baut. Den ganzen Wald haben’s verschandelt für die Seilbahn. Die Schneisen, kannst die sehn?“
„Ja, ich seh’s. Kommen viele Touristen her?“, wollte Roswitha wissen.
„Es lauft sich ein. Unser Bürgermeister, den kennst doch.“
„Der Wastl?“, fragte Roswitha.
„Nein. Net der Wastl. Der Brandauer Gustl. Er ist clever, verstehst. Er möchte aus dem Tal Geld schlagen für alle. Hotels möcht er bauen. Und drüben von Deutschland solln’s kommen. Aber auch von anderswo. Die Stadtleut, verstehst. Im Winter, da ist hier was los. Jetzt geht’s. Aber wart, die nächst Woch, wenn Pfingsten ist, sollst sehn, wie viel Leut kommen und in die Berg umeinand kraxeln. Da gibt’s wieder Arbeit, sag ich dir.“
Sie fuhren die Straße von St. Hildegard bis Stunds, ein noch kleinerer Ort, als St. Hildegard war. Und dann, als sie Stunds hinter sich hatten, ging es weiter neben dem Poltzbach aufwärts an der Schirrmühle vorbei, die auch heute am Sonntag lief. Die Turbinen arbeiteten jetzt, das Wasserrad stand still. Es wurde nicht mehr gebraucht.
Die Fahrt ging weiter durch den nächsten kleinen Ort. Steegroden hieß er, und dahinter war der Weg nicht mehr asphaltiert. Schotter bedeckte ihn. Er war breiter, aber sehr zerfahren.
„Die Lastautos machen die Wege kaputt“, sagte Ferdl. „Aber wir brauchen sie, siehst da vorn, da ragt sie auf, die Staumauer. Und dahinter ist Mühlauer schon fast versunken im Wasser.“
„Da drüben ist noch eine Seilbahn“, meinte Roswitha und deutete zur Kalkspitz Alpe hin.
„Material-Seilbahn für die Baustelle. Wir müssen links hinüber. Siehst, die Häuser dort, Baracken. Jetzt ist da alles still. Aber in der Woch sind's alle wieder da, die Leut, die jetzt zum Wochenend weg sind. Nur die Ausländer sind da blieben über Sonntag.“
Er hielt plötzlich an, sie schaute verwundert in seine Richtung, und er wandte sich ihr zu. Mit einem Male war sein Gesicht ernst. Sie entdeckte Falten darin, die damals vor zwölf Jahren noch nicht dagewesen waren.
„Was schaust?“, fragte sie.
„Warum bist hier? Machst Urlaub?“, wollte er wissen.
„Auch“, entgegnete sie. „Aber ich hatte gehofft, ich würd den Timo treffen.“ Im Gegensatz zum Sopherl wusste er sofort, welchen Timo sie meinte.
„Da schau her“, meinte er. „Aber der Timo ist auf dem Gut bei Innsbruck, du weißt doch, das Gut vom Grafen. Er leitet es jetzt. Früher ist er nur Verwalter gewesen. Aber jetzt macht er alles für den Grafen. Er wird erst nach Pfingsten heraufkommen zur Heumahd.“
„Hast noch Verbindung mit ihm?“, wollte sie wissen.
Er nickte. „Immer. Wir sind Freunde. Manchmal kommt er auf ein Glas Wein oder ich fahr zu ihm. Willst, dass wir hinfahren?“
„Jetzt?“
„Heute Abend?“
„Er ist noch ledig, nicht wahr?“
Er nickte. „Ja, ist er. Und ich weiß auch den Grund. Der Grund bist du. Hast du ihn mögen, den Timo?“
Sie senkte den Kopf und blickte auf ihre Hände. „Immerzu, all die Jahre.“
„Und warum hast ihm net schrieben?“, fragte der Ferdl.
„Hat er denn schrieben?“
„Er hat net gwusst, wo du bist. Er hat viel an dich gdacht. Ich weiß, Roswitha, und wenn du auch an ihn gedacht hast, all die Jahre, das ist ja schon bald ein Drama. Heute Abend fahrn’ wir zu ihm. Ich ruf ihn an, gleich auf der Baustellen.“
„Es pressiert doch nicht. Lass dir Zeit!“'
„Roswitha, ich weiß, dass da zwei sind, die sich lieb haben; über Jahre lieb haben. Da sagst du, es pressiert net. Sicher tut’s pressieren. Aber jetzt zeig ich dir noch die Staumauer.“
Er fuhr aber dann doch nicht los, nahm die Hand wieder vom Schlüssel und wandte sich ihr erneut zu.
„Nur wegen dem Timo bist hier?“
Sie nickte.
Er lächelte. „Guck mal auf der Baustellen ist ein Kollege von mir, ein Unfallchirurg. Doktor Fellau heißt er. Er liebt deine Stimme. Er ist ein Fan von dir. Er hat nie gewusst, dass du von hier bist. Ich hab’s ihm net gesagt. Er wird Augen machen.“ Er wurde wieder ernst. „Es gibt noch einen Grund, net wahr?“, sagte er förmlich.
Über seinen veränderten Ton erschrak sie richtig. „Wie meinst das?“
„Wie ich das sag. Also, magst net reden?“
Sie senkte den Kopf, fühlte sich durchschaut.
„Glaubst denn, ich seh net, wie blau deine Lippen sind unter der Schminke? Du hast zwar den Lippenstift stark aufgetragen, das passt gar net zu dir, aber du wirst schon wissen warum. Trotzdem seh ich’s. Und die Fingerkuppen, und die Augen.“
Sie warf den Kopf hoch, blickte ihn überrascht an. „Was ist mit den Augen?“
„Da gibt’s so kleine Hinweise, weißt. Am liebsten möchte ich mein Stethoskop nehmen und dich abhören, Roswitha.“
Sie senkte wieder den Kopf. „Das brauchst net. Ich weiß so schon, was ich hab.“
„Du weißt’s? Mit dem Herzen, stimmt’s?“
Ohne aufzusehen, nickte sie. Eine Locke ihres dunklen Haares war ihr in die Stirn gefallen.
„Und jetzt bist herkommen und willst dich erholen?“
„Da gibt’s nix zu erholen“, erwiderte sie. „Aus ist’s. Der Doktor in New York hat mir ein halbes Jahr geben. Vier Monate davon sind schon um.“
Dammeier legte seine Hand auf ihre Schulter, so, als wollte er sie trösten. Aber zugleich lag sein rechter Zeigefinger an der Halsschlagader. Dort konnte er deutlich den Pulsschlag fühlen.
„Ach geh, Roswitha, jetzt willst mir Angst machen.“
Sie sah zu ihm auf. „Nein, Ferdl, keine Angst machen. Ich habe ja selbst keine Angst mehr. Am Anfang, da hab ich geglaubt, die Welt bricht zusammen. Aber dann hab ich begriffen, dass alles weitergeht, und dass es auch ohne mich weitergehen wird.“
„Weißt was“, sagte Ferdl lächelnd, „wenn wir heroben sind in meiner Station, dann werd ich dein Herz abhören, dich einmal untersuchen. Wir haben sogar die Möglichkeit, ein EKG zu machen. Ja, da staunst, wie? Wir sind halt modern. Die Gesellschaft hat mit nix gespart. Und der Landeshauptmann hat auch noch eine Menge dazugegeben.“
„Und was versprichst dir davon?“, fragte Roswitha ungläubig.
„Ich bin noch net sicher. Aber vielleicht hat der Kolleg in New York einen Schmarrn geredt. Ich glaub’s halt net.“
„Wie willst das wissen nur so vom Ansehn?“
Er nahm seine Hand von ihrer Schulter, hielt seinen Zeigefinger hoch. „Poch, poch, hat’s da gemacht“, sagte er. „Hast gar nix gemerkt.“ Er lachte. „Und so tickt kein Herz, das sterben will. Wir werden seh’n.“
Zehn Minuten später trafen sie oben an der Baustelle ein, wo Dr. Fellau und der Baustellensanitäter Kreuzbechner bereits auf sie warteten und überrascht auf Roswitha blickten.
„So schnell“, sagte Fellau, „hätte ich dich nun doch nicht hier oben erwartet.“
Ferdl machte Roswitha mit Fellau bekannt und desgleichen mit Kreuzbechner. Dann sagte er. „Wir haben eine Patientin für eine Untersuchung. Aber ich mach das schon allein. Weiß einer von euch, wo die Erika steckt?“
„Wandern hat’s wollen“, meinte der Kreuzbechner.
„Wisst's ihr, wann sie zurückkommt?“ Die beiden zuckten die Schultern. Ferdl wandte sich Roswitha zu. „Erika Meindl ist eine Kollegin, eine Internistin, eine hervorragende.“ Er lächelte. „Sie könnte Oberärztin sein in einem großen Krankenhaus. Aber Liebeskummer hat sie hierher verschlagen. So, sieh dir mal das Panorama an, Roswitha.“ Er deutete in die Runde, und wirklich konnte man von hier oben weit übers Tal blicken.
„Ich bin in meinem ganzen Leben noch net da heroben gewesen“, meinte Roswitha.
„Da musste erst eine Talsperre gebaut werden, damit du das einmal sehn kannst.“ Ferdl lachte.
Roswitha ging ein Stück über das Plateau, und die Gelegenheit nützte Fellau, um Ferdl zuzuflüstern: „Was ist denn mit ihr?“
„Irgendwas an der Pumpe. Ich will mal sehn. Ich hebe das EKG für die Erika auf. Sie soll sich das noch ansehn. Sie versteht da ein bisschen mehr davon als ich. Schließlich bin ich Chirurg und kein Kardiologe.“
„Wie kommst du darauf, dass da was sein soll?“ fragte Fellau.
„Ein Arzt in New York hat ihr gesagt, dass sie noch ein halbes Jahr zu leben hat, das war vor vier Monaten. Sie ist im Grunde hierhergekommen, um zu sterben. So seh ich das. Weiter weiß ich noch nichts. Aber du hältst den Mund, verstehst du? Erfahren darf das niemand.“ Er wandte sich zur Seite und blickte hinüber zu Roswitha. Dann rief er sie und sagte dazu: „Komm hereinspaziert. So friedlich wie im Augenblick ist es hier heroben nicht alle Tage.“
Dann zeigte er ihr seine Station. Kranke waren im Augenblick nicht untergebracht. Auch das betrachtete Ferdl als eine Art Ausnahmezustand. Denn sonst lagen mitunter zehn und mehr Patienten in der Krankenbaracke.
„Wenn’s nach dem Brandauer, unserm Bürgermeister, nach der Erika Meindl, dem Fellau und mir ging, würde hier eines Tages ein richtiges Krankenhaus gebaut. Und irgendwann geschieht das auch. Der Brandauer will es mehr noch als wir. Er möchte überhaupt aus dem Tal etwas ganz Modernes machen, ohne zugleich den Charakter der Landschaft zu verschandeln. In St. Hildegard haben wir schon eine Ambulanz, doch heut ist die geschlossen. So, nun setz dich mal dort drüben hin, Roswitha. Dann möcht ich doch mal sehn, was an der Geschieht dran ist.“
Ein wenig ungläubig ließ es Roswitha über sich ergehen, dass er sie abhörte, und sie genierte sich auch nicht vor ihm. Jetzt war er durch und durch Arzt für sie und nicht mehr der ältere Junge aus dem Dorf von früher.
Auch das EKG machte Dr. Dammeier nun.
Als er mit allem fertig war und Roswitha sich aufrichtete, sagte er: „Bleib noch für ein Momenterl liegen.“ Er setzte sich neben sie auf die Liege und sah sie an. „Ganz gesund bist halt net. Aber schlimm kann’s net sein. Net so schlimm, das du schon sterben müsst. Ich werde die Erika fragen, und sie wird sich das EKG anschaun. Da ist was am Herzen. Aber das musst schon länger haben.“
Sie erzählte ihm die Geschichte, wie sie damals während der Vorstellung auf der Bühne zusammengebrochen war. Danach hatten Untersuchungen stattgefunden. Und ein Kardiologe, ein berühmter dazu, war zu dem Schluss gekommen, dass Roswitha an einem schweren Herzschaden litt. An einem Herzklappenverschluss, von dem man anfangs noch gehofft hatte, er sei durch eine Operation in Ordnung zu bringen. Doch Roswithas hinfälliger Zustand ließ keine Operation zu. Ein Herzchirurg in New York weigerte sich, die Operation auszuführen, weil sie im Zustand der Patientin ein glattes Todesurteil gewesen wäre.
„Und dann?“ fragte Dammeier. „Dir geht’s doch besser heut. Natürlich ist das operativ in Ordnung zu bringen. Und selbstverständlich muss der Patient so kräftig sein, dass man die Operation riskieren kann.“
Nach einer langen Zeit der Depression schöpfte Roswitha plötzlich wieder Hoffnung. Irgendwie war es viel vertrauter, mit Ferdl zu sprechen als mit all diesen Ärzten in Amerika.
„Wie bist denn zu uns kommen? Mit dem Flugzeug?“
Sie nickte. „Ich hab mir denkt, mit dem Flugzeug könnte es aus sein. Nun gut, dann stirbst halt.“
„Aber du bist net gestorben. Lebst ja noch“, meinte er lachend. „Erzähl mir, wie es war.“
„Na ja, ein wenig hab ich es schon gespürt, am Anfang, wie die Maschine hochgangen ist. Aber nachher war nix.“ Er lächelte. „Das spür ich auch. Das spürt jeder. Wenn's so steil hochgehen, drückt’s einem den Magen in den Rücken. Das hast gespürt.“
Sie nickte wieder. „Und Angst hab ich gehabt.“
„Siehst“, sagte er. „Und du lebst. Wenn alles so schlimm wär, wie du sagst, wärst net ankommen hier.“
„Denkst wirklich?“
„O ja, Roswitha. Und nun vergiss die dummen Gedanken. Komm, wir geh'n hinaus in die Sonne, trinken etwas zusammen mit Fellau und Kreuzbechner. Und nachher, wenn Erika kommt, schaut sie sich das EKG noch mal an. Wir können über alles reden. Oder willst sofort zum Timo?“ Er hatte die letzten Worte leise gesprochen.
„Möcht ich schon. Ich hab einen Wagen.“
Er lachte wieder. „So herzkrank, dass du sterben willst, aber einen Wagen fährst. Den hab ich gar net gesehn. Wo steht er denn?“
„Ich hab ihn vorm Dorf stehen lassen. Ich wollt das letzte Stückerl zu Fuß gehn.“
„Sollen wir zusammen zum Timo fahrn? Zeit hätt ich schon. Der Fellau hat den Dienst heut.“
Sie lächelte ihm dankbar zu. „Wenn’st magst?“