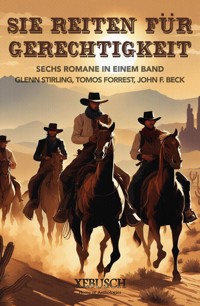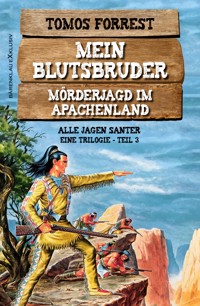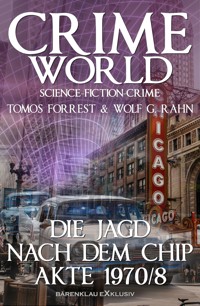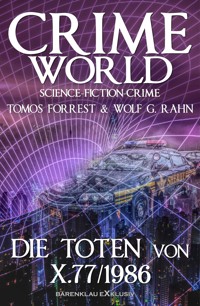3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der junge Haadi’a, Sohn von Intschu-tschuna, der sich kürzlich durch eine heldenhafte Tat seine Kriegernamen Winnetou verdient hat, ist mit seinem Indianer-Bruder Oriole auf dem Weg in das Dorf der Mescalero, als sie auf einen schwerverletzen Indianer stoßen, der ihnen im Sterben seine größte Sünde verrät: Er sei vor vielen Monden in der Hoffnung auf Ruhm dem Lockruf des Weißen Mannes gefolgt, habe ihm die geheimen Lagerstätten des Apachen-Goldes verraten und wurde wenig später selbst verraten, indem man ihm nach dem Leben trachtete.
Wenig später machen sich die jungen Krieger auf den Weg, den Verbrecher, dessen Name dem Sterbenden nicht mehr über die Lippen kam, aus dem Land der Apachen zu vertreiben. Doch ihr Gegner ist mächtig und skrupellos, und er geht über Leichen, um sein Ziel, das Gold der Apachen, zu erreichen. Seine Opfer werden nicht nur Indianer sein …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Tomos Forrest
Mein Blutsbruder
Die Jagd auf das
Apachen-Gold
Aus der Reihe
»Sohn des Apachen-Häuptlings«
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Kathrin Peschel nach einem Motiv von Klaus Dill, 2022
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Aus der Feder von Tomos Forrest sind weiterhin erhältlich:
Das Buch
Der junge Haadi’a, Sohn von Intschu-tschuna, der sich kürzlich durch eine heldenhafte Tat seine Kriegernamen Winnetou verdient hat, ist mit seinem Indianer-Bruder Oriole auf dem Weg in das Dorf der Mescalero, als sie auf einen schwerverletzen Indianer stoßen, der ihnen im Sterben seine größte Sünde verrät: Er sei vor vielen Monden in der Hoffnung auf Ruhm dem Lockruf des Weißen Mannes gefolgt, habe ihm die geheimen Lagerstätten des Apachen-Goldes verraten und wurde wenig später selbst verraten, indem man ihm nach dem Leben trachtete.
Wenig später machen sich die jungen Krieger auf den Weg, den Verbrecher, dessen Name dem Sterbenden nicht mehr über die Lippen kam, aus dem Land der Apachen zu vertreiben. Doch ihr Gegner ist mächtig und skrupellos, und er geht über Leichen, um sein Ziel, das Gold der Apachen, zu erreichen. Seine Opfer werden nicht nur Indianer sein …
***
1. Kapitel
Das gereizte Fauchen des Pumas war eine Warnung, aber der Mann, dem sie galt, reagierte zu spät. Er kniete neben dem eben erlegten Puma-Weibchen und hatte damit begonnen, mit der breiten Klinge seines Messers die ersten Schnitte zu ziehen, um die kostbare Haut abzustreifen. Seine abgefeuerte, einschüssige Büchse lag im üppigen Gras beim Wasserloch.
Es war ein prachtvolles, ausgewachsenes Tier und mochte die für ein Weibchen beachtliche Länge von gut anderthalb Metern aufweisen. Das ins silbergrau spielende, dichte Fell war es, das den Jäger angelockt hatte. Zwei Tage hatte er am Wasserloch gelegen und der unbarmherzig niederbrennenden Sonne getrotzt.
Als jetzt das Fauchen in ein dunkles Grollen überging, hatte sich der Jäger halb erhoben und kniete, das breite Jagdmesser stoßbereit in der Hand. Doch viel Zeit zur Abwehr des Silberlöwen blieb ihm nicht mehr. Der Blutgeruch der getöteten Gefährtin hatte das Tier zum Äußersten gereizt. Jetzt schnellte es sich wie eine Feder vom Boden und flog auf den Jäger zu.
»Ndołkah (Puma)!«, rief er erschrocken aus, aber das mächtige Tier war nicht mehr aufzuhalten.
Der Mann wurde von dem mächtigen Anprall mitgerissen und stürzte zur Seite. Verzweifelt versuchte er, den Puma mit seinem Jagdmesser zu töten, aber das Tier wehrte sich wie rasend. Die langen, scharfen Krallen fuhren wie Dolche durch das lederne Jagdhemd und gruben sich tief in die Schultern des Jägers.
Die Schmerzen trieben dem Menschen die Tränen in die Augen und machten ihn fast wahnsinnig. Je öfter der Puma seine Pranken in eine neue Stelle seines Körpers hieb, je mehr die grässlichen Schmerzen ihn an den Rand des Erträglichen trieben, desto verzweifelter wurden seine Abwehrstöße. Ihm wurde schwarz vor den Augen und er spürte bereits, dass er aus der tödlichen Umklammerung des Tieres nicht mehr entkommen konnte.
Plötzlich glaubte der Jäger, eine helle Gestalt zu erkennen, die sich langsam auf ihn zubewegte. Er konnte nicht sagen, ob es eine Frau oder ein Krieger war, aber mit einem lauten Schrei versuchte er, die Aufmerksamkeit des Fremden zu erreichen. Doch das Bild verschwand wieder.
Schwarze und rote Nebel waberten jetzt vor seinen Augen, ein letzter, verzweifelter Stoß des Jagdmessers, und er ließ ermattet in seiner Gegenwehr nach. Das letzte Geräusch, das er vernahm, war nicht das fauchende Tier, sondern ein Donnerschlag. Als er in den schwarzen Abgrund fiel, verschwand zugleich das schwere Gewicht auf seinem Körper. Er hörte nicht mehr, wie jemand etwas rief, und auch die Berührung des Fremden auf seinem Gesicht spürte er nicht.
Bik'egu'in Dán, Der uns Leben schenkt, hatte sein Schicksal selbst in die Hand genommen. Ndołkah, der Silberlöwe, hatte seine Gefährtin gerächt, und dem Herrn über das Leben gefiel das offenbar.
Es war der Schmerz, der den Jäger betäubt hatte, und es war ein heftiger Schmerz, der ihn wieder zurück ins Bewusstsein drängte. Aber der Jäger fühlte sich matt und zerschlagen, hatte noch nicht einmal das Bedürfnis, die Augen zu öffnen. Dann drangen leise Stimmen an sein Ohr, und gleich darauf nahm er auch den Brandgeruch wahr.
Erneut waren es Stimmen, die er unterscheiden konnten.
Sie sprachen leise, aber doch verständlich. Und vor allem waren es vertraute Laute, die ihn schließlich dazu brachten, seine Augen aufzureißen. Selbst diese Anstrengung tat ihm weh, aber sie wurde sofort bemerkt.
»Er schlägt die Augen auf, Bruder!«
»Kannst du uns verstehen? Nein, sprich nur mit den Augen. Schließe sie einmal für ›ja‹, zweimal rasch für ›nein‹«, bat der Sprecher.
Der Jäger antwortete auf diese Weise.
Jetzt erschien plötzlich ein Gesicht dicht vor ihm.
Es war ganz offensichtlich ein noch sehr junger Krieger.
Und er musste Schlimmes durchgemacht haben.
Der Jäger erkannte, dass seine Haare erst wieder begonnen hatten, zu wachsen. Durch irgendeine furchtbare Katastrophe mussten sie verbrannt sein, denn seine Kopfhaut schimmerte in verschiedenen Farbtönen noch sehr durch die Haarstoppeln.
Ein junger Krieger des Volkes!, dachte der Jäger. Vielleicht hat er sogar bereits seinen Namen gefunden. So, wie er gesprochen hat, muss er von unserem Volk sein, den Shis-Inday. Ist es denn möglich, dass ich den Kampf mit dem Puma durch ihn und den anderen überlebt habe? Aber mein Körper brennt, als läge er im Feuer. Mit diesen Gedanken beschäftigt, spürte der Jäger, wie der junge Mann eine Hand behutsam unter seinen Kopf schob, um ihn sanft anzuheben. Anschließend tränkte eine kühle Flüssigkeit seine Lippen, und er schluckte dankbar.
»Du bist unter Freunden, keine Sorge! Wir kamen gerade, als du im Kampf mit dem Silberlöwen unter ihm lagst – mein Schuss tötete ihn. Wir haben deine Wunden versorgt und dich hier in diese Höhle geschafft, wo das Feuer brennt und wir uns ausruhen können, ohne entdeckt zu werden.«
Der Jäger wollte etwas antworten, aber jedes Wort fiel ihm schwer.
Er spürte bei jeder Bewegung seinen zerrissenen Körper und wusste, dass er nicht mehr lange leben würde.
»Mein Name ist Chowilawu, und ich habe schweres Unrecht auf mich geladen. Nein, hört mich an, meine Brüder, ich muss reden, solange es mir noch möglich ist! Der-uns-Leben-schenkt hat mich berührt, und ihr wisst, was das bedeutet. Mein Körper wurde im Kampf mit dem Puma zerfleischt, ich weiß es, er brennt wie Feuer. Aber ich spüre eure Hilfe, ihr habt alles getan, meine Schmerzen zu mildern. Hört mir zu, Brüder, wir sind alle vom Volk der Shis-Inday, ich höre es an euren Stimmen. Das ist gut, und ich danke Dem-er-uns-Leben-schenkt dafür.«
Die lange Rede war zu viel für den Schwerverletzten, sein Kopf sank zurück. Zwar bemühten sich die beiden jungen Männer redlich um ihn, hoben erneut seinen Kopf und versuchten, ihm etwas Wasser einzuflößen.
»Hör mir jetzt zu. Chowilawu, du wirst leben. Du musst nur stark sein und kämpfen, dann wirst du wieder gesund werden. Sprich nicht so viel, wir bleiben bei dir. Hier sind wir in Sicherheit, niemand wird uns finden. Diese Höhle wurde bei unseren Jagdzügen von mir und meinem Bruder Oriole entdeckt. Mein Name ist Winnetou, ich bin der Sohn von Intschu tschuna.«
»Intschu tschuna!«, wiederholte der Jäger, und sein von den Tatzen des Pumas zerfetztes Gesicht schien sich zu einem Lächeln zu verziehen. »Es ist lange her, dass ich den Häuptling sprach!«
»Du kennst meinen Vater, Chowilawu? Aber wo lebst du?«, rief der junge Krieger begeistert aus. Er bemühte sich, den Schwerverletzten ein wenig von seinen Schmerzen abzulenken, aber der Jäger hatte schon wieder erschöpft die Augen geschlossen und schien eingeschlafen zu sein.
»Lass ihn, Winnetou!«, sagte Oriole leise. »Er braucht den Schlaf dringend, wir sollten ihn ruhen lassen.«
Winnetou schüttelte den Kopf.
»Es ist der Schlaf des Todes, mein Bruder. Sieh sein Gesicht, und du erkennst, wie sich die Weißbemalte Frau ihm nähert. Sie hat schon seine Hand ergriffen, Oriole.«
Ergriffen betrachteten die beiden beim flackernden Feuerschein das Gesicht des Mannes, der sich Chowilawu nannte.
Doch die kurze Pause hatte ihm genügt, erneut schlug er die Augen auf, sah sich verwundert um und schien sich dann zu besinnen. Zugleich huschte ein scharfer Zug über sein Gesicht, erneut hatten ihn die Schmerzen gepackt.
»Hört mich an, Brüder … ich habe vor vielen Monden meinen Stamm verlassen. Es war Unrecht von mir, denn ich folgte … dem Lockruf der weißen Männer.«
Chowilawu strengte jedes Wort an, erneut hielt er inne und holte tief Luft, bevor er fortfuhr: »Sie versprachen mir … Pferde und Gewehre … Ich hatte nichts und wollte doch … heiraten. Also folgte ich den Männern, die auf der Suche nach dem Gold der Apachen waren …«
»Du sprichst vom Gold unseres Volkes?«, antwortete Winnetou erschrocken, und der Sterbende antwortete nur mit dem Schließen seiner Augen. Rasch griff der junge Krieger zu dem ausgehöhlten Kürbis mit ihrem Wasservorrat und setzte ihn vorsichtig an die Lippen des Jägers. Aber das meiste Wasser lief ihm aus dem Mund, und Winnetou musste aufpassen, dass er sich nicht dabei verschluckte.
»Es ist gut, mein … junger Bruder. Chowilawu hat nicht mehr … viel Zeit. Er sieht die Weißbemalte Frau, die ihm zulächelt. Nur eines sollt ihr wissen … Wir fanden Gold bei dem alten … Hüter. Einer der Männer tötete ihn … sofort. Drei Mexikaner dabei, Brüder. Als sie das Gold in der Höhle sahen, wollten die anderen auch mich … töten, aber ich entkam …«
Seine Stimme wurde immer leiser und erstarb schließlich in einem Röcheln.
»Wer sind diese Männer, Chowilawu? Sprich mit uns!«, rief Winnetou aufgeregt und beugte sich dicht über den Kopf des Sterbenden, um jede Silbe zu hören, die noch über dessen Lippen kam.
Es dauerte diesmal so lange, dass die beiden jungen Krieger schon fürchteten, dass der Jäger an seinen schweren Verletzungen verstorben sei, als sich plötzlich seine Lippen noch einmal bewegten.
Winnetou hielt sein Ohr dicht an den Mund des sterbenden Jägers und vernahm seine letzten Worte.
»Der … Anführer … nneezi … M…Brad…«
»Ich verstehe dich nicht, wie ist sein Name?«
Ein Zittern durchlief den geschundenen Körper, der Jäger streckte sich und sank dann mit einem leisen Seufzer zurück.
»Zu spät!«, sagte Winnetou leise und sah den Toten mitleidig an.
Schließlich erhob er sich und trat vor den Höhleneingang, um seinen Blick hinauf zu den Sternen zu richten. Seine Gedanken wanderten zu den Ahnen, von denen ihm die Alten erzählt hatten. So stand er lange Zeit sinnend und sah auch nicht zu seinem Jugendfreund Gaagé, als der neben ihn trat.
Auch Gaagé hatte inzwischen seinen Kriegernamen erhalten und hieß nun Oriole. Die beiden waren auf einem Jagdzug unterwegs, als sie in der Nähe des Wasserloches den Schuss hörten und gleich darauf den Kampf zwischen Chowilawu und dem zweiten Puma erlebten. Sie kamen zu spät, auch wenn sie den männlichen Puma erschossen. Wie es sich jetzt erwiesen hatte, waren die Verletzungen des Jägers zu schwer.
»Was sagt mein Bruder zu dem Vorschlag, dass wir den Jäger hier bei der Höhle begraben? Dort drüben ist ein abgestorbener Baum, den wir leicht mit unseren Äxten ausgraben können. Anschließend legen wir ihn in die vertiefte Aushöhlung und setzen den Baum darüber wieder an seinen Platz, so, wie es uns die Alten gelehrt haben.«
Oriole nickte.
»So machen wir das beim Sonnenaufgang, Winnetou. Wir richten seinen Kopf nach Süden aus, und unter diesem Baum findet der Jäger eine würdige Stätte. Ich möchte ihm auch beide Puma-Felle dazu legen.«
»Uff, mein Bruder spricht meine Gedanken aus.«
Stumm begannen beide, den Toten für die Beerdigung vorzubereiten. Zunächst wurde sein Körper auf die Seite gedreht, die Beine zusammengeschoben, danach nahmen beide die Rohhautriemen von den Pferden, mit denen sie eine mögliche Jagdbeute befestigen wollten. Mit ihrer Hilfe wurde der Tote so zusammengebunden, dass er mit angezogenen Beinen in das Grab gelegt werden konnte.
Die beiden jungen Männer sprachen während der gesamten Vorbereitung kein einziges Wort, denn jeder von ihnen wusste ohnehin, was zu tun war. Sie waren etwa zwei Tagesritte vom Pueblo der Mescalero entfernt, und es wäre für alle nicht einfach geworden, den toten Jäger bis dorthin auf den Pferden zu transportieren. Zudem hatte der Mann vor Jahren sein Volk verlassen und ein unstetes Leben geführt. Eine Beerdigung nahe der Stelle, wo er den Tod durch den Puma gefunden hatte, war eine natürliche und zudem übliche Maßnahme bei den Apachen.
Als der Tote für die Beerdigung am nächsten Tag bereit war, nahmen die beiden noch immer schweigend ihre Decken vom Boden auf, wickelten sich hinein und legten sich neben das langsam niederbrennende Feuer. Die Nächte waren zu dieser Zeit bereits sehr kalt, und die beiden jungen Männer, die keine besonderen Ansprüche stellten, schliefen bis zum ersten, hellgrauen Schimmer am Horizont. Dann erhoben sich beide, nahmen ihre kurzen Äxte in die Hand und begannen ihr trauriges Werk.
Der Boden erleichterte ihr Vorhaben. Er war locker und gut löslich, sodass es keine Schwierigkeiten gab, den toten Baumstamm auszugraben und beiseitezulegen. Danach hoben sie die Grube weiter aus, bis der Tote genügend Platz hatte, um dort seine Ruhestätte zu finden. Als die beiden Krieger die Felle dazu gelegt hatten und den Baumstumpf wieder über dem Toten aufrichteten, war es nur noch das Werk einer knappen halben Stunde, und nichts erinnerte mehr an das Begräbnis.
2. Kapitel
Die drei Männer waren abgestiegen und hatten ihre Pferde in den Schatten der Felsen geführt, ihre Vorderbeine zusammengebunden und rasteten nun hier, um der größten Hitze der Mittagszeit zu entgehen. Der älteste der drei Männer trat noch einmal zu seinem Pferd, nahm aus der Satteltasche eine kleine Dose und öffnete sie. Gleich darauf hob er einen Vorderhuf auf und bestrich ihn mit einer übelriechenden Salbe.
»Oh mein Gott, Dad! Das ist ja nicht auszuhalten!«, rief einer der beiden jüngeren lachend, und der so Angesprochene drehte seinen Kopf zu ihm.
»Ich weiß, das Zeug riecht ekelhaft. Aber es hilft, wie ja meistens die schlecht riechende oder schmeckende Medizin die beste sein soll.«
»Ich setzte mich trotzdem etwas aus dem Wind!«, lachte der zweite der jüngeren Männer. »Es geht zwar kaum ein Windhauch, aber ich habe das Gefühl, dass ich auf einem Haufen mit verfaultem Fleisch sitze.« Er wedelte bei seiner Bemerkung mit der Hand vor der Nase, und nun rieb der Vater auch das andere Bein ein.
»Ihr habt gut reden, Jungs, aber mein alter Mustang macht mir Kummer. Wir haben noch gut zwei Tagesritte vor uns, und ich möchte nicht, dass er mir zuvor schlappmacht!«
Josias Parker, genannt Old Hatchet, hatte es im Nahkampf mit dem kleinen, indianischen Tomahawk zu einer wahren Meisterschaft gebracht. Er schleuderte die Axt blitzschnell aus dem Handgelenk heraus, und sie fand immer ihr Ziel. Sein markantes Gesicht, von Wind und Wetter kräftig gebräunt und gezeichnet, ließ doch nur Spekulationen über sein Alter zu. Er mochte vielleicht vierzig Lenze zählen, seine beiden Söhne, die ihm wie aus dem Gesicht geschnitten schienen, wohl knapp sechzehn und achtzehn Jahre.
Er war groß und wirkte bei jeder seiner Bewegungen geschmeidig wie ein geschulter Krieger. Wer ihn ansah, konnte häufig dem Blick aus seinen dunkelblauen Augen nicht lange standhalten. Josias Parker, Old Hatchet, war ein Westmann, der das Land vom Norden bis zum Süden, vom Osten bis zum Westen kannte. Jetzt sah man ihm jedoch die Strapazen eines langen Rittes an. Staub bedeckte ihn wie seine Söhne von Kopf bis Fuß, und seine schulterlangen, braunen Haare wirkten verfilzt und hingen ihm in Strähnen bis auf die Schultern.
Wenn der Vater sonnengebräunte Haut besaß, soweit man das bei seinem ledernen Jagdhemd, den nach indianischer Art gefertigten Leggins und den Mokassins sehen konnte, so waren seine beiden Söhne um einen Schatten dunkler. Nur wer ihnen sehr aufmerksam ins Gesicht sah, erkannte dort den indianischen Einfluss ihrer Mutter, die allerdings selbst einen zarten Bronzeton aufwies. Parker hatte Ha-o-zinne, eine Verwandte von Intschu tschuna geheiratet, und bewirtschaftete eine Farm, die im Gebiet der Sioux lag. Lange Zeit hatte er mit seinen Nachbarn große Probleme, zumal Häuptling Scha-tunga von den Yankatou-Sioux immer wieder auf der Farm auftauchte, wenn Josias nicht anwesend war.
Während der Farmer noch einmal beide Beine mit einer weiteren Schicht aus dem Behälter einrieb, schweiften seine Gedanken zurück an die letzte Begegnung mit dem Sioux, die nun schon einige Monate zurücklag.
Scha-tunga wollte Old Hatchets Frau um jeden Preis in sein eigenes Lager verschleppen und drohte den Parkers, dass er sein Ziel noch erreichen würde. Und dann war es eines Tages tatsächlich beinahe zu der Entführung gekommen.
Josias arbeitete schon seit dem frühen Morgen auf einem etwas entfernter gelegenen Feld, um vor einem heranziehenden Unwetter noch die Maiskolben zu ernten.
Ha-o-zinne nutzte die Zeit und säuberte gründlich den Dielenboden ihres massiven Blockhauses, als ein Schatten durch die geöffnete Tür auf sie fiel. Sie blickte rasch auf und erkannte den Sioux, der sein Pferd vor dem Haus anhielt und eben absteigen wollte, als die Frau des Hauses auch schon die stets griffbereite Doppelbüchse von der Halterung über der Tür gerissen hatte und auf ihn anschlug.
Mit dem wilden Ausruf ihrer Muttersprache, die der Sioux natürlich nicht verstand, schrie sie ihm entgegen: »Doo shaa nadaa da – stör mich nicht!« Das war noch eine freundlich gemeinte Warnung, aber als Scha-tunga sich davon nicht aufhalten ließ, sondern Anstalten machte, das Haus zu betreten und dabei seinen Tomahawk aus dem Gürtel riss, feuerte Ha-o-zinne auf ihn.
Der Sioux schrie auf, ließ das Beil fallen und fasste zu der Wunde in seiner Schulter, aus der das Blut herablief. Er starrte die Frau mit weit aufgerissenen Augen an, machte aber keinerlei Anstalten, zu verschwinden.
Ha-o-zinne hob die Doppelbüchse und richtete sie jetzt direkt auf den Kopf des Sioux. Ihr fiel ein Wort ein, das ihr Mann dem lästigen Besucher einmal nachgerufen hatte, und schrie es jetzt mit aller Kraft.
»Ablúštą!«, was so viel wie ›verlassen‹ bedeutete. Auch wenn sie es nicht richtig anwandte, dieses Wort und die noch immer drohende Waffe mochten den Ausschlag geben.
Scha-tunga drehte sich zu seinem Mustang um und zog sich etwas mühselig hinauf. Als er aus dem Augenwinkel bemerkte, wie sich die begehrte Frau nach dem Tomahawk bückte, dass er aus der kraftlos gewordenen Hand fallen gelassen hatte, unternahm er noch einen weiteren Versuch. Er griff nach dem Gewehr, das über dem Pferdehals in einer Lederschlaufe hing und wollte es auf Ha-o-zinne richten, aber die Apachenfrau schoss den zweiten Lauf auf ihn ab und traf ihn diesmal in den Oberschenkel.
Der Mustang ging mit dem Sioux durch, als sein Reiter Mühe hatte, sich auf dem Rücken zu halten, und von diesem Tag an ließ er sich nie wieder auf der Farm blicken. Alarmiert durch die Schüsse kamen die vier Parker vom Feld gelaufen, aber da war Scha-tunga nur noch ein Schemen am Horizont, während Ha-o-zinne die abgefeuerten Läufe in aller Ruhe erneut lud.
»Dad? Noch etwas Kaffee?«
Josias schreckte aus seinen Gedanken auf und blickte zu seinen Söhnen, die eben an einem kleinen, wenig rauchenden Feuer eine Kanne Kaffee zubereitet hatten. Der Farmer wischte sich mit dem Hemdärmel den Schweiß aus dem Gesicht und trat zu seinen Söhnen.