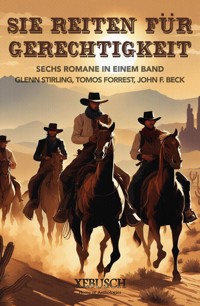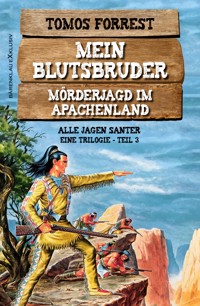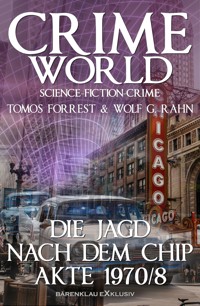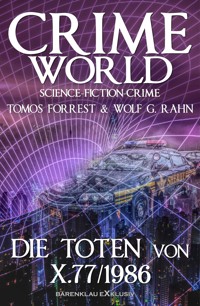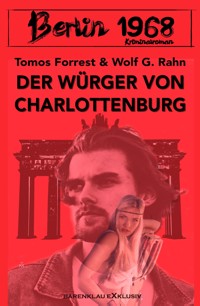Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im harten Leben des Wilden Westens prallen Welten aufeinander, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Es ist eine Zeit, in der alles möglich scheint: eine ruhmreiche Zukunft und unermesslicher Reichtum. Es ist aber auch eine Zeit, die Männer hervorbringt, die das Gesetz nicht achten und mit den Stiefeln treten, die alles zunichtemachen, was andere sich in harter Arbeit erschaffen haben und dafür sogar Menschen töten. Wenn es keine Männer geben würde, Marshals und Sheriffs, die den Pionieren folgen, die unter Einsatz ihres Lebens für ein Gleichgewicht zwischen beiden Seiten sorgen, was wäre das Leben dann noch wert? – Keinen Cent! Von solchen Männern erzählen diese spannenden Geschichten unserer internationalen Top-Autoren. – Weitere Anthologien werden folgen. Das Buch enthält folgende vier ausgewählte Western-Romane: › Mein Blutsbruder: Die Jagd auf das Apachen-Gold - von Tomos Forrest; › Und es kommt die Zeit der Abrechnung - von Tony Masero; › Gezeichnet für das Leben - von Glenn Stirling; › Bill Warbow, der Glücksritter - von Frank Callahan
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 755
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tony Masero//Tomos Forrest/
Glenn Stirling/Franc Callahan
Western-Anthology
Band 1
Grenzreiter
Vier Romane
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Authors
© Copyright dieser Lizenzausgabe by XEBAN-Verlag.
Verlag: Xeban-Verlag: Kerstin Peschel, Am Wald 67, 14656 Brieselang; [email protected]
www.xebanverlag.de
Lizenzgeber: Edition Bärenklau / Jörg Martin Munsonius
www.editionbaerenklau.de
Cover: © Copyright by Steve Mayer, nach Motiven, 2024
Alle Rechte vorbehalten!
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt beim XEBAN-Verlag. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Mein Blutsbruder: Die Jagd auf das Apachen-Gold
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Und es kommt die Zeit der Abrechnung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Gezeichnet für das Leben
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Bill Warbow, der Glücksritter
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Über die Autoren
Das Buch
Im harten Leben des Wilden Westens prallen Welten aufeinander, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Es ist eine Zeit, in der alles möglich scheint: eine ruhmreiche Zukunft und unermesslicher Reichtum. Es ist aber auch eine Zeit, die Männer hervorbringt, die das Gesetz nicht achten und mit den Stiefeln treten, die alles zunichtemachen, was andere sich in harter Arbeit erschaffen haben und dafür sogar Menschen töten.
Wenn es keine Männer geben würde, Marshals und Sheriffs, die den Pionieren folgen, die unter Einsatz ihres Lebens für ein Gleichgewicht zwischen beiden Seiten sorgen, was wäre das Leben dann noch wert? – Keinen Cent!
Von solchen Männern erzählen diese spannenden Geschichten unserer internationalen Top-Autoren. – Weitere Anthologien werden folgen.
Das Buch enthält folgende vier ausgewählte Western-Romane:
› Mein Blutsbruder: Die Jagd auf das Apachen-Gold - von Tomos Forrest
› Und es kommt die Zeit der Abrechnung - von Tony Masero
› Gezeichnet für das Leben - von Glenn Stirling
› Bill Warbow, der Glücksritter - von Frank Callahan
***
Mein Blutsbruder: Die Jagd auf das Apachen-Gold
Aus der Reihe »Sohn des Apachenhäuptlings«
von Tomos Forrest
1. Kapitel
Das gereizte Fauchen des Pumas war eine Warnung, aber der Mann, dem sie galt, reagierte zu spät. Er kniete neben dem eben erlegten Puma-Weibchen und hatte damit begonnen, mit der breiten Klinge seines Messers die ersten Schnitte zu ziehen, um die kostbare Haut abzustreifen. Seine abgefeuerte, einschüssige Büchse lag im üppigen Gras beim Wasserloch.
Es war ein prachtvolles, ausgewachsenes Tier und mochte die für ein Weibchen beachtliche Länge von gut anderthalb Metern aufweisen. Das ins silbergrau spielende, dichte Fell war es, das den Jäger angelockt hatte. Zwei Tage hatte er am Wasserloch gelegen und der unbarmherzig niederbrennenden Sonne getrotzt.
Als jetzt das Fauchen in ein dunkles Grollen überging, hatte sich der Jäger halb erhoben und kniete, das breite Jagdmesser stoßbereit in der Hand. Doch viel Zeit zur Abwehr des Silberlöwen blieb ihm nicht mehr. Der Blutgeruch der getöteten Gefährtin hatte das Tier zum Äußersten gereizt. Jetzt schnellte es sich wie eine Feder vom Boden und flog auf den Jäger zu.
»Ndołkah (Puma)!«, rief er erschrocken aus, aber das mächtige Tier war nicht mehr aufzuhalten.
Der Mann wurde von dem mächtigen Anprall mitgerissen und stürzte zur Seite. Verzweifelt versuchte er, den Puma mit seinem Jagdmesser zu töten, aber das Tier wehrte sich wie rasend. Die langen, scharfen Krallen fuhren wie Dolche durch das lederne Jagdhemd und gruben sich tief in die Schultern des Jägers.
Die Schmerzen trieben dem Menschen die Tränen in die Augen und machten ihn fast wahnsinnig. Je öfter der Puma seine Pranken in eine neue Stelle seines Körpers hieb, je mehr die grässlichen Schmerzen ihn an den Rand des Erträglichen trieben, desto verzweifelter wurden seine Abwehrstöße. Ihm wurde schwarz vor den Augen und er spürte bereits, dass er aus der tödlichen Umklammerung des Tieres nicht mehr entkommen konnte.
Plötzlich glaubte der Jäger, eine helle Gestalt zu erkennen, die sich langsam auf ihn zubewegte. Er konnte nicht sagen, ob es eine Frau oder ein Krieger war, aber mit einem lauten Schrei versuchte er, die Aufmerksamkeit des Fremden zu erreichen. Doch das Bild verschwand wieder.
Schwarze und rote Nebel waberten jetzt vor seinen Augen, ein letzter, verzweifelter Stoß des Jagdmessers, und er ließ ermattet in seiner Gegenwehr nach. Das letzte Geräusch, das er vernahm, war nicht das fauchende Tier, sondern ein Donnerschlag. Als er in den schwarzen Abgrund fiel, verschwand zugleich das schwere Gewicht auf seinem Körper. Er hörte nicht mehr, wie jemand etwas rief, und auch die Berührung des Fremden auf seinem Gesicht spürte er nicht.
Bik'egu'in Dán, Der uns Leben schenkt, hatte sein Schicksal selbst in die Hand genommen. Ndołkah, der Silberlöwe, hatte seine Gefährtin gerächt, und dem Herrn über das Leben gefiel das offenbar.
Es war der Schmerz, der den Jäger betäubt hatte, und es war ein heftiger Schmerz, der ihn wieder zurück ins Bewusstsein drängte. Aber der Jäger fühlte sich matt und zerschlagen, hatte noch nicht einmal das Bedürfnis, die Augen zu öffnen. Dann drangen leise Stimmen an sein Ohr, und gleich darauf nahm er auch den Brandgeruch wahr.
Erneut waren es Stimmen, die er unterscheiden konnten.
Sie sprachen leise, aber doch verständlich. Und vor allem waren es vertraute Laute, die ihn schließlich dazu brachten, seine Augen aufzureißen. Selbst diese Anstrengung tat ihm weh, aber sie wurde sofort bemerkt.
»Er schlägt die Augen auf, Bruder!«
»Kannst du uns verstehen? Nein, sprich nur mit den Augen. Schließe sie einmal für ›ja‹, zweimal rasch für ›nein‹«, bat der Sprecher.
Der Jäger antwortete auf diese Weise.
Jetzt erschien plötzlich ein Gesicht dicht vor ihm.
Es war ganz offensichtlich ein noch sehr junger Krieger.
Und er musste Schlimmes durchgemacht haben.
Der Jäger erkannte, dass seine Haare erst wieder begonnen hatten, zu wachsen. Durch irgendeine furchtbare Katastrophe mussten sie verbrannt sein, denn seine Kopfhaut schimmerte in verschiedenen Farbtönen noch sehr durch die Haarstoppeln.
Ein junger Krieger des Volkes!, dachte der Jäger. Vielleicht hat er sogar bereits seinen Namen gefunden. So, wie er gesprochen hat, muss er von unserem Volk sein, den Shis-Inday. Ist es denn möglich, dass ich den Kampf mit dem Puma durch ihn und den anderen überlebt habe? Aber mein Körper brennt, als läge er im Feuer. Mit diesen Gedanken beschäftigt, spürte der Jäger, wie der junge Mann eine Hand behutsam unter seinen Kopf schob, um ihn sanft anzuheben. Anschließend tränkte eine kühle Flüssigkeit seine Lippen, und er schluckte dankbar.
»Du bist unter Freunden, keine Sorge! Wir kamen gerade, als du im Kampf mit dem Silberlöwen unter ihm lagst – mein Schuss tötete ihn. Wir haben deine Wunden versorgt und dich hier in diese Höhle geschafft, wo das Feuer brennt und wir uns ausruhen können, ohne entdeckt zu werden.«
Der Jäger wollte etwas antworten, aber jedes Wort fiel ihm schwer.
Er spürte bei jeder Bewegung seinen zerrissenen Körper und wusste, dass er nicht mehr lange leben würde.
»Mein Name ist Chowilawu, und ich habe schweres Unrecht auf mich geladen. Nein, hört mich an, meine Brüder, ich muss reden, solange es mir noch möglich ist! Der-uns-Leben-schenkt hat mich berührt, und ihr wisst, was das bedeutet. Mein Körper wurde im Kampf mit dem Puma zerfleischt, ich weiß es, er brennt wie Feuer. Aber ich spüre eure Hilfe, ihr habt alles getan, meine Schmerzen zu mildern. Hört mir zu, Brüder, wir sind alle vom Volk der Shis-Inday, ich höre es an euren Stimmen. Das ist gut, und ich danke Dem-er-uns-Leben-schenkt dafür.«
Die lange Rede war zu viel für den Schwerverletzten, sein Kopf sank zurück. Zwar bemühten sich die beiden jungen Männer redlich um ihn, hoben erneut seinen Kopf und versuchten, ihm etwas Wasser einzuflößen.
»Hör mir jetzt zu. Chowilawu, du wirst leben. Du musst nur stark sein und kämpfen, dann wirst du wieder gesund werden. Sprich nicht so viel, wir bleiben bei dir. Hier sind wir in Sicherheit, niemand wird uns finden. Diese Höhle wurde bei unseren Jagdzügen von mir und meinem Bruder Oriole entdeckt. Mein Name ist Winnetou, ich bin der Sohn von Intschu tschuna.«
»Intschu tschuna!«, wiederholte der Jäger, und sein von den Tatzen des Pumas zerfetztes Gesicht schien sich zu einem Lächeln zu verziehen. »Es ist lange her, dass ich den Häuptling sprach!«
»Du kennst meinen Vater, Chowilawu? Aber wo lebst du?«, rief der junge Krieger begeistert aus. Er bemühte sich, den Schwerverletzten ein wenig von seinen Schmerzen abzulenken, aber der Jäger hatte schon wieder erschöpft die Augen geschlossen und schien eingeschlafen zu sein.
»Lass ihn, Winnetou!«, sagte Oriole leise. »Er braucht den Schlaf dringend, wir sollten ihn ruhen lassen.«
Winnetou schüttelte den Kopf.
»Es ist der Schlaf des Todes, mein Bruder. Sieh sein Gesicht, und du erkennst, wie sich die Weißbemalte Frau ihm nähert. Sie hat schon seine Hand ergriffen, Oriole.«
Ergriffen betrachteten die beiden beim flackernden Feuerschein das Gesicht des Mannes, der sich Chowilawu nannte.
Doch die kurze Pause hatte ihm genügt, erneut schlug er die Augen auf, sah sich verwundert um und schien sich dann zu besinnen. Zugleich huschte ein scharfer Zug über sein Gesicht, erneut hatten ihn die Schmerzen gepackt.
»Hört mich an, Brüder … ich habe vor vielen Monden meinen Stamm verlassen. Es war Unrecht von mir, denn ich folgte … dem Lockruf der weißen Männer.«
Chowilawu strengte jedes Wort an, erneut hielt er inne und holte tief Luft, bevor er fortfuhr: »Sie versprachen mir … Pferde und Gewehre … Ich hatte nichts und wollte doch … heiraten. Also folgte ich den Männern, die auf der Suche nach dem Gold der Apachen waren …«
»Du sprichst vom Gold unseres Volkes?«, antwortete Winnetou erschrocken, und der Sterbende antwortete nur mit dem Schließen seiner Augen. Rasch griff der junge Krieger zu dem ausgehöhlten Kürbis mit ihrem Wasservorrat und setzte ihn vorsichtig an die Lippen des Jägers. Aber das meiste Wasser lief ihm aus dem Mund, und Winnetou musste aufpassen, dass er sich nicht dabei verschluckte.
»Es ist gut, mein … junger Bruder. Chowilawu hat nicht mehr … viel Zeit. Er sieht die Weißbemalte Frau, die ihm zulächelt. Nur eines sollt ihr wissen … Wir fanden Gold bei dem alten … Hüter. Einer der Männer tötete ihn … sofort. Drei Mexikaner dabei, Brüder. Als sie das Gold in der Höhle sahen, wollten die anderen auch mich … töten, aber ich entkam …«
Seine Stimme wurde immer leiser und erstarb schließlich in einem Röcheln.
»Wer sind diese Männer, Chowilawu? Sprich mit uns!«, rief Winnetou aufgeregt und beugte sich dicht über den Kopf des Sterbenden, um jede Silbe zu hören, die noch über dessen Lippen kam.
Es dauerte diesmal so lange, dass die beiden jungen Krieger schon fürchteten, dass der Jäger an seinen schweren Verletzungen verstorben sei, als sich plötzlich seine Lippen noch einmal bewegten.
Winnetou hielt sein Ohr dicht an den Mund des sterbenden Jägers und vernahm seine letzten Worte.
»Der … Anführer … nneezi … M…Brad…«
»Ich verstehe dich nicht, wie ist sein Name?«
Ein Zittern durchlief den geschundenen Körper, der Jäger streckte sich und sank dann mit einem leisen Seufzer zurück.
»Zu spät!«, sagte Winnetou leise und sah den Toten mitleidig an.
Schließlich erhob er sich und trat vor den Höhleneingang, um seinen Blick hinauf zu den Sternen zu richten. Seine Gedanken wanderten zu den Ahnen, von denen ihm die Alten erzählt hatten. So stand er lange Zeit sinnend und sah auch nicht zu seinem Jugendfreund Gaagé, als der neben ihn trat.
Auch Gaagé hatte inzwischen seinen Kriegernamen erhalten und hieß nun Oriole. Die beiden waren auf einem Jagdzug unterwegs, als sie in der Nähe des Wasserloches den Schuss hörten und gleich darauf den Kampf zwischen Chowilawu und dem zweiten Puma erlebten. Sie kamen zu spät, auch wenn sie den männlichen Puma erschossen. Wie es sich jetzt erwiesen hatte, waren die Verletzungen des Jägers zu schwer.
»Was sagt mein Bruder zu dem Vorschlag, dass wir den Jäger hier bei der Höhle begraben? Dort drüben ist ein abgestorbener Baum, den wir leicht mit unseren Äxten ausgraben können. Anschließend legen wir ihn in die vertiefte Aushöhlung und setzen den Baum darüber wieder an seinen Platz, so, wie es uns die Alten gelehrt haben.«
Oriole nickte.
»So machen wir das beim Sonnenaufgang, Winnetou. Wir richten seinen Kopf nach Süden aus, und unter diesem Baum findet der Jäger eine würdige Stätte. Ich möchte ihm auch beide Puma-Felle dazu legen.«
»Uff, mein Bruder spricht meine Gedanken aus.«
Stumm begannen beide, den Toten für die Beerdigung vorzubereiten. Zunächst wurde sein Körper auf die Seite gedreht, die Beine zusammengeschoben, danach nahmen beide die Rohhautriemen von den Pferden, mit denen sie eine mögliche Jagdbeute befestigen wollten. Mit ihrer Hilfe wurde der Tote so zusammengebunden, dass er mit angezogenen Beinen in das Grab gelegt werden konnte.
Die beiden jungen Männer sprachen während der gesamten Vorbereitung kein einziges Wort, denn jeder von ihnen wusste ohnehin, was zu tun war. Sie waren etwa zwei Tagesritte vom Pueblo der Mescalero entfernt, und es wäre für alle nicht einfach geworden, den toten Jäger bis dorthin auf den Pferden zu transportieren. Zudem hatte der Mann vor Jahren sein Volk verlassen und ein unstetes Leben geführt. Eine Beerdigung nahe der Stelle, wo er den Tod durch den Puma gefunden hatte, war eine natürliche und zudem übliche Maßnahme bei den Apachen.
Als der Tote für die Beerdigung am nächsten Tag bereit war, nahmen die beiden noch immer schweigend ihre Decken vom Boden auf, wickelten sich hinein und legten sich neben das langsam niederbrennende Feuer. Die Nächte waren zu dieser Zeit bereits sehr kalt, und die beiden jungen Männer, die keine besonderen Ansprüche stellten, schliefen bis zum ersten, hellgrauen Schimmer am Horizont. Dann erhoben sich beide, nahmen ihre kurzen Äxte in die Hand und begannen ihr trauriges Werk.
Der Boden erleichterte ihr Vorhaben. Er war locker und gut löslich, sodass es keine Schwierigkeiten gab, den toten Baumstamm auszugraben und beiseitezulegen. Danach hoben sie die Grube weiter aus, bis der Tote genügend Platz hatte, um dort seine Ruhestätte zu finden. Als die beiden Krieger die Felle dazu gelegt hatten und den Baumstumpf wieder über dem Toten aufrichteten, war es nur noch das Werk einer knappen halben Stunde, und nichts erinnerte mehr an das Begräbnis.
2. Kapitel
Die drei Männer waren abgestiegen und hatten ihre Pferde in den Schatten der Felsen geführt, ihre Vorderbeine zusammengebunden und rasteten nun hier, um der größten Hitze der Mittagszeit zu entgehen. Der älteste der drei Männer trat noch einmal zu seinem Pferd, nahm aus der Satteltasche eine kleine Dose und öffnete sie. Gleich darauf hob er einen Vorderhuf auf und bestrich ihn mit einer übelriechenden Salbe.
»Oh mein Gott, Dad! Das ist ja nicht auszuhalten!«, rief einer der beiden jüngeren lachend, und der so Angesprochene drehte seinen Kopf zu ihm.
»Ich weiß, das Zeug riecht ekelhaft. Aber es hilft, wie ja meistens die schlecht riechende oder schmeckende Medizin die beste sein soll.«
»Ich setzte mich trotzdem etwas aus dem Wind!«, lachte der zweite der jüngeren Männer. »Es geht zwar kaum ein Windhauch, aber ich habe das Gefühl, dass ich auf einem Haufen mit verfaultem Fleisch sitze.« Er wedelte bei seiner Bemerkung mit der Hand vor der Nase, und nun rieb der Vater auch das andere Bein ein.
»Ihr habt gut reden, Jungs, aber mein alter Mustang macht mir Kummer. Wir haben noch gut zwei Tagesritte vor uns, und ich möchte nicht, dass er mir zuvor schlappmacht!«
Josias Parker, genannt Old Hatchet, hatte es im Nahkampf mit dem kleinen, indianischen Tomahawk zu einer wahren Meisterschaft gebracht. Er schleuderte die Axt blitzschnell aus dem Handgelenk heraus, und sie fand immer ihr Ziel. Sein markantes Gesicht, von Wind und Wetter kräftig gebräunt und gezeichnet, ließ doch nur Spekulationen über sein Alter zu. Er mochte vielleicht vierzig Lenze zählen, seine beiden Söhne, die ihm wie aus dem Gesicht geschnitten schienen, wohl knapp sechzehn und achtzehn Jahre.
Er war groß und wirkte bei jeder seiner Bewegungen geschmeidig wie ein geschulter Krieger. Wer ihn ansah, konnte häufig dem Blick aus seinen dunkelblauen Augen nicht lange standhalten. Josias Parker, Old Hatchet, war ein Westmann, der das Land vom Norden bis zum Süden, vom Osten bis zum Westen kannte. Jetzt sah man ihm jedoch die Strapazen eines langen Rittes an. Staub bedeckte ihn wie seine Söhne von Kopf bis Fuß, und seine schulterlangen, braunen Haare wirkten verfilzt und hingen ihm in Strähnen bis auf die Schultern.
Wenn der Vater sonnengebräunte Haut besaß, soweit man das bei seinem ledernen Jagdhemd, den nach indianischer Art gefertigten Leggins und den Mokassins sehen konnte, so waren seine beiden Söhne um einen Schatten dunkler. Nur wer ihnen sehr aufmerksam ins Gesicht sah, erkannte dort den indianischen Einfluss ihrer Mutter, die allerdings selbst einen zarten Bronzeton aufwies. Parker hatte Ha-o-zinne, eine Verwandte von Intschu tschuna geheiratet, und bewirtschaftete eine Farm, die im Gebiet der Sioux lag. Lange Zeit hatte er mit seinen Nachbarn große Probleme, zumal Häuptling Scha-tunga von den Yankatou-Sioux immer wieder auf der Farm auftauchte, wenn Josias nicht anwesend war.
Während der Farmer noch einmal beide Beine mit einer weiteren Schicht aus dem Behälter einrieb, schweiften seine Gedanken zurück an die letzte Begegnung mit dem Sioux, die nun schon einige Monate zurücklag.
Scha-tunga wollte Old Hatchets Frau um jeden Preis in sein eigenes Lager verschleppen und drohte den Parkers, dass er sein Ziel noch erreichen würde. Und dann war es eines Tages tatsächlich beinahe zu der Entführung gekommen.
Josias arbeitete schon seit dem frühen Morgen auf einem etwas entfernter gelegenen Feld, um vor einem heranziehenden Unwetter noch die Maiskolben zu ernten.
Ha-o-zinne nutzte die Zeit und säuberte gründlich den Dielenboden ihres massiven Blockhauses, als ein Schatten durch die geöffnete Tür auf sie fiel. Sie blickte rasch auf und erkannte den Sioux, der sein Pferd vor dem Haus anhielt und eben absteigen wollte, als die Frau des Hauses auch schon die stets griffbereite Doppelbüchse von der Halterung über der Tür gerissen hatte und auf ihn anschlug.
Mit dem wilden Ausruf ihrer Muttersprache, die der Sioux natürlich nicht verstand, schrie sie ihm entgegen: »Doo shaa nadaa da – stör mich nicht!« Das war noch eine freundlich gemeinte Warnung, aber als Scha-tunga sich davon nicht aufhalten ließ, sondern Anstalten machte, das Haus zu betreten und dabei seinen Tomahawk aus dem Gürtel riss, feuerte Ha-o-zinne auf ihn.
Der Sioux schrie auf, ließ das Beil fallen und fasste zu der Wunde in seiner Schulter, aus der das Blut herablief. Er starrte die Frau mit weit aufgerissenen Augen an, machte aber keinerlei Anstalten, zu verschwinden.
Ha-o-zinne hob die Doppelbüchse und richtete sie jetzt direkt auf den Kopf des Sioux. Ihr fiel ein Wort ein, das ihr Mann dem lästigen Besucher einmal nachgerufen hatte, und schrie es jetzt mit aller Kraft.
»Ablúštą!«, was so viel wie ›verlassen‹ bedeutete. Auch wenn sie es nicht richtig anwandte, dieses Wort und die noch immer drohende Waffe mochten den Ausschlag geben.
Scha-tunga drehte sich zu seinem Mustang um und zog sich etwas mühselig hinauf. Als er aus dem Augenwinkel bemerkte, wie sich die begehrte Frau nach dem Tomahawk bückte, dass er aus der kraftlos gewordenen Hand fallen gelassen hatte, unternahm er noch einen weiteren Versuch. Er griff nach dem Gewehr, das über dem Pferdehals in einer Lederschlaufe hing und wollte es auf Ha-o-zinne richten, aber die Apachenfrau schoss den zweiten Lauf auf ihn ab und traf ihn diesmal in den Oberschenkel.
Der Mustang ging mit dem Sioux durch, als sein Reiter Mühe hatte, sich auf dem Rücken zu halten, und von diesem Tag an ließ er sich nie wieder auf der Farm blicken. Alarmiert durch die Schüsse kamen die vier Parker vom Feld gelaufen, aber da war Scha-tunga nur noch ein Schemen am Horizont, während Ha-o-zinne die abgefeuerten Läufe in aller Ruhe erneut lud.
»Dad? Noch etwas Kaffee?«
Josias schreckte aus seinen Gedanken auf und blickte zu seinen Söhnen, die eben an einem kleinen, wenig rauchenden Feuer eine Kanne Kaffee zubereitet hatten. Der Farmer wischte sich mit dem Hemdärmel den Schweiß aus dem Gesicht und trat zu seinen Söhnen. Als er sich bückte, um den dampfenden Becher entgegenzunehmen, pfiff etwas dicht über ihn, schlug klatschend gegen einen der Felsen und fuhr mit einem unangenehmen Jaulen zur Seite.
»Deckung!«, schrie er und warf sich gleichzeitig zu Boden.
Die drei Männer hatten ihre Gewehre griffbereit neben dem Feuer liegen, und jeder brachte sie jetzt in Anschlag. Als Josias vorsichtig um seinen Felsvorsprung spähte, konnte er keinen Gegner auf der Ebene ausfindig machen. In diesem Moment blitzte es allerdings schräg von einer Anhöhe auf, und gleich darauf schlug das Geschoss so dicht neben ihm in den Felsen, dass kleine Steinsplitter in sein Gesicht spritzten und ein unangenehmes Gefühl hinterließen.
Old Hatchet hatte jedoch genug gesehen. Er zog sich zurück, lehnte sein Gewehr griffbereit an den Felsen und war gleich darauf bei seinem Mustang, um ein anderes Gewehr aus der Umhüllung zu holen. Joshua und Noah Parker mussten sich nicht zu ihm umdrehen. Es war ihnen klar, dass ihr Vater die Sharps holte, denn der unbekannte Schütze befand sich in einer Entfernung, die für ihre Gewehre zu groß erschien. Während Josias jetzt den Fallblockverschluss mit der Hebelbewegung in die geöffnete Hand fallen ließ und gleich darauf lud, feuerten die Brüder abwechselnd in die Richtung, in der sie das Mündungsfeuer gesehen hatten.
Dann war Josias fertig, nahm seine Position wieder ein, richtete das Visier auf und legte an. Jetzt stand Noah Parker neben seinem Vater, steckte seinen breitrandigen Hut auf einen dürren Ast, den er von der Feuerstelle genommen hatte, und bewegte ihn rasch über dem Felsen.
Der feindliche Schütze reagierte sofort, und mit einem anerkennenden Pfiff quittierte Noah den Treffer, mit dem sein Hut vom Ast gerissen und ein Stück hinter ihn geschleudert wurde.
Was sich jedoch wie ein Schuss auf der Ebene angehört hätte, war der Doppelknall beider Schützen. Old Hatchet hatte eine Bewegung bemerkt und sofort den Stecher gedrückt, sodass jetzt nur ein leichter Fingerdruck genügte, um den Schuss zu lösen.
Ob er getroffen hatte, war für die drei Männer hinter ihren Felsen nicht auszumachen, aber gleich darauf klatschte erneut eine Kugel gegen die Felsen.
»Es sind mindestens zwei Mann!«, verkündete Josias gelassen. »So schnell kann niemand nachladen. Der Knall in der Ferne und die Art des Auftreffens der Geschosse sagen mir, dass dort drüben eventuell ebenfalls eine Sharps im Einsatz ist oder aber der Bursche eine andere Scharfschützenwaffe besitzt. Wird nicht einfach für uns werden, schätze ich!«
In aller Ruhe lud er erneut seine Berdan-Sharps.
Er hatte bereits das verbesserte Modell von Christian Sharps erworben, das bei A. S. Nippes in Philadelphia gefertigt wurde.
»Hast du etwas erkennen können, Dad?«
»Nein, ging zu schnell. Jetzt warten wir ab, bis wieder geladen wurde. Joshua, kannst du etwas seitlich von deiner Position noch Deckung finden?«
Der ältere Sohn verschaffte sich einen raschen Überblick und erwiderte dann:
»Wenn ich schnell bin, kann ich den dreieckigen Felsen erreichen. Von dort habe ich auch ein besseres Schussfeld.«
»Kein Risiko, Sohn, das ist es nicht wert!«
Ein Schuss hallte herüber, das Klatschen der Kugel auf das Gestein folgte, und Noah schoss zurück.
»Warte noch!«, rief sein Vater, aber in dem Augenblick schnellte sich sein Ältester bereits hoch und war hinter dem Felsen, als eine weitere Kugel unmittelbar gegen seine neue Deckung schlug. Josias grunzte ärgerlich. »Ich hatte doch gesagt …«
Der Rest seiner Worte ging im Brechen seines Schusses los, und diesmal schien er sein Ziel gefunden zu haben.
Es war zwar kein Schrei auf der anderen Seite zu hören, aber jetzt brach ein wütendes Stakkato von dort los, knatterte kurz auf und verstummte wieder.
Der alte Parker lachte.
»Scheint nicht mehr viel los zu sein, dort drüben!«, bemerkte er während des neuerlichen Ladens. »Jetzt nehmen sie schon ihre Revolver und werfen damit nur den Sand auf. Dafür weiß ich jetzt sicher, wo sie sich befinden. Hört mir zu, ihr beiden!«
Old Hatchet hatte noch nicht ausgesprochen, als er erneut seine Sharps abfeuerte und sofort nachlud.
»Bindet das Packpferd los und treibt es hinaus!«
»Aber – Vater! Wir können doch jetzt hier in dieser Lage keines der Tiere entbehren!«, antwortete Noah erstaunt.
»Tu es, Noah! Wir sitzen hier sonst noch ewig fest, und ich möchte die Sache beenden. Vertrau mir, ich weiß, was ich tue!«
Die Brüder wechselten einen raschen Blick, dann lief Noah in gebückter Haltung zu den Pferden hinüber, löste die Beinfesseln des Packpferdes und hielt es am Halfter.
Auf ein Zeichen seines Vaters schlug er dem Tier auf die Kruppe, sodass es erschrocken wieherte und davonjagte.
Ihre Feinde feuerten sofort in die Richtung des davongaloppierenden Pferdes, während Old Hatchet plötzlich neben den Felsen trat und feuerte.
»Vater!«, schrie Joshua erschrocken auf, aber da kniete der schon wieder hinter dem Felsen und lud erneut.
»Alles in Ordnung, Söhnchen. Den Schweinehund habe ich jedenfalls erwischt.«
Sein zuversichtliches Lächeln beruhigte die Söhne, und tatsächlich fiel auf der anderen Seite kein weiterer Schuss mehr.
Schließlich versuchten die Brüder noch einmal den Trick mit ihren Hüten, aber auch dadurch ließ sich keiner der unsichtbaren Gegner aus der Deckung locken.
»Dad? Was tun wir?«
»Warten. Irgendwann … nein, ich korrigiere mich. Auf die Pferde!«
Die drei sprangen auf und eilten zu ihren Mustangs, lösten die Fesseln und schwangen sich auf die Rücken. Josias Parker preschte als Erster um die Felsen, und es war Noah, der einen Schreckensruf ausstieß, als er seinen Vater so ohne jegliche Deckung sah.
Gleich darauf waren die Söhne neben ihm, und jetzt erkannten sie auch, weshalb ihr Vater offenbar jegliche Vorsicht fahren ließ. Seitlich von der Anhöhe, von der sie unter Beschuss genommen waren, stieg eine kleine Staubwolke auf, und nach den ersten einhundert Yards, die sie im gestreckten Galopp zurücklegten, erkannten sie den Reiter, der sein Pferd zu höchster Anstrengung vorantrieb.
Jetzt begann eine wilde Jagd, bei der keiner der drei Parker noch zu der Anhöhe blickte. Für sie war klar, dass von dort keine Gefahr mehr drohte, wenn der andere Mann sein Heil in der Flucht suchte. So ging es eine Weile über die trockene, staubige Ebene, und der Flüchtling war in dem aufgewirbelten Staub kaum auszumachen, als Josias Parker seinen Mustang zügelte, abstieg und seine Sharps an die Wange nahm.
Sofort waren auch seine Söhne aus dem Sattel, und als der Schuss aus Josias Waffe brach, schien sich der Reiter vor ihnen kaum noch abzuzeichnen. Doch was der alte Parker sah, reichte ihm vollkommen für einen gezielten Schuss aus. Noch bevor seine Söhne wussten, ob er sein Ziel getroffen hatte, war ihr Vater wieder auf dem Mustang und trieb ihn erneut an, ohne sich die Mühe zu machen, die Waffe nachzuladen.
Wenig später sahen sie das reiterlose Pferd, das noch eine Strecke weitergelaufen war, als sein Reiter schon aus dem Sattel gestürzt und sich dabei mehrfach überschlagen hatte. Jeder der drei Parker hatte einen Revolver in der Hand, als sie sich dem regungslosen Mann näherten. Aber diese Vorsicht war unnötig, der Mann war tot. Rasch stiegen die beiden Söhne ab, packten den Toten und legten ihn über den Sattel seines Pferdes, das ihr Vater eben heranführte.
»Ein Mexikaner!«, stellte Josias nach einem Blick in das Gesicht des Mannes fest. »Auch seine Kleidung deutet darauf hin. Was machen diese Burschen hier im Gebiet der Apachen, ihrer Todfeinde? In den vielen Jahren, in denen die Apachen bei ihren Streifzügen immer wieder mexikanische Siedlungen überfielen und ihre Frauen raubten, ist doch wohl genug geschehen. Wollten diese Verbrecher Vergeltung üben?«
Schließlich ritten sie zu der Anhöhe, von der die Schüsse gefallen waren. Dabei verteilten sich die drei so, dass jeder von ihnen auf einer anderen Seite hinaufritt, um für eventuelle Überraschungen gesichert zu sein.
Sie trafen fast gleichzeitig bei dem Mann ein, der auf dem Bauch lag, die abgefeuerte Waffe neben sich. Josias warf nur einen kurzen Blick auf den Schützen, dann bückte er sich nach der Waffe und hielt sie seinen Söhnen entgegen.
»Seht euch das an, Jungs! Eine kurze, aber gezogene Steinschlossbüchse mit einer solchen Reichweite!«
Während Noah interessiert die Waffe betrachtete, die ihm sein Vater in die Hand legte, bemerkte der hinter sich eine Bewegung. Mit einer einzigen, fließenden Bewegung stieß Josias seinen Sohn beiseite, fuhr auf dem Absatz herum und schleuderte das kurze, scharf geschliffene Beil auf seinen Gegner.
Mit einem seltsamen Laut brach der Mann zusammen, der sich eben aufgerichtet hatte und seinen Colt Paterson spannen wollte. Die Axt spaltete ihm den Schädel und warf ihn zurück, noch bevor er den Hahn seiner Waffe bewegen konnte.
»Das nächste Mal schaut euch den Mann an, den ihr für tot haltet!«, sagte Josias gleichgültig und riss seine Axt aus dem Schädel des Toten.
»Aber, Dad, du selbst …«
»Schon gut, Joshua. Ich habe selbst nicht aufgepasst!«
»Na, ich danke! Aber jedenfalls war das ein Meisterstück des Mannes, den man Old Hatchet nennt, Dad!«, erwiderte Noah, der ein wenig blass geworden war. Aber als ihm sein Bruder auf die Schulter klopfte, musste er ebenfalls lachen. Das befreite sie und brachte sie nun dazu, sich um die Sachen der beiden Männer zu kümmern, die ihnen hier auf so heimtückische Weise aufgelauert hatten.
Auch dieser Mann war einwandfrei mexikanischer Abstammung. Sein Gesicht mit dem mächtigen, schwarzen Schnurrbart und den dichten Augenbrauen ließen keinen Zweifel offen.
»Eine Brieftasche!«, verkündete Joshua, der den Toten untersucht hatte. Er reichte die dünne Ledertasche an seinen Vater, der sie öffnete und gleich darauf verwundert auf einen vergilbten Zeitungsartikel sowie einen Steckbrief starrte.
»Das ist nicht möglich!«, sagte er dabei leise und überflog den Text ein zweites Mal.
»Was hast du da, Dad?«
Nachdenklich blickte Josias erst seine Söhne an, dann den Toten.
»Es ist ein undatierter Zeitungsartikel über den Tod von Fred. Und … noch etwas … ein Zettel mit einer fast unleserlich verwischten Handschrift. Ich kann nur Bruchstücke entziffern. ›später…Eigentum der Peraltas … Ranchero…‹ Mehr kann ich nicht entziffern. Seltsam, Peralta, der Name ist uns doch vertraut, denke ich. Und – Moment, ich sehe gerade hier ganz unten, schon vom häufigen auffalten des Blattes fast völlig gelöscht – das könnten zwei Buchstaben sein, ein M und ein … B. Verdammt, Jungs, wisst ihr, was das bedeutet?«
Josias Gesicht war dunkelrot angelaufen, seine Hand mit den beiden Zetteln zitterte. Es war Noah, der jüngere der beiden Brüder, der ihm jetzt beide aus der Hand nahm und einen Blick darauf warf. Als er beides dann an seinen Bruder weiterreichte, sagte er mit fast tonloser Stimme:
»Eine Nachricht von Matt Bradley an einen seiner Genossen, offenbar die Einladung zu einem Treffen in der Nähe des Ranchos. M.B. ist für mich ein klarer Hinweis. Aber – Moment noch – der Steckbrief.« Er faltete ihn auseinander und stieß ein lautes »Ha!« aus. »Ein handgeschriebener Steckbrief aus Mexico, und er hat offenbar nicht lange im Freien gehangen. Hier kann man noch die ausgerissenen Befestigungslöcher sehen. Vermutlich haben die Verbrecher ihn gleich nach dem Entdecken abgerissen.«
»Was steht da, Dad? Du kannst ja die Sprache lesen«, erkundigte sich Joshua. Sein Vater las ihnen den Steckbrief vor.
»Gesucht – tot oder lebendig: Die Peralta-Brüder Rodriguez, Garcia und Diandro wegen vierfachen Mordes und schweren Raubes. Hohe Belohnung! Ausgestellt in Presidio Paso del Norte vom dortigen Bürgermeister. Da haben wir wohl die richtigen Galgenvögel erwischt und viel Glück dabei gehabt.«
»Presidio Paso? Wo liegt der Ort, Dad?«, erkundigte sich Noah und kratzte dabei ausgiebig seinen Hinterkopf.
»Gleich hinter der Grenze, Noah.«
»Dann wollten diese drei Peralta-Brüder wohl zu der Goldmine, die einem ihrer Familienmitglieder gehört hat?«, überlegte Joshua Parker laut. »Stellt euch das vor – drei Verbrecher aus Mexiko suchen nach der Goldmine eines Vorfahren! Und unterwegs nehmen sie noch alles mit, was sie greifen können, morden aus dem Hinterhalt und fühlen sich vollkommen sicher dabei. Und dann diese seltsamen Gewehre!«
»Kommt, lasst uns die Spur wieder aufnehmen, die wir erst kürzlich verloren haben!«, ergänzte Noah.
»Stopp!«, bremste ihn aber sein Vater, als er schon die Hand auf den Sattel seines Pferdes legte. »Du willst doch nicht im Ernst zurück zu Sam Pattern? Wir haben die Umgebung abgesucht, die Bande von Bradley ist längst nicht mehr in den Bergen bei der Mine dieses Mexikaners, der ja den gleichen Namen hat. Wir müssen vielmehr dorthin, wohin diese beiden Mörder unterwegs waren!«
Joshua sah seinen Vater an, als hätte der eben vorgeschlagen, dass sie zum Mond hinaufreiten wollten.
»Wie sollen wir denn wissen, wohin die beiden unterwegs waren, Dad?«, erkundigte sich auch Noah ungläubig.
Josias Parker zeigte ein überlegenes Lächeln.
»Ich bin ein wenig enttäuscht, meine Söhne! War ich doch bislang der Meinung, zwei aufgeweckte junge Burschen aufgezogen zu haben. Aber jetzt kommt ihr noch nicht einmal auf das Naheliegendste!«
Die Brüder wechselten einen raschen Blick, schwiegen aber.
»Was liegt denn hier in einer Linie? Zudem in der Richtung, in der der zweite Mann fliehen wollte?«
»Nichts, Vater! Jedenfalls keine Stadt oder Ansiedlung!«, antwortete Joshua schließlich und zuckte die Achseln.
»Falsch!«, antwortete sein Vater. »Die beiden waren ganz offenbar auf dem gleichen Weg wie wir unterwegs, als sie uns bemerkt haben müssen. Und es wurde ihnen sofort klar, dass es sich bei drei Reitern in dieser einsamen Gegend nur um die Parkers handeln konnte! Wenn sie zu Bradleys Bande gehören, wissen sie auch von uns. So, und nun packt die Gewehre dieser Meuchelmörder mit auf die Pferde und helft mir dabei, die Toten zu begraben.«
Die drei Männer machten sich an die Arbeit, und eine Stunde später trieben sie ihre Pferde den Hügel hinab.
»Ich kann nicht glauben, dass diese Verbrecher unterwegs zum Pueblo waren«, gab Noah zu Bedenken. »Das wäre doch Wahnsinn, Intschu tschuna würde sie sofort gefangen nehmen!«
»Ja, natürlich!«, erwiderte sein Bruder. »Vorausgesetzt, er hätte geahnt, um was für Burschen es sich handelte! Wenn sie ihm aber irgendeine schwer durchschaubare Lügengeschichte auftischten, so konnten sie annehmen, dass er ihnen gastlich Aufnahme gewährte.«
»Na, da bin ich mir nicht so sicher, Noah! Schließlich gärt es bei den Apachen, und wäre es Intschu tschuna nicht gelungen, seine Ansprüche bei Goyaałé durchzusetzen –, ich würde hundert zu eins wetten, dass sich die Apachen sämtlich auf dem Kriegspfad befänden!«
Sein jüngerer Bruder lachte still vor sich hin, während sie zu ihrem Vater aufschlossen.
»Was lachst du?«
»Wenn ich mich an unseren letzten Besuch bei unserem Onkel erinnere, Brüderchen, dann war es nicht Intschu tschuna, der sich gegen Goyaałé durchgesetzt hat, sondern unser lieber Cousin Haadi’a, der sich mit seiner Tat den Namen Winnetou verdient hat!«
»Alter Besserwisser!«, lachte nun auch Joshua, denn natürlich hatten sie die Geschichte im Pueblo erfahren und die kaum verheilten Brandwunden des jungen Kriegers gesehen. Sie verheilten jedoch dank der hervorragenden Wundsalbe sehr gut und man war sich sicher, dass mit den schon wieder kräftig nachwachsenden Kopfhaaren auch die letzten Brandnarben verschwinden würden.
Der junge Apache hatte außergewöhnlichen Mut bewiesen, als er durch den brennenden Ölsee geschwommen war. Aber Goyaałé, den die Weißen Geronimo nannten, war ein harter Mann, der sich sehr sicher war, dass niemand in der Lage war, den brennenden See zu durchqueren.
Er sollte sich nicht nur darin in Intschu tschuna und Winnetou geirrt haben.
3. Kapitel
»Da sind Spuren. Unbeschlagene Pferde. Mit Sicherheit in diesem Gebiet Apachen. Nicht viele kennen diese Wasserstelle!«
Old Hatchet benötigte nicht viel Zeit für diese Feststellungen.
Die Hufabdrücke waren noch immer deutlich, was darauf schließen ließ, dass sie kaum älter als zwei Tage sein konnten. Trotzdem griffen die drei Männer zu ihren Gewehren, sicherten nach allen Seiten, als sie ihre Pferde vorwärtstrieben. Aber hier schien es keine Gefahr mehr zu geben. Ein sanfter, warmer Windhauch strich von den Bergen herüber und war kaum stark genug, den Staub aufzuwirbeln. Es gab kaum Schatten hier, nur ein paar Yard weiter, bei den nächsten Felsen, schien es angenehm kühl zu sein. Aber zunächst tränkten die Parkers ihre Pferde. Neben dem Packpferd hatten sie auch die beiden Pferde der Heckenschützen mitgenommen, auf denen deren Habseligkeiten, in Decken gewickelt, lagen.
Während seine Söhne die Pferde zum Wasser führten, sah sich Josias gründlich um. Er bemerkte den kaum verborgenen Eingang zu der Höhle, in der Winnetou und Oriole die Nacht mit dem Toten verbracht hatten.
Die beiden Brüder machten sich gegenseitig auf die tiefen Spuren der Puma-Pfoten aufmerksam, die noch im feuchten Uferrand des Wasserlochs deutlich zu erkennen waren. Auch der aufgewühlte Bereich der Kampfstätte war noch zu erkennen, einschließlich einiger großer, dunkler Flecken.
Als Joshua und Noah die Wasserschläuche gefüllt hatten und die Pferde laute Geräusche beim Saufen von sich gaben, gingen sie zu ihrem Vater und versuchten, herauszufinden, was er gerade entdeckt hatte. Sie folgten seiner Blickrichtung, sahen den Höhleneingang, wussten aber nicht so recht, was sie davon halten sollten. Schließlich deutete ihr Vater auf einen abgestorbenen Baum dicht bei der Höhle.
»Dort haben sie ihn begraben.«
Seine Stimme klang wie immer, seine Entdeckung schien ihn nicht sonderlich aufgewühlt zu haben. Den Blick, den die Brüder wieder einmal rasch wechselten, bemerkte er wohl und ergänzte:
»Wieder einmal habt ihr keine Ahnung, wovon ich rede. Aber ihr müsst doch die dunklen Flecken am Wasserloch bemerkt haben, die aufgewühlte Erde darum herum, schließlich die geradezu überdeutlichen Spuren rund um das Wasserloch!«
Joshua blickte erstaunt zu den Pferden, die sich gar nicht genug satt trinken konnten an dem doch warmen Wasser. Er verstand nicht, was sein Vater meinte, denn eben hatten die Brüder noch über die Spuren gesprochen.
Ihr Vater lachte laut auf.
»Da hat man nun zwei fast schon erwachsene Söhne, die ihrem nachgeborenen Bruder ein Vorbild sein sollen. Man nimmt sie auf jede Jagd mit, lässt sie Spuren lesen und Erfahrungen sammeln, immer in der Hoffnung, dass der kleine Isaak von ihnen alles erlernt, was ihr Vater weiß. Und das Ergebnis? Kaum wird es mal Ernst, kaum müssen die beiden selbst sehen und dann das Gesehene mit ihrem Wissen vereinen, da – passiert gar nichts mehr!«
Die beiden schwiegen betroffen, schließlich räusperte sich Joshua und antwortete mit belegter Stimme: »Das ist nicht recht von dir, Vater. Noah und ich sind deine Schüler, und wir lernen jeden Tag von dir. Und unser junger Bruder Isaak wird von uns stets einbezogen. Du willst von uns wissen, was wir aus den Spuren sehen können, und ich sage dir, dass an diesem Wasserloch zwei Apachen gelagert haben. Und es waren junge Krieger, noch nicht sehr erfahren, aber sicher auf einem Zug, der ihnen Ehre bringen sollte.«
Josias Parker nickte stumm, aber eine weitere Gemütsbewegung verriet sein gebräuntes Gesicht nicht. Ebenso gut hätte ihm jemand sagen können, dass auch heute wieder die Sonne schien. Also bemühte sich sein Ältester, mehr von seinen Beobachtungen mitzuteilen. Er hatte sich das Beste zum Schluss aufgehoben, wohl wissend, dass er damit seinen Vater beeindrucken würde.
»Ich gehe davon aus, dass es sich um Apachen handelte, denn andere Indianer wagen sich nicht so weit in dieses Gebiet hinein. Es gab hier einen Kampf mit einem Puma, möglicherweise auch mit einem weiteren Tier, denn die Spuren weisen unterschiedliche Größen auf. Aber ich kann dir noch mehr verraten, Vater. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Winnetou hier gewesen ist. Zusammen mit seinem besten Freund, Oriole.«
Damit schlug er die Arme unter und musterte mit zufriedener Miene seinen Vater.
Josias Parker blieb bei seiner Antwort vollkommen gelassen.
»Das ist eine kühne Behauptung, Joshua. Ich möchte aber keine kühnen Behauptungen von dir hören, sondern Beweise für das, was du als Schlussfolgerung verkünden kannst!«
Joshua Parker hatte sich rasch gebückt und hielt jetzt triumphierend einen winzigen, schmalen Gegenstand zwischen seinen Fingern dicht vor das Gesicht seines Vaters.
Der fixierte den Gegenstand nur kurz, dann nickte er und antwortete:
»Na und? Eine Stachelschweinborste, weiter nichts. Tausende solcher Borsten wurden von den Indianern verarbeitet. Was bringt dich auf den Gedanken, dass ausgerechnet Winnetou mit seinem Freund an diesem Wasserloch war?«
Joshua richtete sich stolz auf und hielt die Borste weiterhin hoch.
»Das, Dad, ist eine gefärbte Borste, wie sie an den Mokassins von Winnetou verwendet wurde. Ich weiß, dass ihm seine Schwester Nscho-tschi weiche Mokassins fertigte, wie sie bei den Plainsindianern üblich sind. Die Apachen tragen zumeist seitlich geknöpfte Stiefel mit harter Sohle. Winnetou wünschte sich einmal, als wir im Pueblo der Mescalero zu Gast waren, Mokassins mit weicher Sohle, die ein leichteres Anschleichen ermöglichen, und Nscho-tschi versprach ihm ein solches Paar. Ich habe es gesehen, bevor sie es ihrem Bruder schenkte. Sie hatte ihre Arbeit mit besonders gefärbten Stachelschweinborsten versehen. Ich staunte darüber, weil ich solche Arbeiten bislang nur bei den Indianern der Plains und Prärien gesehen hatte. Aber Winnetou konnte die Arbeit seiner Schwester gar nicht genug loben, und das hat sich bei mir eingeprägt.«
Bei den letzten Worten lächelte Josias breit.
»Gut gemacht, Sohn. Aber weiter – was habt ihr noch entdeckt?«
»Die Höhle!«, antwortete Noah spontan, aber sein Vater winkte mit der rechten Hand ab. Den Eingang zu der Höhle hätte jeder vom Wasserloch aus bemerkt.
»Ja, und daneben, der abgestorbene Baum, Vater! Die noch erkennbar aufgeworfene Erde beweist, dass man an dem Baum gegraben hat.«
Jetzt war Josias bereit, seinen Söhnen wieder uneingeschränkt zu glauben. Sie hatten die Probe bestanden – Joshua und Noah waren gut im Spurenlesen. Nein, mehr noch, der Mann, den viele mit seinem Kriegsnamen Old Hatchet bezeichneten, wusste, dass sie in der Lage waren, aus den vorgefundenen Spuren die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Josias Parker war stolz auf seine Söhne.
»Wir werden die beiden schwerlich noch vor dem Pueblo einholen. Was mir ein wenig Sorge bereitet, ist die Frage, was die beiden Mordschützen dort wollten. Gut, das Raten bringt uns nicht weiter. Wenn die Wasserschläuche gefüllt sind, lasst uns aufbrechen.«
Die Parker-Söhne hatten die aus Ziegenhäuten gefertigten Wasserschläuche an den Sätteln befestigt und jedem der Pferde eine Handvoll Hafer aus dem mitgeführten Vorrat verabreicht. Jeder von ihnen hätte wohl gern noch etwas im Schatten der Felsen ausgeruht, aber das ließ Josias nicht zu. Er wollte so schnell wie möglich zu Intschu tschuna reiten und sich davon überzeugen, dass im Pueblo alles in Ordnung war.
4. Kapitel
Lautes Kinderkreischen empfing Nscho-tschi, als sie aus ihrer Tür trat. Sie lächelte freundlich, denn die Kinder hatten sie immer wieder gebeten, ihnen noch einmal die Geschichte von Coyote zu erzählen, der das Feuer brachte. Es war eine uralte Geschichte, die immer von den Alten weitergegeben wurde. Nscho-tschi hatte sie schon von ihrer Großmutter gehört, und als sie jetzt dem Drängen der Kleinen nachgab und sich zu ihnen auf die terrassenartige Plattform in den Schatten setzte, schweiften ihre Gedanken kurz ab zu ihrer Mutter, die sie schon so früh verloren hatte. Es waren dann ihre Großeltern, die sich liebevoll um den Jungen mit dem Namen Haadi’a und seine Schwester Nscho-tschi kümmerten.
Haadi’a!, dachte sie und richtete unwillkürlich ihren Blick zum Horizont. Mein Bruder nun als stolzer Krieger mit den Namen Winnetou! Was hat er nicht riskiert, um seinem Vater und unserem Volk Ehre zu machen!
»Hat 'ii baa nadaa? –Was machst du, Nscho-tschi? Du sollst uns die Geschichte von Coyote erzählen, dem Trickster, und wie das Feuer zu unserem Volk kam!«, rief eines der älteren Mädchen, und Nscho-tschi verdrängte ihre schwermütigen Gedanken, und ein freundliches Lächeln zeichnete sich auf ihren bronzefarbenen Wangen ab. Jeder konnte erkennen, dass dieses heranwachsende Mädchen eine Schönheit wurde. Ihre samtschwarzen Augen blitzten die Kinder wie herausfordernd an, dann schüttelte sie ihre langen, bläulich-schwarzen Zöpfe einmal heftig, als wolle sie sich im Scherz weigern, die oft gehörte Geschichte zu erzählen.
Lautes Kreischen der Mädchen war die Reaktion, und Nscho-tschi begann mit der uralten Geschichte. »'Iłk'idáͅ, koͅoͅ yá'édiͅná'a. 'Ákoo Tł'ízhe hooghéí dá'áíná bikoͅ' 'ólíná'a. –Vor langer Zeit gab es kein Feuer. Dann hatten nur diejenigen, die Fliegen genannt werden, Feuer.«
Weiter kam sie jedoch nicht, denn lautes Hundebellen am Rand ihres Dorfes ließ alle Köpfe hochfahren.
»Da kommen Reiter!«, rief eines der Mädchen und zeigte auf die sich rasch nähernde Gruppe.
»Mein Bruder ist zurück, und mit ihm auch Oriole. Aber sie haben noch ein fremdes Pferd dabei! Ich muss hinunter und sehen, was es gibt, Kinder – wir erzählen ein anderes Mal weiter!«
Mit diesen Worten war Nscho-tschi bereits an dem eingekerbten Balken angelangt, der von dieser Terrasse auf die nächste führte. Behände wie ein Eichhörnchen kletterte sie daran hinab, aber die anderen Mädchen folgten ihr auf dem Fuß.
Natürlich hatten die Wächter die Ankunft der Reiter noch lange vor den Hunden bemerkt und zum Pueblo signalisiert. Aber die älteren Krieger wussten, dass ihnen keine Gefahr drohte und blieben gelassen bei ihren Tätigkeiten.
Nur Intschu tschuna war aus einer Tür getreten, denn er brannte darauf, seinen Sohn zu begrüßen. Während der Abwesenheit der beiden jungen Krieger war ein Bote zu den Mescalero gekommen, der wenig gute Nachrichten aus der Nachbarschaft brachte.
»Wem gehört das Pferd, mein Sohn?«, empfing er Winnetou, als der vor ihm vom Pferd sprang und ihn ehrerbietig begrüßt hatte. Die kühle Zurückhaltung, die sein Vater als oberster Häuptling aller Apachen in der Öffentlichkeit zeigte, stand im Widerspruch zu seinen leuchtenden Augen, mit denen er liebevoll seinen staubbedeckten Sohn musterte.
»Das gehörte Chowilawu, den Ndołkah im Kampf getötet hat«, antwortete Winnetou knapp.
»Chowilawu? Der Mann, der zu den Weißen ging und sein Volk verriet?«, antwortete der Häuptling, und sein Gesicht verfinsterte sich dabei. »Wo ist sein Körper?«
»Wir haben ihn am Wasserloch der Erde übergeben.«
Damit war die Angelegenheit für den Häuptling wohl erledigt. Er wandte sich ab und trat zurück in das Pueblogebäude, und die beiden jungen Männer brachten die Pferde zu der Koppel, in der sie Futter fanden und sich erholen konnten.
Winnetou zögerte, ob er seinen Vater erneut ansprechen sollte, denn er hatte wohl bemerkt, dass sich einige der älteren Krieger in dem Raum eingefunden hatten. Deshalb stand er abwartend in der Tür und spähte in das Halbdunkel des Raumes, bis ihn sein Vater aufforderte, einzutreten.
»Du wirst es ohnehin gleich erfahren. Eine Gruppe Weißer ist erneut in unserem Gebiet unterwegs. Ich hatte gehofft, dass nach dem Abzug der Männer aus der alten Goldmine nun Ruhe herrschen würde, aber es sieht danach aus, als hätten sie nur neue Arbeiter angeworben. Sie haben die alte Mine zwischen unserem Pueblo und dem Rio Pecos entdeckt, einen guten Tagesritt von hier entfernt.«
»Lass mich als Kundschafter aufbrechen, Vater!«, bat sein Sohn spontan, aber Intschu tschuna machte eine abwehrende Handbewegung.
»Nein, das ist nicht erforderlich. Es sind bereits Späher zurückgekehrt und haben uns berichtet. Die Weißen werden heute gegen Abend den Rio Pecos erreichen und dort übernachten. Anschließend reiten sie zur Mine, und wir werden sie dort stellen, wenn sie ihre Arbeit aufgenommen haben.«
Damit war das Gespräch für Winnetou beendet.
Sein Vater hatte sich dem Rat wieder zugewandt und erörterte mit den erfahrenen Kriegern das weitere Vorgehen gegen die weißen Eindringlinge.
Nachdenklich kehrte Winnetou zu seinem Freund Oriole zurück.
Die beiden waren über das Geschehen bei der Goldmine informiert, wenn sie auch selbst an dem Zug der Krieger nicht teilgenommen hatten. Winnetou lag zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Krankenlager und kämpfte gegen das heftige Fieber, und Oriole wurde die Teilnahme einfach verweigert.
Nach der Rückkehr vom Heiligen Ölsee, den Goyaałé für die Mutprobe anstecken ließ, waren die Mescalero erst zum Rancho von Sam Pattern geritten, um mehr über die Goldsucher zu erfahren. Als sie sich dann behutsam dem Lager in den Bergen näherten, fanden sie dort keinen lebenden Menschen mehr vor. Es hatte offenbar eine wilde Schießerei unter den Männern gegeben, die Toten lagen noch dort, wo sie im Kampf gestorben waren.
Es gab zwar deutliche Pferdespuren der geflüchteten Überlebenden, aber nach kurzer Verfolgung war es auch den erfahrensten Kriegern nicht mehr möglich, die Spuren auf dem felsigen Untergrund zu verfolgen. Man durchstreifte noch längere Zeit die gesamte Umgebung, aber die Geflohenen waren wie vom Erdboden verschwunden.
Wenn nun ein erneuter Zug weißer Goldsucher in das Gebiet der Mescalero eindrang, so konnte das nur eines bedeuten: die Vernichtung dieser Männer, die nur weitere Goldgierige nachziehen würden. Winnetou unterrichtete Oriole von dem Gehörten, und die beiden Jungkrieger konnten ihren Tatendurst nicht mehr länger dämpfen. Sie waren gerade dabei, sich ein paar Maisfladen zu holen, um dann den Weißen entgegenzuziehen, als sie von einer freundlichen Stimme angesprochen wurden.
»Es ist doch nicht das, was ich gerade denke?«
Auf der ersten Terrasse stand lächelnd eine schiefe Gestalt und sah sie mit freundlichen Augen an. Aber die beiden Jungkrieger wussten, dass ausgerechnet Klekih-petra sie bei ihrem heimlichen Aufbruch beobachtet hatte.
Der kleine, hagere und bucklige Mann mit dem scharfgeschnittenen Gesicht hatte sein dunkles, bis auf die Schultern hängendes Haar gelöst, und ein leichter Wind wehte ihm trotz des Stirnbandes eine Strähne ins Gesicht, die er aber nicht beachtete. Gekleidet war er wie nahezu alle Apachen, das heißt, er trug ein leichtes, dunkel gefärbtes Leinenhemd und dazu nur einen Lendenschurz. Seine Füße steckten in den wadenlangen Apachenstiefeln mit harter Sohle.
»Weißer Vater!«, begrüßte Winnetou ihn, und es war ihm anzusehen, dass er sich überrascht fühlte. »Oriole und Winnetou werden den weißen Männern entgegenreiten. Wir wollen bei den anderen sein, wenn wir sie vernichten.«
Klekih-petra hob seine rechte Hand.
»Ist das im Sinne von Intschu tschuna?«, erkundigte er sich, und die beiden jungen Apachen wichen seinem Blick aus. »Gut, das dachte ich mir. Ich kann auch verstehen, dass es euch nach Taten drängt. Aber ein Krieger ist nicht nur ein wilder Kämpfer, der hinausreitet und seinen Gegner zum Kampf stellt. Ihr müsst lernen, besonnen zu handeln und an euer Volk zu denken!«
Winnetou richtete sich hoch auf und sah seinen Lehrer wieder direkt an.
»Das tun wir beide, Klekih-petra! Wir wollen unsere Frauen und Kinder vor den Weißen schützen, die nichts in unserem Land verloren haben! Es ist immer das gelbe Metall, dass sie anlockt. Seit den Tagen, in denen der Mexikaner die Mine in den Bergen entdeckte, versuchen sie es immer wieder. Aber jetzt ist Schluss damit!«
Entschlossen griff der Krieger seine Büchse auf, aber die Worte seines Lehrers verhinderten, dass er sich umdrehte.
»Ihr seid junge Männer und habt euch euren Namen verdient. Aber es gibt mehr als nur den Kampf. Ihr müsst auf den Rat hören, bei dem sich erfahrene Krieger um euren Häuptling Intschu tschuna versammeln. Glaubt mir, meine Freunde –, ich habe in meinem Leben schon viele Gefahren überstanden, aber ich habe durch mein Verhalten, das eurem ähnelte, viele Menschen gefährdet. Ja, als ich meine Gefolgsleute auf die Barrikaden und gegen die Soldaten führte, habe ich gewusst, dass ich wenig im Kampf erprobte Männer in den Krieg führte, den wir kaum gewinnen konnten. Heißes Blut führt zu nichts, damals wie heute nicht. Überlegt mit ruhigem Sinn, bevor ihr zur Waffe greift, und hört auf den Rat der Alten!«
Die beiden Freunde wechselten einen raschen Blick, dann senkte Winnetou erneut seinen Blick und sagte mit leiser Stimme:
»Du hast recht, weißer Vater. Wir werden gehorchen und abwarten, bis uns mein Vater zu den Kämpfern ruft.«
»Das ist gut, das höre ich gern. Und wenn ihr jetzt zu mir heraufkommt, können wir gemeinsam das Essen einnehmen. Die Maisfladen könnt ihr für später aufheben.«
Winnetou fühlte sich beschämt, denn Klekih-petra hatte offenbar jeden ihrer Schritte beobachtet. Aber er war seinem Lehrer dankbar für sein Eingreifen. Sicher würden sie sich später den Kriegern anschließen dürfen, wenn es gegen die Goldsucher ging.
Als die Freunde jetzt der Aufforderung folgen wollten und zur Leiter gingen, entdeckten sie eine Gruppe junger Mädchen, die dort beisammenstand und sich angeregt unterhielt. Winnetou entdeckte seine Schwester unter ihnen, die gerade mit der ebenfalls ausgesprochen hübschen Nah-de-yole sprach. Beide schauten zu ihnen herüber, und während Winnetou seine Hand hob, um die Mädchen zu grüßen, wandte Oriole sich verlegen ab und drängte sich an ihm vorbei, um als Erster die Leiter zu erklimmen.
»Hast du gesehen, dass Nah-de-yole dir zunickte?«, neckte Winnetou deshalb den Freund.
»Sie hat dich gegrüßt. Mich übersieht sie selbst dann, wenn wir uns mitten im Dorf begegnen!«, erwiderte Oriole mit seltsamer Stimme und vermied es, den Freund anzusehen.
Der lachte nur leise vor sich hin und murmelte etwas wie, dass man vom Schamanen etwas erbitten könne, das die Aufmerksamkeit der jungen Frauen erweckt.
Oriole tat, als hätte er nichts verstanden.
Doch das nächste Problem für die beiden jungen Mescalero war nicht weit von ihnen entfernt. Gerade erklärte Winnetou dem Freund seine Gründe, nun doch nicht aufzubrechen, als von einer niedrigen Plattform ein spöttischer Ruf erklang.
»Die beiden Turteltauben wieder vereint!«
Winnetous Kopf flog herum, Zorn ließ seine Stirn runzeln, dann sah er Lozen, die ihn mit einem provozierenden Lächeln ansah.
»Lozen, du schon wieder im Pueblo der Mescalero? Deine Sehnsucht nach mir muss ja ungeheuer sein. Ich hatte gehofft, dich erst wiedersehen zu müssen, wenn dich das Alter gramgebeugt macht!«, antwortete Winnetou spottend.
»Was ist nur mit euch los? Muss erst eine Kriegerin kommen, um euch aufzufordern, den Weißen bei der alten Goldmine die Pferde zu stehlen?«
Jetzt trat auch ihr ständiger Begleiter aus dem Raum hinter ihr und stellte sich neben Lozen. Chuchip sah zu ihnen herunter, und auch in seiner Miene spiegelte sich die Verachtung für die beiden Mescalero-Krieger.
»He, was wollt ihr von uns, Lozen? Denkst du, du musst nur mit den Fingern schnipsen wie die Weißen, wenn sie ein Bier bestellten?«, erkundigte sich Winnetou.
Die Kriegerin stieß ein verächtliches Zischen aus.
»Als ob du jemals gesehen hättest, wie der weiße Mann ein Bier bestellt!«, antwortete sie dann. »Das Gold in den Bergen gehört nicht den Mexikanern, und schon gar nicht diesen Verbrechern, den Brüdern Peralta! Sie haben den Standort damals von dem Verräter Chowilawu erfahren, der hohen Lohn bekommen sollte. Die Mexikaner hatten einen Mann namens Matt Bradley dabei, der schon die andere Mine von ihnen gewonnen hatte. Sie haben neue Arbeiter um sich gesammelt und werden jetzt das Gold der Apachen stehlen!«
»Warum erzählst du uns das alles, Lozen?«, erkundigte sich Winnetou.
»Weil ich euch daran erinnern will, dass es sich in beiden Fällen um das Gold handelt, das unserem Volk gehört. Wir wollen es aber nicht, und die Weißen sollen es nicht bekommen. Deshalb reite ich jetzt mit Chuchip zu ihnen und stehle ihnen die Pferde. Ohne die Tiere kommen sie von dort nicht weg. Es ist ein Marsch von gut zwei Tagen zum Rio Pecos, und nach Albuquerque ist es noch weiter. Sie werden dort elend in der Sonne sitzen müssen und nach wenigen Tagen sterben.«
»Den Plan hatten Oriole und ich ebenfalls. Ihr könnt uns gern begleiten, Lozen!«, gab Winnetou trocken zurück und schlug den Weg zum Pferdecorral ein.
»Das ist nicht dein Ernst, Pimo!«, rief eine aufgebrachte Lozen hinter den beiden Freunden her. Aber dann beeilte sie sich, den Balken hinunterzuklettern und ihnen nachzueilen.
Ob ihr Chuchip dabei folgte wie ein Hund oder nicht, war ihr wieder einmal vollkommen gleichgültig. Doch der junge Krieger folgte ihr, ohne zu zögern sofort nach –, wie er es immer tat.
5. Kapitel
Der Mann, der eben den Trading Post betrat, sah aus wie jemand, dem sein Beruf buchstäblich ins Gesicht geschrieben schien. Die hagere Gestalt in dem schwarzen, staubigen Anzug wirkte wenig vertrauenserweckend. Aber ein Blick in das scharf geschnittene Gesicht, das den Betrachter sofort an einen Geier erinnerte, musste auch den vertrauenswürdigsten Menschen erschüttern. Schon die krumme Nase erinnerte an einen Schnabel, dazu kam seine Kopfform, die jetzt durch den breiten Hut ein wenig runder wirkte als sie tatsächlich war.
Die kleinen, flinken Augen huschten hin und her und schienen alles zugleich zu erfassen. Als er jetzt seinen Hut abnahm und sich mit einem wenig sauberen Taschentuch über das Gesicht fuhr, wirkte diese Geste fahrig und als wollte sich der Fremde nur einen Augenblick Zeit gönnen, um die Anwesenden rasch zu mustern.
Genau das tat Pete Thompson in diesem Augenblick auch, und ein zynisches Lächeln umspielte seine schmalen Lippen, als er die beiden Farmer in der Ecke bemerkte, die sich gerade ein paar Würfel geben ließen. Ein dritter Mann, dessen schäbiges Äußeres auf einen langen Ritt durch die Wildnis schließen ließ, nahm eben bei ihnen Platz, als der Lederbecher mit den Würfeln auf den Tisch gestellt wurde.
Pete Thompson kannte den Mann aus seiner Zeit in den Spielhöllen von Mosquito Gulch, einer elenden Zeltstadt der Goldgräber in Kalifornien. Als der Spieler kurz zu dem Fremden sah, blitzte es auch in dessen Augen auf, aber er machte keinerlei Anstalten, Pete zu begrüßen.
»Whisky!«, forderte er und trat an den langen Tisch, auf dem sich allerlei Waren stapelten. Es gab neben Stoffballen und einer kleinen Holzkiste mit Nägeln auch zwei dickbauchige Gläser mit Zuckerstangen.
Während der Storekeeper eine Tonflasche entkorkte und dem neuen Gast einen Fingerbreit einer dunkelbraunen Flüssigkeit einschenkte, beobachtete Pete das Geschehen im Raum mithilfe eines fast blinden Spiegels, der vor langer Zeit einmal an der Wand hinter dem Tisch angenagelt worden war. Aber was Pete dort sah, reichte aus, um ihn vor einer möglichen Überraschung zu bewahren. In seinem Beruf war es besser, sich den Rücken freizuhalten.
Als er das schmierige Glas aufnahm und prüfend gegen die durch die offene Tür scheinende Sonne hielt, schüttelte er den Kopf.
»Was soll das sein, Mister?«, erkundigte er sich und schnüffelte behutsam daran.
»Whisky, was sonst?«, kam die mürrische Antwort. Noch bevor Pete eine barsche Antwort geben konnte, griff der stämmige Storekeeper unter den Tisch und legte eine Doppelbüchse demonstrativ vor sich. »Macht einen halben Dollar, Mister.«
»Schöne Waffe!«, antwortete Thompson und starrte auf die abgesägten Läufe.
»Trifft auch gut!«, antwortete der stämmige Mann hinter dem Tisch und legte seine linke Hand darauf.
»Ich kenne mich mit diesen Dingern ganz gut aus!« Pete Thompson gab sich den Anschein, ein Fachgespräch über Büchsen zu führen. »Hast du die Federn erneuert? Ich frage aus gutem Grund. Wenn du nämlich das Ding unter deinem Tisch ständig mit gespannten Hähnen liegen hast, ist die Büchse nicht nur auf kurze Distanz sehr gefährlich, sondern könnte auch bei der geringsten Erschütterung losgehen.«
Bei diesen Worten verzog sich sein Geiergesicht auf seltsame Weise, und der Storekeeper blickte von der Waffe zu ihm und wieder zurück.
Schließlich fiel ihm seine Forderung wieder ein.
»Halber Dollar, Mister!«
»Gegenvorschlag!«, antwortete Thompson und zog einen kleinen Leinenbeutel aus der Tasche seines Gehrocks, öffnete die Bänder und schüttelte sich ein paar ansehnliche Gold-Nuggets in die offene Hand. »Du stellst mir hier einen Krug mit Whisky deiner besten Sorte hin, und ich zahle mit Gold. Aber keinen Pence für diese stinkende Brühe, die du mir da eingeschenkt hast.«
Der Wirt starrte mit gierigem Blick auf das Gold, dann griff er entschlossen unter den Tisch mit den Auslagen und den verschiedenen, ungespülten Bechern und Gläsern und stellte einen anderen, dunkelbraunen Tonkrug vor seinen Gast. Thompson griff ihn, zog den Korken heraus und schnupperte daran.
»Hm, das scheint mir nun in der Tat ein besseres Zeug zu sein. Also, abgemacht!« Damit schob er ihm ein Nugget-Stück hinüber, nahm den Krug und einen leeren Becher, um damit hinüber zu den Würfelspielern zu gehen. Der Storekeeper holte aus einem Regal eine Goldwaage und beeilte sich mit dem Auswiegen des Nuggets.