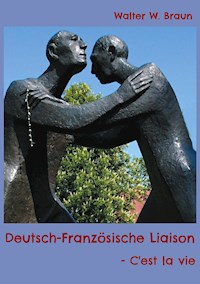7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Wort Amok kommt aus dem Malaiischen und bedeutet toben, randalieren, durchdrehen. Es ist ein Gewaltakt, bei dem wahllos Menschen getötet werden sollen und der eigene Tod billigend in Kauf genommen wird. Vor einem halben Jahrhundert wurde vielen Verhaltensstörungen wie Autismus oder ADHS noch keine Aufmerksamkeit geschenkt, sie wurden allenfalls als Modekrankheiten abgetan. Die Betroffenen wurden im Umgang als schwierig empfunden und dementsprechend stigmatisiert. Wenn neben Unverständnis, gepaart mit Ausgrenzung, noch Anfeindungen und Mobbing hinzukamen, konnte es leicht zu einer menschlichen Tragödie kommen, zum Suizid, oder zum großes Aufsehen erregenden Vorfall, wie in dieser fiktiven Geschichte beschrieben. Die Tragik trifft den oder die Betroffenen selbst, wie die Gesellschaft allgemein, die fassungslos auf solche Ereignisse reagiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Ein missglückter Tag im März
2 Tage im Krankenhaus
3 Schwierige Kindheit
4 Eine eigene Wohnung
5 Heirat in Baden-Baden
6 Neuer Job in Karlsruhe
7 Probleme in der Ehe
8 Trennung
9 Rachegedanken machen sich breit
10 Die Katastrophe
Vorwort
Das Wort Amok kommt aus dem Malaiischen und bedeutet toben, randalieren, durchdrehen. Es ist ein Gewaltakt, bei dem wahllos Menschen getötet werden sollen und der eigene Tod billigend in Kauf genommen wird.
Vor einem halben Jahrhundert wurde vielen Verhaltensstörungen wie Autismus oder ADHS noch keine Aufmerksamkeit geschenkt, sie wurden allenfalls als Modekrankheiten abgetan. Die Betroffenen wurden im Umgang als schwierig empfunden und dementsprechend stigmatisiert. Wenn neben Unverständnis, gepaart mit Ausgrenzung, noch Anfeindungen und Mobbing hinzukamen, konnte es leicht zu einer menschlichen Tragödie kommen, zum Suizid, oder zum großes Aufsehen erregenden Vorfall, wie in dieser fiktiven Geschichte beschrieben. Die Tragik trifft den oder die Betroffenen selbst, wie die Gesellschaft allgemein, die fassungslos auf solche Ereignisse reagiert. Asperger-Syndrom
Das Asperger-Syndrom (AS) ist eine Variante des Autismus und wird zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen gerechnet. Merkmale sind einerseits Schwächen in der sozialen Interaktion sowie Kommunikation und andererseits stereotypes Verhalten mit eingeschränkten Wünschen gegenüber anderen Lebensinteressen. Wie alle Autismusstörungen gilt das Asperger-Syndrom als angeboren und nicht heilbar und das macht sich etwa vom vierten Lebensjahr an bemerkbar.
Beeinträchtigt ist vor allem die Fähigkeit, nichtsprachliche Signale (Gestik, Mimik, Blickkontakt) bei anderen Personen zu erkennen, diese auszuwerten (zu mentalisieren) oder selbst auszusenden. Das Kontakt- und Kommunikationsverhalten von Personen mit Asperger-Autismus kann dadurch merkwürdig und ungeschickt erscheinen. Da ihre Intelligenz in den meisten Fällen normal ausgeprägt ist, werden sie von ihrer Umwelt leicht als wunderlich wahrgenommen. Gelegentlich fällt das Asperger-Syndrom aber auch mit einer Hoch- oder Inselbegabung zusammen.
Das Asperger-Syndrom ist nicht nur mit Beeinträchtigungen, sondern oft mit gewissen Stärken verbunden (etwa in den Bereichen der Wahrnehmung, der Selbstbeobachtung, der Aufmerksamkeit oder phänomenalen Gedächtnisleistungen). Ob es als Krankheit oder als eine Normvariante der menschlichen Informationsverarbeitung eingestuft werden sollte, wird von Wissenschaftlern und Ärzten sowie von Asperger-Autisten und ihren Angehörigen uneinheitlich beantwortet. Uneinig ist sich die Forschergemeinschaft auch darüber, ob man im Asperger-Syndrom ein qualitativ eigenständiges Störungsbild oder eine abgeschwächte Variante des frühkindlichen Autismus sehen sollte. Grundbedingung für die Diagnose eines Asperger-Syndroms ist jedoch, dass es zu Beeinträchtigungen in mehreren Lebensbereichen kommt (siehe Kriterium C im DSM).
Im DSM-5 der ICD-11 (Neufassung der ICD von 2018) wurde die Klassifikation von Autismus deutlich geändert. Man gab die traditionellen Subtypen (z.B. frühkindlichen Autismus, atypischen Autismus oder das Asperger-Syndrom) ganz auf und fasst nun alle Erscheinungsformen in einem allgemeinen Spektrum autistischer Erkrankungen (autism spectrum disorders, ASS) zusammen. Grund hierfür war die zunehmende Erkenntnis in der Wissenschaft, dass eine klare Abgrenzung von Subtypen (noch) nicht möglich ist – und man stattdessen von einem fließenden Übergang zwischen milden und stärkeren Autismus-Formen ausgehen sollte.
(Quelle: Wikipedia)
1
Ein missglückter Tag im März
Der neue Tag begann für Jean-Claude Schmidt frühmorgens überhaupt nicht gut. Erschrocken wachte er aus dem tiefen Schlaf auf, den er nach endlosem Grübeln und im nicht stillstehenden Gedankenkarussell mit nervigen Streitgesprächen gefangen, erst bei Tagesanbruch hatte finden können.
Ungläubig schaute er hoch zur Decke, wo über ihm, wie zum Hohn, die dorthin reflektierten Ziffern der elektrischen Funkuhr mit Weckfunktion in strahlendem Rot leuchteten. Schonungslos signalisierte sie einen winzigen Teil seines gehetzten Daseins, eine Sekunde, eine Minute, die unaufhaltsam weiterliefen und ins Meer der Ewigkeit versanken, wie schon alle Sekunden und Minuten seines Lebens davor. „Kann das denn sein, warum wurde ich nicht durch das Wecksignal wach, habe ich den Uhrwecker gestern Abend nicht betätigt? Ist dieses Mistding defekt oder habe ich den Signalton im Schlaf nur nicht gehört? Die Uhr zeigte unerbittlich 7.30 Uhr an.
Bestürzt sprang er aus dem Bett und stieß sich dabei auch noch ungeschickt mit dem Knie an die Bettkante. Ein stechender Schmerz durchzuckte ihn und ließ ihn laut fluchend aufheulen. So’en Saich aber au.“ „Verdammt, erst habe ich verschlafen und nun auch noch dieses elendige Missgeschick, oh, sind das Schmerzen“, schimpfte Jean-Claude Schmidt laut, während er mit der Hand die schmerzende Stelle am Knie massierte, die Zähne zusammenbiss und wütend auf sich selber war. Er hätte sich ohrfeigen können, doch ihm blieb keine Zeit, sich in der Selbstbemitleidung zu ergehen, endlos nach der Ursache des Verschlafens zu forschen und sich unnötige Gedanken darüber zu machen, warum die Uhr ihn nicht geweckt oder er den Signalton nicht gehört hatte. Wenn’s schiefläuft, dann geht’s garantiert immer auch richtig schief.
Spätestens um 7 Uhr hätte er das Haus verlassen sollen, um rechtzeitig am Bahnhof anzukommen und die Regio-Schwarzwaldbahn um 7.21 Uhr nach Karlsruhe zu erreichen. Noch während er sich anzog, trank er nebenbei eine Tasse Kaffee, den er sich schnell dampfend und zischend aus dem modernen WMF-Kaffee-Vollautomaten hatte laufen lassen und dessen aromatischer Duft den Raum durchströmte.
„Dammi nochemol“, schimpfte er noch missmutiger und noch ärgerlicher, weil er sich zu allem Übel auch noch an dem heißen Getränk schmerzhaft den Mund verbrannt hatte. „Solche Tage sollte man glatt wegschmeißen, einstampfen, ausradieren, Kruzifix aber au“, bruddelte er wütend vor sich hin und machte seinem Ärger damit Luft.
„Was habe ich eigentlich von diesem Scheißleben, was habe ich davon? Morgens missmutig aufstehen, tagsüber sich plagen und mit Dummschwätzern abgeben müssen. Ein Tag so elend, so öd und fad wie jeder andere.“ Die depressiven Anwandlungen benebelten wieder sein Gehirn und lähmten ihn, machten ihn mutlos und verzagt. Aber in seinem innersten Wesen meldete sich dann doch wieder eine Stimme, leise zwar, aber hörbar, die ihn mahnte: „Bleib ruhig alter Freund, sonst passiert noch wirklich etwas Schlimmes. Nimm‘s doch gelassen. Schau ins Licht und nicht in die Dunkelheit. Jeder neue Tag birgt sein eigenes Geheimnis und irgendwo wartet ein neues Glück auf dich.“
Solche positiven Gedanken vermochten an diesem Tag nicht den Deckel der Schwermut, seines immer wieder hochsteigenden Weltschmerzes zu durchstoßen. Sein Denken wurde nur unterbrochen vom notwendigen Aufbruch, denn er musste jetzt schleunigst los und das Haus verlassen. Während er in den zweiten Ärmel seines Mantels schlüpfte, war er schon mit schnellen Schritten auf dem Weg, holte das Auto aus der Garage, um den nächsten Zug um 7,58 Uhr noch zu erreichen. Mit dem Fahrrad, das er sonst allgemein für die Strecke nahm, war das von Bühl-Eisental aus nicht mehr zu schaffen. „Jetzt komm, gib Gas, lass es laufen“, mahnte er sich selbst. „Das wird verdammt eng. Hoffentlich komme ich jetzt gut vorwärts, treffe auf keine Hindernisse und nicht alle Ampeln springen vor meinen Augen auf Rot.“ „He, mach zu, du Dolle“, schimpfte er hinter dem Lenkrad, als ein etwas älterer Herr mit Hut in seinem Uralt-Mercedes nicht schnell genug vorwärtskam. Hören konnte dieser ihn nicht und ob er beim Blick in den Rückspiegel seinen wütenden Ausdruck und seine Gestik sehen konnte, ist nicht gewiss oder sogar höchst unwahrscheinlich.
„Wenn ich diesen Zug auch nicht mehr bekomme, müsste ich entweder die Straßenbahn nehmen, doch dann verliere ich weitere Zeit und komme noch später ins Büro. Oder ich muss mit dem Auto nach Karlsruhe-Knielingen fahren, und das im dichten Berufsverkehr, bei den ständig nervigen Staus auf dem berühmt-berüchtigten Abschnitt zwischen Rastatt und Karlsruhe auf der Autobahn A5.
Unterwegs wurde es nicht besser, alles schien an diesem Tag wie verhext und brutal gegen ihn zu laufen. Die ganze Welt wollte anscheinend an diesem Morgen genau um die gleiche Zeit nach Bühl hineinfahren, und manche waren wohl noch vom Schlaf befallen oder sie hatten es zumindest nicht besondere eilig. Undisziplinierte Fahrradfahrer überholten an Engstellen und Kreuzungen links und rechts, andere verhielten sich unverschämt rücksichtslos, wie wenn sie mit ihren modernen Pedelecs die Vorfahrt gepachtet hätten. Sogar gegen die Verkehrsrichtung erzwangen sie sich ungeniert das Durchkommen.
„Haben heute denn noch mehr verschlafen, sodass jedermann wie gehetzt der Stadt zustrebt, oder wo sonst wollen denn bloß alle zur gleichen Zeit hin, welche Ziele sollen schleunigst erreicht werden?“ Wie schon so oft, beschäftigte ihn in solchen Situationen das Bild, dass auf sämtlichen Straßen in Deutschland genau in diesem Augenblick ein ununterbrochener, zähfließender Strom an unterschiedlichsten Fahrzeugen sich vorwärts bewegt, aufgereiht wie die Perlen an der Schnur. Diese endlosen Kolonnen sind wie die Ameisen, immer in ständiger Bewegung, sie verstopfen die Spuren, bilden kilometerlange Staus und drängen auf den Zufahrtsstraßen als Blechlawine in die Innenstädte. Rast- und ruhelos, Tag und Nacht, bewegt sich der unersättliche Moloch Verkehr durchs Land. Das müssen Millionen sein, die Tag für Tag, Stunde für Stunde von einem Ort zum anderen wollen. „Was sind wir doch für ein mobiles Volks geworden. Alle Welt ist wohl permanent auf Achse unterwegs. Wo soll denn das noch enden, wenn das so weitergeht, wenn immer mehr Autos, Motorräder, Fahrräder auf den Straßen sind, wild durcheinander wuseln, die Luft verpesten, die Nerven strapazieren?“
Gerade noch rechtzeitig erreichte er den Bahnhof, stellte das Auto auf einen parkzeitbegrenzten Platz und hoffte, heute würden die Politessen einmal nicht kontrollieren, oder dass sie schon durchgegangen sind. Dabei war er sich bewusst, das kommt sehr, sehr selten vor. „Garantiert hängt heute Abend, wenn ich zurückkomme, ein Zettel am Scheibenwischer.“ Zu einem der freien Parkplätze jenseits der Bahn hätte es ihm aber zeitlich nicht mehr gereicht. Dann sprang er behände zur schon am Bahnsteig stehenden Bahn, drückte den Türöffner, damit sich die bereits geschlossene Automatik-Abteiltüre noch einmal öffnete, stieg ein und fand im Durchgang auf einem Notsitz noch einen freien Platz, auf dem er sich mit einem inneren Seufzer niedersetzte und durchatmete. „Sisch nochemol gued gonge.“
Jetzt etwas zur Ruhe kommen und tief durchatmen, dabei tropfte ihm der Schweiß von der Stirn und auch sonst fühlte sich sein Körper patschnass an. Schon wurde er aber von allen Seiten durch den aufdringlichen Schwall undefinierbarer Gerüche eingenebelt und belästigt. Sie reizten ihm die Nasenschleimhäute, so schlimm, dass er zwischendurch heftig niesen musste. Und bei dem nervigen Stimmengewirr der vielen Fahrgäste im Abteil, den üblichen Fahrgeräuschen des Zuges, versuchte Jean-Claude seine Gedanken ein wenig zu sortieren, zu kanalisieren, die ihm aber wie lästige Schnaken im Kopf surrten und umkreisten.
In solchen Situationen war seine angeborene Veranlagung ein Nachteil, denn er hörte sehr gut, nahm Geräusche wahr, die allgemein dem Durchschnittmenschen verborgen blieben. „Mein Kopf spricht wieder mit mir“, ging ihm durch den Sinn, und das erfreute ihn nicht. In solchen Situationen ärgerte ihn seine nicht enden wollende Gedankenflut, „der Gedankenkreisel oder das Gedankenkarussell“, wie er das über sich selber gerne nannte. Das waren dann die Augenblicke, an denen ihn die berühmte „Mucke“ an der Wand störte, bei denen er manchmal meinte, es zerreißt ihn, er würde vor Wut und Ärger platzen müssen. Fatalerweise übertrug sich seine miese Laune immer schnell, ohne auch nur ein Wort mit ihnen gesprochen zu haben, auf seine Umwelt. „Sehen die es mir an, wenn mir alles stinkt, können andere meine dunklen Gedanken lesen?“ Sein Selbstwertgefühl hatte aus solchen Erfahrungen schon viele Kratzer abbekommen, es ist schon zerschlissen wie ein alter Teppich.
Die überwiegend jugendlichen Fahrgäste störte natürlich sein Denken nicht, sie beachteten den finster dreinblickenden Mitfahrgast nicht einmal. Jeder hatte genug mich sich selber zu tun, hing den eigenen Gedanken nach oder ging irgendeiner Beschäftigung nach, bis das Ziel erreicht war. Sie befanden sich mehrheitlich wohl alle auf dem Weg zum KIT (Karlsruher Institut für Technologie) in Karlsruhe, an dem sie studierten. Andere strebten den diversen unterschiedlichen Arbeitsplätzen in der badischen Metropole zu. Sämtliche Plätze im Waggon waren besetzt und nicht wenige Fahrgäste mussten im Mittelgang und Durchgang stehen, weil sie keinen Sitzplatz mehr gefunden hatten. Und wohin er blickte, mindestens die Hälfte, die er sah, beschäftigte sich mit ihrem Smartphone, waren im Blick darauf fixiert oder sie hatten Stöpsel in den Ohren und wippten locker, entspannt im Takt der Musikberieselung.
„Wozu habe ich einmal eine kaufmännische Lehre absolviert, später innerhalb von dreieinhalb Jahren das Wirtschaftsdiplom Betriebswirt VWA erworben und noch diverse Buchhalter-Lehrgänge bei der IHK und andere Weiterbildungsmaßnahmen durchlaufen, wenn ich heute den ganzen Tag lang nur Excel-Tabellen erstellen muss, stupide Tätigkeiten zu verrichten habe und der Willkür von dümmlichen Egomanen ausgesetzt bin. Wozu nützt mir mein erworbenes, überdurchschnittliches Wissen, meine berufliche Erfahrung, mein Engagement, wenn es nicht wertgeschätzt wird und ich keine Achtung erfahre. Stattdessen ernte ich immerzu nur Erniedrigungen und Anfeindungen seitens der Vorgesetzten und sogar durch die Kollegen in den Abteilungen. Und das soll ich noch länger als zehn Jahre durchhalten, bis ich endlich in den Ruhestand wechseln kann?“
Wie schon so oft in den letzten Jahren überfiel ihn plötzlich wieder Resignation, tiefe Schwermut und Niedergeschlagenheit, als wenn alles Leid der Welt auf sein Schultern lasten und sämtliche seelischen Schmerzen nur ihn plagen würden.
Offiziell war der „Scho-Clo“, wie man ihn badisch eingefärbt nannte, „Controller“. Seine Aufgaben waren die Erstellung von Verkaufs- und Budgetplänen, Aufbereitung der Zahlen für das Management, Planung und Umsetzung strategischer Maßnahmen, Kontrolle der Zielerfüllung, Prozess- und Schwachstellen-Analyse sowie Soll- und Ist-Vergleiche. Und auf diesem Gebiet war er ein absoluter und anerkannter Fachmann. Längst hatte ihn bei dieser Aufgabe aber die Routine im Beruf eingeholt. Jeden Tag die gleiche stupide Tätigkeit tun, das empfand er schon lange als langweilig und stumpfsinnig.
Die Beschreibung seines Jobs hörte sich für den Außenstehenden furchtbar wichtig oder hochtrabend an, für ihn waren es reine Zahlenspiele und eine ziemlich trockene Materie, was ihn immer mehr frustrierte, je älter er wurde. Zudem fehlte ihm Lob und Anerkennung, die ihm seiner Meinung nach zustehen sollten. Im Gegenteil, seine Tätigkeit war nichts, womit er glänzen konnte, im Vergleich zu den angesehenen Verkaufsstrategen, die obendrauf zum stattlichen Gehalt auch noch jährlich eine satte Prämie für ihre Erfolge einstreichen durften. Viele sahen in seinem Zuarbeiten, die Grundlagen für Entscheidungen der Verantwortlichen, nur einen Angriff gegen ihre Person und auf den eigenen Arbeitsplatz, damit sahen sie in Jean-Claude einen Gegner. In ihren Augen war er das Feindbild schlechthin, obwohl er nicht mehr und nicht weniger als nur die von ihm erwartete Arbeit leistete.
Zudem hatte sich in den letzten Jahren durch die Hintertür immer mehr eingeschlichen, dass ihm die Geschäftsleitung ständig neue Vorgaben aufdrängte, die sich dann teils auch noch widersprachen. Und nicht alles, was man von ihm verlangte, hatte mit seiner eigentlichen Aufgabe zu tun. Mindestens einmal wöchentlich wurde ein langweiliges Meeting anberaumt, in dem die Teilnehmer sich mit schlauen Sprüchen endlos im Kreis bewegten und viele am Tisch taten sich mit Phrasen und Worthülsen nur ungeheuer wichtig.
Ihn zeichnete unbestritten ein hohes Fachwissen aus, er war über Gebühr fleißig und in allen Dingen penibel und gewissenhaft. Was ihm dagegen fehlte, das war Teamfähigkeit. Nicht nur privat war er ein Einzelgänger, im Unternehmen und im Geschäftsbereich, da war er es auch. Das ganze Getue um Teamarbeiten ging ihm total gegen den Strich. Gerne zitierte er bei solcher Gelegenheit die Schwaben mit ihrem oft gepflegten Spruch: „Do bruch Nerve wi’e breide Nudle.“ Oder: „Toll, ein anderer macht‘s“, spottete er gelegentlich, wenn wieder mehr Zusammenarbeit, mehr Informationsfluss untereinander und Kommunikation – was er „wichtigtuerisches Gerede“ nannte – von ihm gefordert wurde. Unbewusst machte es ihm schwer zu schaffen, dass er keine wirklichen Kontakte besaß und erst recht keine echten Freunde. Ihm fehlten die positiven zwischenmenschlichen Beziehungen, und freundschaftliche hatte er noch nie besessen. Wer mit ihm redete, an ihn Fragen stellte, etwas von ihm wollte oder brauchte, begegnete ihm allgemein nur geschäftsmäßig kühl und das wurde meistens auf das Notwendigste reduziert. Das reflektierte vielleicht nur das eigene Verhalten, denn Jean-Claude galt als sehr distanziert, persönlich unnahbar und für manche sogar gefühllos arrogant.
Seine zwischenmenschliche Situation war durchaus ambivalent. Einerseits vermisste er enge und inspirierende Kontakte und beneidete andere, bei denen er das als Bereicherung des Lebens ansah. Andererseits wollte er solche engen Beziehungen nicht eingehen, sie waren ihm eher lästig oder machten ihm Ängste.
Zu den üblichen feierabendlichen Treffs wurde er nie oder sehr selten eingeladen und er wollte das auch nicht. Dass die Ursache vornehmlich an ihm lag, an seinem abweisend wirkenden Verhalten, seinem tiefen Misstrauen gegen jedermann, darauf kam er in keinem Augenblick. Das „Außenvorsein“ belastete ihn aber mehr, als er sich eingestand. Da war er nicht Fisch und nicht Fleisch, doch dem Herzen nach sehnte er sich nach Gemeinschaft und Geselligkeit. Andererseits waren im dem Verstand schon mehr als zwei oder drei Personen auf einem Haufen zu viel, da fühlte er sich unwohl und bedrängt.
Objektiv gesehen konnte man ihm daraus keinen Vorwurf machen, denn sein Verhalten lag weitestgehend an seiner angeborenen Veranlagung, die erst im fortgeschrittenen Alter im Rahmen einer psychologischen Untersuchung erkannt, dann attestiert und bewusst gemacht wurde. Er hatte das Asperger-Syndrom – eine Form des Autismus – 1) und war somit ein Mensch mit tiefgreifender Entwicklungsstörung. Jean-Claude war nur schwer in der Lage seine Gefühle zu zeigen, und steuern konnte er sie schon gar nicht. Wenn ihm etwas missfiel, konnte er ausrasten, wurde jähzornig und ausfallend; war „ein Choleriker“, wie man landläufig sagte. Aus dem gleichen Grund fand er von sich aus auch kaum Kontakte zu anderen Menschen, die ihm etwas bedeutet hätte. Wer aber kannte schon dieses von der Norm abweichende Persönlichkeitsbild?, oder wenn man es kannte, wer konnte als ein Laie Ursache und Wirkung richtig einordnen. Die Frage war doch, ob seine Umwelt überhaupt wusste, was diese psychische Fehlsteuerung überhaupt ist und was sie in einem Menschen auslösen konnte? „Das ist ein Psychopath“, so stempelte man ihn gerne herablassend ab.
Wenn Jean-Claude aber einmal zu jemand Vertrauen gewonnen hatte, auf welche Weise auch immer, war erst einmal ein vertraulicher Kontakt hergestellt, konnte er sehr liebenswert, aufopfernd hilfsbereit und zuvorkommend sein. Das war seine andere Seite, die aber zu selten abverlangt wurde. Zu dem allem wirkte, je älter er wurde, desto mehr, seine nicht optimal verlaufene Kindheit nach, in der er sich störrisch und rechthaberisch gegeben und deshalb mit seinem strengen Vater eine schwierige Beziehung gepflegt hatte. Und mit seinen Lehrern war es auch nicht viel besser gewesen. Da war nicht einer oder eine, mit denen er warm geworden wäre, die für ihn zum Leitbild oder Vorbild dienten. Das alles hat ihn tief geprägt, immer misstrauischer werden lassen, abweisend nach außen und schwer umgänglich.
Kurz gesagt, er hatte sich seit den Kindertagen immer schon mit anderen Menschen sehr schwergetan, ob mit den Kleinen oder den Erwachsenen. Normal auf andere zuzugehen oder mit ihnen ungezwungen locker umgehen, das war ihm schier unmöglich. Deshalb wurde er vom Umfeld bereits als Kind gemieden, man wollte mit dem störrischen Buben nichts zu tun haben. Wer will schon mit einem schwierigen Menschen mehr als es nötig ist Umgang pflegen?
Die einzigen Vertrauenspersonen waren, seit er denken konnte, die Oma, seine Mutter und die beiden älteren Schwestern. Das ging zwar nicht so weit, dass er sich dort ausgeweint hätte. Solche Gefühlsausbrüche waren ihm fremd, aber bei ihnen konnte er einmal offen über alles reden und bei der Mutter durfte er sich auch trostbedürftig an ihre Schultern anlehnen, ohne sich schämen zu müssen. Seit gefühlt ewigen Zeiten, tatsächlich aber erst oder schon – wie man es sehen will – seit knapp 15 Jahren, war er in einem weltweit agierenden Unternehmen im Karlsruher Stadtteil Knielingen beschäftigt. Genugtuung hatte ihm seine Tätigkeit dort eigentlich aber nie bereitet, es war eher die Notwendigkeit einen guten Job zu haben, um ausreichend Geld zu verdienen und damit die Kasse stimmte. In den letzten drei Jahren hatte sich das Klima in der Firma jedoch derart verschlechtert und der Druck von oben ist so massiv gewachsen, sodass ihm seine Tätigkeit zunehmend verhasster wurde, und mit eingeschlossen alle, die damit zu tun hatten, von der Unternehmensleitung angefangen bis zu den Verantwortlichen in die Abteilungen.
Immer wieder kam die Geschäftsleitung mit neuen Vorgaben auf ihn zu und neue Zielerfüllungsmaßnahmen wurden im Monatszyklus ausgegeben, gleichzeitig wurde aber das Personal über Gebühr abgebaut und die Verbliebenen mussten die Arbeit der Ausgeschiedenen in der gleichen Zeit miterledigen. Wie das gehen sollte, das interessierte den Vorstand nicht. „Alles nur purer Aktionismus, Wichtigtuerei von irgendwelchen Schlauberger und Besserwisser“, giftete er zuweilen, und nichts hasste Jean-Claude mehr, als die ständigen Veränderungen. „Kann man denn die Beschäftigten nicht einmal in Ruhe ihre Arbeit tun lassen, der Kreativität die nötige Zeit einräumen und den angeschobenen Entwicklungen Zeit geben? Die sollen doch besser mit ihren Frauen schnakseln, sich hormonell befreien, anstatt die wahren Leistungsträger im Unternehmen mit ihren Gedankenferz drangsalieren.“ Mit solchen Vorwürfen und locker saloppen Sprüchen hielt er auch nicht bei seinen Vorgesetzten hinter dem Berg und damit machte er sich keine Freunde. Und Pluspunkte gab es damit auch keine zu gewinnen.
Unter den aktuell gegebenen Voraussetzungen machte Jean-Claude die Arbeit keine Freude mehr. Noch schlimmer und als ungerechtfertigte Angriffe auf ihn selbst empfand er, dass ihn Kollegen und Kolleginnen, denen er in seiner Stabstelle zugeordnet war, mobbten, für vieles verantwortlich machten, obwohl das tatsächlich überhaupt nicht in seiner Entscheidungsmacht lag. „Offensichtlich halten mich alle für den willkommenen Buhmann bei sämtlichen negativen Entscheidungen, die von der Firmenleitung kommen, oder sie denken, dass sein Controlling der Auslöser und ursächlich für diese Entscheidungen sei. Auch wenn ich in meiner Stellung in einer Schnittstelle zwischen der Geschäftsleitung und der Belegschaft stehe, bin ich nicht für deren Entscheidungen zuständig. Kapiert das eigentlich niemand?“
Durch den täglichen Druck seitens der Geschäftsleitung, wie den Dissonanzen mit den zahlreichen Mitarbeitern im Unternehmen, sowie den eigenen hohen Ansprüchen an seine Leistungen, war er schon lange nervlich bis zum Äußersten angeschlagen und psychisch am Boden. Das ging inzwischen so weit, dass er in den letzten Jahren schon wegen Burnout ausgefallen war. Dabei war er unfähig am Morgen das Bett oder das Haus zu verlassen. Kurzerhand hatte ihn der Hausarzt wegen Depression krankgeschrieben. Nachdem es aber nicht besser wurde, setzte er für Jean-Claude eine mehrere Wochen dauernde Behandlung und Reha-Maßnahme in einer psychosomatischen Klinik durch, in der es gelang, ihn wieder einigermaßen aufzubauen. Statt jedoch auf nur einen Funken Verständnis zu stoßen, wurde er erneut wieder direkt oder indirekt angegriffen. „Du bist ein Faulenzer, machst einen auf krank und wir können deine Arbeit miterledigen“ wurde ihm offen ins Gesicht gesagt oder hinter vorgehaltener Hand zugetragen. Und gerade dieser Vorwurf traf ihn zutiefst, denn jedermann musste objektiv unbestritten zugeben, dass er, wenn er gesund war und man ihn ungestört arbeiten ließ, ein hohes Arbeitspensum zu erledigen vermochte. Wenn es nicht so war, lag die Ursache einerseits an der Arbeit selbst oder an Unstimmigkeiten mit den Vorgesetzten und – wenn man so will – mit der ganzen Welt, aber auch in seiner familiären Situation infolge der Scheidung, die hinter ihm lag.
Begonnen hatte die negative Situation im Unternehmen in dem Augenblick, als vor über vier Jahren eine amerikanische Heuschrecke mit fiskalischen Tricks das Unternehmen erworben hatte und schon in kürzester Zeit viele Abteilungen ratzfatz wegrationalisierte.
„Wir werfen das Geld nicht nur durch die Türe raus, sondern durch ein riesiges Scheunentor. Das muss sich ändern. Da ist jeder Verantwortliche verpflichtet, nach Synergie-Effekten zu suchen und Zeitfresser zu eliminieren. Dabei denke ich zuallererst an die Zigarettenpausen, die vielen unnötigen langen Telefonate, wo man das mit einer kurzen Mail erledigen könnte. Die Abteilungen und die Abläufe müssen verschlankt werden. Alle Tätigkeiten sind effektiver und effizienter abzuwickeln. Gerade vom Controlling erwarte ich, dass mit Argusaugen in jede Ecke geleuchtet, jede Möglichkeit in Betracht gezogen wird. Kommen sie weg vom althergebrachtem Denken, das war gestern“, wetterte der Bereichsvorstand und überall und an allem hatte er etwas auszusetzen. Da war sogar dem Einfältigsten bewusst geworden, dass sie nur Gründe suchten, unliebsame oder teure Mitarbeiter loszuwerden und man versuchte sie aus dem Unternehmen zu drängen oder rauszuekeln.
„Die Direktive der Geldgeber ist, es müssen Millionen an Personalkosten eingespart werden, jede Position ist knallhart auf Effizienz zu überprüfen.“ Diese Vorgabe wurde kurzzeitig radikal und ohne Rücksicht auf gewachsene Strukturen umgesetzt. Die Gesamtheit der Mitarbeiter wurden nicht mehr, wie es früher einmal so schön war, als Leistungsträger des Unternehmens gesehen, sondern nur noch als Kosten – und Kosten muss man auf „Teufel komm raus“ eliminieren. „Wer das nicht einsieht, hat die Zeit verschlafen und im Rahmen unserer auf Effizienz und Effektivität getrimmten Gesellschaft nichts mehr bei uns verloren. Komfortzonen, das war einmal, haben das alle verstanden?“, so stand es klar und nüchtern in einem Rundschreiben an alle Mitarbeiter.
Der Umfang aller Tätigkeiten für die bald deutlich reduzierte Mitarbeiterzahl blieb dabei immer gleich. Die Arbeiten nahmen eher kontinuierlich noch zu, mussten aber auf immer weniger Schultern verteilt werden. Das ging nur mit Überstunden, die nicht extra vergütet wurden. Man erwartete Solidarität und von jedem Mitarbeiter und ein verstärktes Engagement zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. „Wir erwarten von jedem Mitarbeiter absolute Loyalität, höchsten Einsatz und Produktivität. Nur so können wir auf dem globalen Weltmarkt bestehen und unseren Aktionären eine ausreichende Rendite sichern“, wurde als Leitlinie ausgeschrieben. Und in der Tat, es ging immer nur um die Quartalsberichte und die jährliche Rendite, die im zweistelligen Prozentbereich erwartet wurde.
Demzufolge musste die Anzahl laufender Projekte sukzessive zunehmen. Mehrfach war Jean-Claude in zwei oder drei Vorhaben gleichzeitig eingebunden. Das kostete Energie und Kraft. Manchmal wusste er am Abend nicht mehr, wo ihm der Kopf stand. Nicht selten verließ er erst nach 20 Uhr das Büro und trotzdem reichte das nicht, termingerecht liefern zu können. Statt Dank, wurde er vom Abteilungsleiter dann niedergemacht, ungerecht gemaßregelt und, nach dem sich das wiederholt hatte, sogar schon einmal abgemahnt.
So gut wie wöchentlich zitierte man ihn zum Rapport, wo er Rede und Antwort stehen musste, wobei kein noch so gutes Argument überhaupt Gehör fand, alles wurde abgebürstet. Das war für ihn aber nur eine reine Schikane und zur Erniedrigung gedacht. „Das sind alles Schweine, sie wollen mich nur fertigmachen und loswerden“, davon war er felsenfest überzeugt.
„Sie müssen ihre Schwächen schwächen und die Stärken stärken, das erwarte ich von ihnen, und das müssen sie ebenfalls von den anderen erwarten. Machen sie mehr Druck, zeigen sie Kante, unser Unternehmen ist kein Kaffeekränzchen. Bestehen sie in den Abteilungen auf die Erfüllung der Vorgaben, die exakt im Korridor der Vereinbarungen zu liegen haben. Da dürfen Abweichungen weder in den Zahlen noch in der Zeit geduldet werden, haben sie das verstanden?“
Bei einem Gespräch ging Karl Benz, der Abteilungsleiter, noch weiter und schrie laut, was Jean Claude schon gar nicht leiden konnte: „Sie betrügen mich um mein Geld. Ich erwarte von allen Mitarbeitern und allen Abteilungen, die Erfüllung sämtlicher in den Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen festgeschriebenen Zahlen. Ihre Planungen liegen außer dem Rahmen, die Kontrolle der Istwerte erfolgt zu schleppend, da wird viel zu spät eingegriffen, korrigiert und gegengesteuert. Das schmälert den Gewinn im Ganzen und damit letztlich meine Vergütungen. Das lasse ich aber nicht zu, das lasse ich ihnen nicht durchgehen, ist das klar?“
Solche Vorwürfe und Vorhaltungen fand Jean-Claude höchst ärgerlich und zutiefst ungerecht, ja sogar beleidigend, denn er konnte kaum auf irgendetwas im Unternehmen Einfluss nehmen. Anscheinend brauchte der Abteilungsleiter aber nur einen Blitzableiter für seine Launen und suchte einen, bei dem er am wenigsten Schaden anrichten konnte. „Vermutlich hatte er zu Hause Ärger mit seiner Frau, sitzt dort unter statt am Tisch, und das lässt er dann hier im Unternehmen an allen aus und spielte hier den großen Maker“, mutmaßte er. „Da soll ich der Prellbock sein.“
Bei Jean-Claude ließen diese ungerechten Maßregelungen in einem fort eine nagende, zerstörerische Wut anwachsen. Das kochte ihn ihm, ließ ihn nachts im Bett nicht zur Ruhe kommen, er konnte nicht mehr einschlafen und trug sich mit den abstrusesten Rachegedanken. Seine Gedanken kreisten gleich einer endlosen Spirale. Irgendwann nahm er abends freiverkäufliche Schlafmittel ein, die er sich in der Apotheke besorgt hatte. Das half zumindest vorerst ein wenig, aber nicht genug, um einen durchgehenden erholsamen Schlaf zu sichern, den er so dringend nötig gehabt hätte.
Zu seinen Feindbildern im Unternehmen gehörten, neben Karl Benz, auch noch Malte Böhringer, der Personalchef, zu dem Jean-Claude ebenfalls ein sehr angespanntes und gestörtes Verhältnis hatte. „Ihm und den anderen Stinkstiefeln zahle ich ihre Bosheit schon noch heim, dem Personaler, dem Benz und auch seinem Adju. Das habe ich mir fest vorgenommen“, dachte er immer wieder.
Mit Adju war der Gruppenleiter Georg Manz – auch Schorsch genannt – gemeint, den er als bösen Intriganten geortet hatte, und der nach seiner Meinung natürlich mit Karl Benz unter einer Decke steckte. „Alle Gemeinheiten, die grundlosen, bösartigen Schikanen, werden sie mir eines Tages bitter büßen müssen, wie alle anderen auch, die mir bisher das Leben schwer gemacht haben und schwer machen, so wahr ich Jean-Claude heiße.“
Während ihm sein unbefriedigendes Leben der letzten Jahre wie ein Film durch den Kopf zog, die Schwierigkeiten, die ihn immer schon begleitet haben, die empfundenen Ungerechtigkeiten, da war er auch schon im Karlsruher Hauptbahnhof angekommen. Wider Erwarten hatte der Zug an diesem Tag keine der üblichen Verspätungen und ist pünktlich im Bahnhof eingefahren. Schnellen Schrittes eilte er vom Bahnsteig durch die Bahnhofshalle, eine Treppe tiefer, dem Ausgang zu und steuerte die gegenüberliegende Straßenbahn-Haltestelle an. Innerhalb weniger Minuten fuhr die S5 heran und er konnte einsteigen. Sie sollte ihn direkt quer durch die Stadt in den westlichen Stadtteil nach Knielingen bringen. In 30 Minuten war er am Eingangstor, schob den Zutrittsausweis durch den Magnetschlitz, die Drehtür öffnete sich und er konnte weitergehen und seinem Büro im 1. Obergeschoss zueilen.
„Ja, d’Scho-Clo isch au scho do, au, au“, hörte er einen Kollegen im Hintergrund spöttisch lästern. „Bisch nit von dinnere Frau runterkumme“, bemerkte ein anderer, und Jean-Claude biss sich auf die Zähne. „So ein Weichei kummt halt nie usem Nescht“, fügte ein Dritter spöttisch hinzu.
„Der Tag hat beschissen begonnen und es geht genauso weiter“, dachte der Gehänselte mit Verbitterung und erneut kochte Ärger in ihm hoch, neben dem angestauten Hass auf seine vermeintlichen Feinde. Nur mit Mühe gelang es ihm sich zurückzuhalten und nicht offen auf einen der Lästermäuler zuzugehen und ihm heftig eine aufs Maul zu hauen.
„Wenn das heute so weitergeht, drehe ich noch durch. Denen wer‘d ich‘s zeigen, den Drecksäcken, denne Schofseggel, den leidigen“, dachte er, ohne das laut zu sagen. Seine Gedanken und seine miese Stimmung behielt er lieber für sich.
„Der Karl hat schon zweimal nach dir verlangt, und das hat sich nicht freundlich angehört“, sagte ihm Sabine, eine Kollegin, und meinte damit Karl Benz, den Abteilungsleiter. „Du sollst unverzüglich anrufen, wenn du da bist“, fügte sie an.
Mit mulmigem Gefühl im Bauch verließ Jean-Claude seinen Platz am Schreibtisch, ging über den langen Gang zum Treppenaufgang und ein Stockwerk höher, wo sein unmittelbarer Chef sein Büro, mit Elke Baumann, seiner Sekretärin im Vorzimmer. Nach dem Eintritt ins Vorzimmer informierte Frau Baumann ihren Chef, dass Herr Schmidt da ist. „Soll reinkommen“, hörte er von dort die betont brummige Stimme. Jean-Claude trat in den großzügigen hellen Raum, möbliert mit hochwertigen USM-Haller-Büromöbeln, von einem Hersteller, der als Ikone der Gestaltungskunst gilt und dessen variablen modularen Produkte preislich im oberen Bereich angesiedelt sind.
„Guten Morgen, Herr Benz“, sagte halblaut der herbei Zitierte mit belegter Stimme. „Auch guten Morgen, Herr Schmidt, sind sie gesund, sind sie fit und eventuell sogar gut drauf, sie werden’s brauchen?“ „Ja, ja“, stammelte der Gefragte, ohne zu erahnen, was das „Getue“ sollte und worauf es hinausgehen will. „Sind sie mit Ihrer Arbeit eigentlich glücklich, sind sie mit ihrem weltweit agierenden und bedeutenden Arbeitgeber zufrieden?“, wollte Benz nun vielsagend und mit einem gewissen giftigen Unterton in der Stimme wissen. „Wenn ich es genau überschlage, haben sie im vergangenen Jahr nicht nur 28 Tage wegen Krankheit gefehlt, und wenn sie heute keine akzeptable Erklärung für das Zuspätkommen haben, wie ein Erdbeben, Überschwemmung, Fremdeinwirkung durch Aliens aus dem Weltraum, ist es schon das vierte Mal, dass sie in diesem Jahr zu spät gekommen sind, dann haben sie ein Problem.“
„Ich komme abends nicht zur Ruhe, schlafe schlecht in der Nacht und morgens werde ich deshalb nicht rechtzeitig wach, höre den Wecker nicht, was sicher mit meinem angeschlagenen psychischen Gesundheitszustand zu tun hat, ursächlich in der Überlastung hier am Arbeitsplatz“, gab Jean-Claude mehr patzig als schuldbewusst erklärend zur Antwort. „Es sollte ihnen außerdem bewusst sein, wieviele Überstunden ich in den vergangenen Monaten angesammelt habe, da wird eine halbe Stunde, wenn der Zug wieder einmal verspätet fährt, abgegolten sein, denn dass ich verschlafe, daran liegt es eher selten, sehr selten sogar. Andere Unternehmen in vergleichbarer Größe räumen ihren Mitarbeitern schon lange Gleitzeit ein, dann hätte ich dieses Problem nicht. Wieder andere sind noch moderner aufgestellt und bieten ihren qualifizierten Mitarbeitern Home-Office an. Das hätte den Vorteil, nicht in die Stoßzeiten des Verkehrs, in die Rushhour zu geraten und wertvolle Zeit im Stau zu verlieren.“
„Papperlapapp, schauen sie mal in ihren Vertrag, da steht drin, dass betrieblich bedingte Überstunden nach Bedarf zu leisten sind und die sind mit dem großzügigen Gehalt, das wir bezahlen, abgegolten. Da gibt es nichts aufzurechnen. Und wenn sie bei der nicht über Gebühr anspruchsvollen Arbeit, die wir ihnen anvertraut haben, überfordert sind, müssen sie sich eine andere Firma suchen. Wir können niemand gebrauchen, der nur 60 oder 70 Prozent Leistung zu bringen imstande ist, sondern wir erwarten 150 Prozent, ich wiederhole 150 Prozent. Sie schädigen durch Ihr Verhalten nicht nur unser Unternehmen, sondern auch ihre Kollegen und Kolleginnen, die ihren Mist übernehmen müssen, wenn sie fehlen. Mir steht der Vorstand im Genick, der von mir erwartet, dass alle Mitarbeiter überdurchschnittliche Leistungen erbringen. Da will und werde ich nicht ständig den Kopf für sie hinhalten und für ihre Versäumnisse einstehen. Das geht so nicht mehr, das werde ich nicht mehr dulden. Haben sie das verstanden? Sie sind ganz nah an einer weiteren Abmahnung dran. Dann können sie ins Hammerwerk (Arbeitsamt) gehen und Hartz IV beziehen und enden als Sozialfall. Außerdem müssen sie der Personalleitung überlassen, wie sie die Form der Arbeitserledigung plant und vorgibt. Wenn diese irgendwann einmal Gleitzeit oder Home-Office für sinnvoll oder ertragssteigernd hält, dann werden wir das garantiert auch einführen. Solange aber müssen sie sich mit dem aktuellen Modell abfinden, basta. Hier erwarte ich Loyalität mit den Entscheidungsträgern. Wenn die Bahn öfters einmal Verspätung hat, müssen sie vorbeugend eben einen früheren Zug nehmen, um sicherzugehen und unter allen Umständen rechtzeitig am Arbeitsplatz zu sein.“
Wie ein geprügelter Hund schlich der Gemaßregelte in sein Büro und zurück an seinen Schreibtisch, während sein Hass um ein weiteres Grad höher anstieg und eh schon tiefroten Bereich pendelte. „Den bring ich um, dem zieh ich die Haut in Streifen vom Balg, den brate ich in Fett“, grollte er halblaut schimpfend. Innerlich kochte er vor Zorn und in seinem Kopf pochte es gefährlich. Dabei hatte er das Gefühl, es würde ihn vor Wut jetzt gleich und auf der Stelle zerreißen, er müsste seinen Kopf an eine Wand schlagen oder in die Fensterbank beißen.
Jean-Claude war inzwischen 53 Jahre alt und noch viel zu jung für den Ruhestand, wenn ihm die Ärzte keine Invalidität attestieren würden, wonach es bisher nicht aussah. Die Aussichten auf einen neuen adäquaten Arbeitsplatz waren bei realistischer Betrachtung in seinem Alter nicht mehr optimal. Das wussten seine Vorgesetzten ganz genau, deshalb setzten sie ihn immer mehr unter Druck und erlaubten sich diese Verbalattacken. „Soll ich das noch 12 Jahre so aushalten müssen?“ Fragen über Fragen und immer mehr Selbstzweifel nagten an seines, aufgrund seiner Veranlagung, auch so schon stark angegriffenen Gemütszustandes. Der Hals war ihm trocken geworden, quälende Kopfschmerzen plagten ihn plötzlich, der Puls war hoch, Übelkeit überkam ihn, er fühlte sich elend und zum Bejammern schlecht – oder bildete er sich das nur ein?
Zitternd vor Wut und Erregung und mit weichen Knien schleppte er sich förmlich zurück an seinen Schreibtisch und hoffte, sich auf dem Weg dorthin nicht erbrechen zu müssen. In seinem Büro ließ er sich erstmal in seinen ledernen Bürostuhl am Schreibtisch niederplumpsen, atmete tief ein und aus und wischte sich mit dem Taschentuch den austretenden kalten Schweiß von der Stirn. Nur mit äußerster Konzentration konnte er sich noch auf seine Tätigkeit konzentrieren. Zu viel ging wieder durch seinen Sinn und er meinte, der Kopf würde ihm gleich zerspringen, während seine Adern an den Schläfen spürbar pulsierten und heftig klopften.
Er griff in die Schublade nach einer Aspirin-Tablette, warf sie in den Mund und spülte sie mit einem kräftigen Schlucken Mineralwasser nach, damit sie ihm besser runterrutschte. Der Kloß im Hals verstärkte sich trotzdem, sein angespannter Zustand besserte sich nicht. Ein Gefühl, es wurde ihm die Brust zuschnüren, stellte sich ein. Ein paar Minuten kämpfte er noch gegen das Unwohlsein an, der Schweiß tropfte ihm immer noch von der Stirn auf den Schreibtisch, dann wurde es ihm zuerst schwindlig, Sekunden später schwarz vor den Augen und er verlor das Bewusstsein.
1 ) https://www.aerzteblatt.de/archiv/63173/Das-Asperger-Syndrom-im-Erwachsenenalter
2
Tage im Krankenhaus
Es hatte nur wenige Minuten gedauert, bis die alarmierte Hilfe mit dem Krankenwagen eingetroffen war. Den Einsatz des Notarztes Dr. Frank Kübler, seine Stabilisierungs-Maßnahmen und den anschließenden Transport mit Blaulicht in das Vincentius-Klinikum in der Südendstraße, das bekam Jean-Claude Schmidt bewusst nicht mit. Aufgewacht ist er erst auf der Intensivstation in der Klinik, wo er sich an Kabeln und Apparaten angeschlossen fand und nicht wusste, wo er sich befindet und was los ist. „Wo bin ich? Was ist los, ist was passiert?“, wollte er mit schwacher Stimme von der Krankenschwester wissen, die neben seinem Bett stand, über ihm eine neue Infusionsflasche an den Haken hing und sie mit der fixierten Injektionsnadel in seinem rechten Arm verband.
„Ich bin Schwester Ingrid, sie sind mit einem kleinen Problem und nach einem am Arbeitsplatz erlitten Herzinfarkt hier eingeliefert worden. Können sie mir folgen? Doch keine Sorge, wir haben die Sache im Griff, das kriegen wir schon wieder hin. Jetzt müssen wir sie zuerst einmal stabilisieren und dann können sie bestimmt in ein paar Tagen wieder zu Hause sein.“ Während sie mit ruhiger Stimme auf ihn einsprach, werkelte sie ununterbrochen weiter, prüfte die angezeigten Werte auf dem Monitor, sah nach dem Puls, der Herzfrequenz, und warf zuletzt noch einmal einen prüfenden Blick auf den Patienten.
Das mit „zu Hause sein“ war natürlich ein wenig geschönt formuliert, denn in solchen Fällen, wie nach einem Herzinfarkt, schließt sich in der Regel unmittelbar danach eine Kur an. Jean-Claude bekam das, was ihm die Schwester gesagt hatte, auch nur verschwommen mit. Er fühlte sich wie in dicken Nebel eingehüllt oder in Watte gepackt und war unendlich müde. Kurz darauf war er schon wieder eingeschlafen und der Körper holte das nach, was er seit Wochen aufgrund der bedrückenden Verhältnisse in schlaflosen Nächten hatte entbehren müssen.
Hinterher konnte er sich nur noch an wilde Träume erinnern, an nervige Stimmen, die von Köpfen mit ekelhaften Fratzen wirr auf ihn einredeten, an unförmige Wesen, die ihn an finstere, grausige Orte führten und mit hässlichem Gelächter begleiteten. Wieder wach geworden überlegte er, was das alles wohl zu bedeuten habe, wo er sich gedanklich befand oder was ihm die Bilder sagen sollten.
„Wie wir bei der Untersuchung mit dem Herzkatheter festgestellt haben, brauchten wir bei ihnen noch keine Stents setzen. Die Blutgefäße weisen auch keine signifikanten Verengungen auf, was das notwendig gemacht hätte. Der erlittene Infarkt dürfte seinen Ursprung in psychischen Ursachen haben“, sagte ihm anschließend der Oberarzt Dr. Viktor Gabler, der Stunden später beim ihm am Bett stand und die Werte in der Krankenakte studierte. Als dieser ans Krankenbett getreten war, ist Jean-Claude halb wach geworden, doch was ihm der Arzt sonst noch sagte und was er tat, bekam er nicht mit, oder er konnte sich später nicht mehr daran erinnern. Erst anderentags, bei der Visite, war er in der Lage zu folgen und besser Rede und Antwort zu stehen, da verstand er, was man ihm sagte.