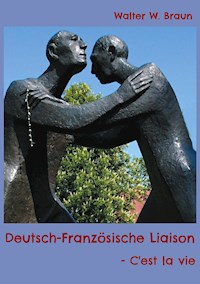Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sie bearbeiteten Fisch-Hornplatten, unter anderem für die Korsetts der Damen, zündeten Straßenlaternen an, belustigten Fürsten oder schlugen Wolle. Viele einst mehr oder wenige einträgliche Berufe sind in den vergangenen Jahren und Jahrhunderten ausgestorben, wie der Haderlump, der alte Kleidung als Lumpen einsammelte. Es waren die Türmer, die nach Feuer- und Brandstellen Ausschau hielten, und wer braucht heute noch einen Kammerdiener? Oder kennen sie noch den Beruf des Rattenfängers, der Klageweiber, des Kaffeeriechers, des Abtrittanbieters. Da waren Wannenverleiher für die Reinlichkeit der Bevölkerung, die kein eigenes Bad hatten - und das war die Mehrheit. Es gab den Bremser bei der Eisenbahn und sogar einen Sandmann für die Hausfrau, die neben Seife und Soda damit die Böden schrubbte, und sogar ein Gasriecher ging seinem erbärmlichen Beruf nach. Das sind längst in der Vergangenheit versunkene Tätigkeiten. Eines haben sie aber alle gemeinsam, sie dienten zum eigenen Lebensunterhalt und die wenigsten Tätigkeiten waren auskömmlich; reich machten sie schon gar nicht. Alleine seit den Anfängen der Bundesrepublik ist die Zahl der Berufe um fast zwei Drittel gesunken. Altes Handwerk ist aber nie alt und stirbt auch nicht einfach so aus. Bei vielen werden die Kenntnisse und Fähigkeiten, die Grundlagen für das Wissen noch in Nischen bewahrt und an die nachkommenden Generationen weitergegeben. Es ändern sich eventuell nur die Verarbeitungsweisen, die Materialien und die angewandten Techniken, dabei entstehen durchaus auch neue Berufe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Ackerknecht - Knechte - Mägde
2 Der Ameisler
3 Blaudrucker
4 Bleistiftmacher
5 Buchbinder
6 Buchhalter
7 Büchsenmacher
8 Bürsten- und Besenbinder
9 Drahtzieher
10 Drechsler
11 Eismann
12 Färber
13 Federmacher
14 Flachser
15 Flößer
16 Fuhrmann
17 Glasbläser
18 Gerber
19 Harzer
20 Hausierer
21 Holzspalter- und Holzsäger (Wandergewerbe)
22 Hufschmied
23 Hutmacher
24 Köhler
25 Korbmacher
26 Krauthobler
27 Küfer
28 Kürschner
29 Kutscher
30 Laken- und Tuchmacher
31 Leimsieder
32 Lohndrescher
33 Melker
34 Müller
35 Pfeifenmacher
36 Pinselmacher
37 Polsterer
38 Postbote
39 Sägewerker
40 Sattler
41 Seifensieder
42 Seiler
43 Schäfer
44 Scherenschleifer
45 Schindelmacher
46 Schirmmacher
47 Schnefler
48 Schriftgießer
49 Schrottsammler
50 Schuhmacher
51 Sticker
52 Störhandwerker (Schneider und Schuster)
53 Stricker
54 Strohschuhhersteller
55 Töpfer
56 Uhrenträger
57 Uhrmacher
58 Wagner – auch Krummholz und Stellmacher
59 Weber
60 Weißnäherin
61 Wiedendreher
62 Zapfenpflücker
63 Zeidler
64 Ziegelbrenner
65 Epilog
Vorwort
Sie bearbeiteten Fisch-Hornplatten, unter anderem für die Korsetts der Damen, zündeten Straßenlaternen an, belustigten Fürsten oder schlugen Wolle. Viele einst mehr oder wenige einträgliche Berufe sind in den vergangenen Jahren und Jahrhunderten ausgestorben, wie der Haderlump, der alte Kleidung als Lumpen einsammelte. Es waren die Türmer, die nach Feuer- und Brandstellen Ausschau hielten, und wer braucht heute die Dienste eines Kammerdieners? Oder kennen sie noch den Beruf des Rattenfängers, der Klageweiber, des Kaffeeriechers, des Abtrittanbieters. Die Wannenverleiher sorgten sich für die Reinlichkeit der Bevölkerung, die kein eigenes Bad besaßen - und das war die Mehrheit. Bei der Eisenbahn gab es den Bremser und sogar einen Sandmann für die Hausfrau, die neben Seife und Soda damit die Böden sauber schrubbte, ja, sogar ein Gasriecher ging seinem erbärmlichen Beruf nach. Das sind längst in der Vergangenheit versunkene Tätigkeiten. Eines haben sie aber alle gemeinsam, sie dienten zum eigenen Lebensunterhalt und die wenigsten Tätigkeiten waren auskömmlich; reich machten sie schon gar nicht.
Alleine seit den Anfängen der Bundesrepublik ist die Zahl der Berufe um fast zwei Drittel gesunken. Altes Handwerk ist aber nie alt und stirbt auch nicht einfach so aus. Bei vielen werden die Kenntnisse und Fähigkeiten, die Grundlagen für das Wissen noch in Nischen bewahrt und an die nachkommenden Generationen weitergegeben. Es ändern sich eventuell nur die Verarbeitungsweisen, die Materialien und die angewandten Techniken, dabei entstehen durchaus auch neue Berufe.
In diesem Buch erzähle ich von den wichtigsten der alten, längst vergessenen Berufen und Tätigkeiten. Dabei nenne ich die Berufe geschlechtsneutral im Maskulin und nicht nach dem Geschlecht getrennt oder mit einem Gender-Sternchen versehen. Die weibliche Form ist immer mit eingeschlossen, denn viele Berufe wurden und werden seit Jahrhunderten schon auch von Frauen erfolgreich ausgeführt, wie wir es bei der Weißnäherin sehen.
Es wurden auch längst nicht alle Tätigkeiten erwähnt, die einmal als Berufe zum Lebensunterhalt ausgeübt wurden, wie der Vogelfänger, der des Kesselflickers und viele andere auch, die allgemein weniger Bedeutung hatten, für die Ausübenden aber sicher schon. Sie wollten und mussten davon existieren können.
Viele unserer Vorfahren haben ihr Leben lang ihre Arbeitskraft und ihr Können in Beschäftigungen eingesetzt, von denen wir kaum noch oder nichts mehr wissen. Die rapide Veränderung der Arbeitswelt hat schon hunderte ausgestorbene Berufe hinterlassen. Mit diesen Worten leitet Rudi Palla sein Buch: „Verschwundene Arbeit - Das Buch der untergegangenen Berufe“ (Brandstätter Verlag) ein, schrieb einmal die Frankfurter Rundschau in einem Artikel. Viele Berufsbilder finden wir nur noch in Dokumentationsfilmen, die zum Glück solche alten Berufe und Handwerke für die Nachwelt visuell in Erinnerung behalten und die Techniken weitergeben. Manche werden heute auch noch durch Idealisten in Museen anschaulich den interessierten Besuchern demonstriert.
Das Substituierbarkeitspotenzial (Ersetzbarkeitspotenzial) ist je nach Berufsgruppe unterschiedlich. Am höchsten ist das Potenzial in sogenannten „Fertigungsberufen“, wie Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Glas, Holz, Keramik, Leder, Papier, Textilien und anderen mehr. Hier liegt der Anteil der Tätigkeiten, die bereits heute von einem Computer übernommen werden, bereits bei über 70 Prozent. Ein ebenfalls hohes Substituierbarkeitspotenzial haben mit 65 Prozent die „fertigungstechnischen Berufe“, in den vorwiegend Fahrzeuge, Anlagen und Maschinen produziert werden.
Klar ist unbestritten, die aussterbenden Berufe sind im Zuge der branchenübergreifenden Digitalisierung kein Einzelfall, sondern betreffen ganze Berufsgruppen und machen ein berufliches Umdenken, sowohl bei Arbeitnehmern als auch bei Arbeitgebern, zwingend erforderlich. 1)
Man kann durchaus sagen, dass die Geschichte des Handwerks beinahe genauso alt ist, wie der Menschheit selber. Als unsere Vorfahren zu Urzeiten damit begannen, Speerspitzen aus Stein und später aus anderen Materialien herzustellen, war das eine der frühesten Formen der handwerklichen Fertigungen. Was folgte, waren die unterschiedlichsten Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände, deren Einsatz und Nützlichkeit der Menschheit dazu verhalfen, sich zu dem zu entwickeln, was sie heute ist. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Handwerksberufe hinzu, die stark spezialisiert waren und wahre Experten hervorbrachten. Noch heute sind die Handwerker Meister auf ihrem Gebiet und zum Teil hochgradig spezialisiert. Während der Steinzeitmensch über rudimentäres Wissen verfügte und eine Vielzahl von einfachen Gegenständen mit seinen eigenen Händen herzustellen in der Lage war, konnte im Laufe der Handwerksgeschichte beobachten werden, wie sich die Berufe immer schärfer voneinander trennten und sie professionalisiert wurden. Mit dieser Differenzierung stieg selbstverständlich auch die Qualität, ebenso die Quantität der gefertigten Güter und Produkte.
Ein anderer Faktor, der die Entwicklung der Handwerksberufe vorangetrieben hat, war die Entstehung der Landwirtschaft. Während der eine Teil der Bevölkerung auf den Feldern stand, Samen aussäte und die Ernte einholte, war der andere Teil damit beschäftigt, die benötigten Gerätschaften hierfür herzustellen. Durch diese Arbeitsteilung entstand in den Städten der Großteil der professionellen Handwerke, die sich dort angesiedelt haben.
Der Wandel der Zeit führte jedoch nicht nur dazu, dass neue Handwerke das Licht der Welt erblickten und andere, die nicht mehr benötigt wurden, wieder verschwunden sind. Fortschritt, gesellschaftliche, kulturelle, politische und wirtschaftliche Veränderungen, Industrialisierung und neuerdings auch die Digitalisierung, sorgten und sorgen dafür, dass einige Handwerksberufe mehr und mehr an Bedeutung verlieren und nur noch selten praktiziert werden. Manche sind inzwischen auch komplett ausgestorben und nur noch im Museum zu bestaunen. 2 )
Altes Handwerk bezieht sich auf traditionelle handwerkliche Fähigkeiten und Techniken, die über Generationen hinweg ausgeübt und weitergegeben wurden. Es umfasst verschiedene Bereiche wie die Schmiedekunst, Tischlerei, Keramikherstellung, das Weben und vieles anderes mehr. Altes Handwerk hat zudem einen besonderen Charme, da es oft mit viel Liebe zum Detail und handwerklichem Können und Geschick ausgeführt wird. Es ist auch eine Möglichkeit, die Vergangenheit zu bewahren und die Verbindung zu unseren Vorfahren zu stärken. Allerdings hat sich die Bedeutung des alten Handwerks im Laufe der Zeit verändert, da moderne Technologien und industrielle Fertigungsmethoden immer mehr Einzug halten. Dennoch gibt es immer noch genug Menschen, die das alte Handwerk schätzen und weiterhin ausüben wollen.
Natürlich ist es bedauerlich, dass einige Berufe im Laufe der Zeit aussterben. So ein Beispiel für einen aussterbenden Beruf ist der Schuhmacher. Früher stellte ein Schuhmacher die Schuhe von Hand her und reparierte sie auch. Mit der Massenproduktion von Schuhen und der Verwendung moderner Maschinen ist die Nachfrage nach handgefertigten Schuhen und damit auch nach Schuhmachern stark zurückgegangen.
Ein weiteres Beispiel sind die Briefträger. Mit der zunehmenden Digitalisierung und der Verbreitung von E-Mails und Online-Kommunikation werden physische Briefe, Karten und Postsendungen immer seltener. Dadurch verringert sich die Notwendigkeit von Briefträgern, da viele Unternehmen ihre Korrespondenz auf elektronische Wege umgestellt haben. Was es an Briefen und Paketen zuzustellen gibt, wird zunehmend von Dienstleistern übernommen, die wiederum Billigarbeitskräfte zum Mindestlohn damit beauftragen. Häufig sind es auch Selbständige, die das dann als Subunternehmer oder Subsubunternehmer auf eigene Rechnung ausführen.
Es ist mir wichtig anzumerken, dass der Fortschritt und die Veränderungen in der Gesellschaft oft dazu geführt haben, dass bestimmte Berufe, auch durch technische Neuerungen, überflüssig geworden sind. Dennoch ist es schade, dass dadurch das spezifische Wissen und die über Generationen antrainierten Fähigkeiten, die mit diesen Berufen verbunden waren, verloren gehen können. Glücklicherweise gibt es Initiativen, die versuchen, solche traditionellen Berufe noch zu bewahren und zu fördern, um zumindest ihr Erbe, „die Gene des Berufes“, zu erhalten. In manchen Städten haben sich heute Althandwerkerschaften zusammengefunden, wo jedermann gegen kleines Geld Reparaturen durchführen lassen kann. Die ist außerdem im Sinne der Ressourcenschonung zu begrüßen.
1 ) https://www.weiterbildung-onlinemarketing.com/aussterbende-berufe/
2 ) https://arbeits-abc.de/vergessene-handwerksberufe/
1
Ackerknecht – Knechte und Mägde
Ursprünglich steht der Name Ackerknecht im Zusammenhang mit der allgemein weit verbreiteten landwirtschaftlichen, bäuerlichen Tätigkeit. Die Bezeichnung findet sich regional unterschiedlich und gerade im süddeutschen Raum wurden sie vereinfacht auch Bauernknechte oder Landarbeiter genannt. Im strengen Sinne war der Ackerknecht „der pflugführende, ackernde Knecht.“ Im Unterschied zur antiken (und bis weit ins Mittelalter praktizierten) Sklaverei ist der Knecht in seiner menschlichen Würde dem Herrn gleichgestellt und kann aus dieser Position, durch Heirat und Erbschaft, in die Position des Bauern aufsteigen. Zumindest ergibt sich diese prinzipielle Gleichheit von Herr und Knecht im Mittelalter durch die Gleichheit der Menschen vor Gott. Knechtschaft war im Mittelalter somit nicht notwendig unehrenhaft und findet sich auch bei den Landsknechten und der Ritterschaft wieder.“ 3)
Dabei darf man nicht übersehen, dass das schlichte, spartanische Leben der Knechte und Mägde auf den Bauernhöfen bis in die neuere Zeit meistens entbehrungsreich und von sehr harter Arbeit geprägt war. Die frühere Bezeichnung „Magd“ stand für eine weibliche Person, die im Haushalt, in der Landwirtschaft oder im Gastgewerbe die unterschiedlichsten Tätigkeiten verrichteten mussten, die also sozusagen ein Mädchen für alles waren. Für die körperlich anstrengenden Arbeiten, die gesellschaftlich als minderwertig galten, war das männliche Pendant zuständig, der „Knecht“. Bei mehreren Knechten auf einem Hof gab es auch noch die Differenzierung Stallknecht oder Stallburschen. Diese waren dann meistens oder ausschließlich für die Pferde zuständig. In der Pluralform war es eine Knechtschaft, die ihren Namen wirklich verdient hat, denn sie waren so gut wie rechtlos und konnten jederzeit davongejagt werden. Eine Unterart in der Tätigkeit eines Knechtes waren die „Hütebuben“, die vom Frühjahr bis weit in den Herbst hinein, tagein, tagaus bei Wind und Wetter, auf den Weiden das Vieh gehütet haben. Doch darauf soll hier nicht eingegangen werden, da es eigentlich kein eigenständiger Beruf war, sondern sich eher um eine erbärmliche Kinderarbeit handelte. Bei der Behandlung standen sie aber noch unter dem der Knechte. Harte und schwere Arbeit kennzeichneten also den Alltag. Diese Form der Ausbeutung endete erst in den 1960er-Jahren im Zuge der zunehmenden Mechanisierung auf den Bauernhöfen, die wiederum mehr Fachkräfte oder Spezialisten an Stelle der ungelernten Arbeiter erforderlich machten.
Der Lohn war allgemein sehr gering und bestand überwiegend aus Kost und Logis, und wurde fast überwiegend nur in Naturalien bezahlt. Dazu gehörte das tägliche Essen und das war bei weitem nicht immer und überall reichhaltig oder das gleiche, wie es die Herrschaft sich gönnte. Während die Bäuerin, der Bauer und seine Familie feinen Schinken und Geräuchertes verspeisten, wurde das Gesinde häufig mit Suppe, Kraut und verschimmeltem Brot abgespeist. Nicht wenige Bäuerinnen, die überwiegend für die Mägde zuständig waren, agierten herrschsüchtig und sie sparten bei den Bediensteten gerne am Essen. Häufig wurden ihnen nur Suppen und angeschimmeltes Brot geboten. Die Vorratskammern hingen dagegen in der Regel meistens voller Schinken, Würsten und anderen geräucherten Köstlichkeiten, während die Knechte und Mägde nur einfache Kost aufgetischt bekamen. In der Regel gab es ein kleines Handgeld bei der Einstellung und wenn es gut ging, ein Trinkgeld zwischendurch. Diese Verhaltensweise bezog sich oft sogar auf die Geschwister der Bauern, also denen, die nicht erben konnten, aber in der Familie als ledige Verwandte verblieben sind. Eine Krankenversorgung war unbekannt. Bei Krankheit mussten die Bediensteten zwar versorgt werden, aber Geld für einen Arzt, hatte die Bauernfamilie oft nicht einmal für sich selber. Man musste sich mit allerlei Hausmitteln und Kräutern behelfen, weshalb viele Bäuerinnen und Mägde sich mit alternativen Heilmethoden und auch mit Kräutern und Salben sehr gut auskannten, oder es wurde eine sogenannte Kräuterhexe hinzuzogen. Zu den gepflegten Bauerngärten, die nirgendwo fehlen durften, gehörten somit immer auch zwingend Kräuter und Teesorten aller Art.
Den Knechten und Mägden stand ein Schlafplatz zu, doch die schlicht und einfach gehaltenen Kammern befanden sich meistens über den Ställen oder neben den Heubühnen. Das hatte den Vorteil, dass sie im Notfall oder bei Geburten schnell bei den Tieren sein und sich um sie kümmern konnten. Die darunter befindlichen Ställe gaben zudem Wärme nach oben ab und dienten sozusagen nebenbei als Fußbodenheizung. Das war ein willkommener Nebeneffekt, sicher aber von den gewitzten Vorfahren durchaus geplant und auch so gewollt. Doch ansonsten machten es die schlichten, dunklen und im Winter kalten Kammern unter dem tief heruntergezogenen Walmdächern der mächtigen Bauernhöfe, dem Personal die Arbeit nicht einfacher.
Wenn es die Herrschaft gut mit ihnen meinte, bekamen sie außerdem jährlich ein paar neue Schuhe, vielleicht auch eine neue Hose, ein Kleid oder eine Jacke. Zu den dörflichen Festen gab es in der Regel ein Trinkgeld auf die Hand. Das war es dann schon, was man in einer solchen Arbeitsstelle erwarten durfte.
„Eine Gesindeordnung regelte das Verhältnis zwischen Gesinde (Dienstboten) und der Herrschaft (Dienstherr). Markant war das Missverhältnis zwischen den Rechten der Dienstherren und den Bediensteten. So konnte der Arbeitgeber seine Dienstboten teilweise ohne Kündigungsfristen und ohne gesetzliche Vorgaben jederzeit entlassen, während die Mägde und Knechte eine Kündigungsfrist von mehreren, meistens bis zu drei Monaten einhalten mussten. Das Gesinde konnte auch, wenn es unerlaubt der Arbeit fernblieb, polizeilich gesucht und zurückgeführt werden, teilweise unterlag es der herrschaftlichen Hauszucht.“ 4)
Typischer Schwarzwälder Bauernhof mit Backstube nebenan
Ohne den Einsatz dieser Kräfte wäre aber eine Bewirtschaftung großer Höfe nicht möglich gewesen und für die ungelernten Kräfte war es die einzige Möglichkeit überhaupt an Arbeit zu kommen und so zu überleben. Die einfache Bevölkerung war zudem kinderreich und es mangelte an der Bildung. Heute würde so ein Abhängigkeitsverhältnis niemand mehr eingehen und mitmachen. Sicher gab es auch Beschäftigungsverhältnisse, die eine gute Versorgung boten, in denen man familiär miteinander umging und sogar kranke oder verletzte Mägde und Knechte adäquat betreut wurden. Das war aber nur bei einer kleinen Minderheit so. Wurden sie alt oder krank, durften sie in aller Regel weiterhin auf dem Hof verbleiben und wurden mit kleineren Hilfsarbeiten, wie Vieh oder Kinder hüten beschäftigt.
Heutzutage gäbe es von Seiten des Staates Gesetze und Hürden, die den sozialen Ausgleich gewährleisten. Seit den 1980er Jahren hat es sich in der Bundesrepublik durchgesetzt, dass für normale Arbeitsverhältnisse ein Mindestlohn zwingend ist und Steuern und Sozialabgaben geleistet werden müssen. Das sichert später auch eine eigene, wenn gleich bescheidene Rente. Während der Saison bei der Ernte in den Sonderkulturen, bei der Erdbeerenernte, oder beim Heidelbeeren lesen und anderem Obst, in der Weinlese oder der Spargelernte und auf den Gurkenfeldern, wurden anfangs Erntehelfer aus Polen und später aus ganz Osteuropa angeworben, die für drei Monate eine Arbeitserlaubnis erhielten. Sie lebten in dieser Zeit natürlich oft in schlichten Behausungen, manchmal sogar in Zelten und wurden nur bei guten und sozial eingestellten Höfen mit Essen aus der Großküche versorgt. Denen standen dann auch meistens akzeptable sanitäre Einrichtungen zur Verfügung.
Doch zurück zur sogenannten „guten, alten Zeit.“ Es war in aller Regel der Brauch, dass die Mägde die Kühe melken mussten und sich ums Vieh zu kümmern hatten. Auf den Wiesen rechten sie Gras oder Heu zusammen oder gingen mit in den Wald, um „Wellen“ aus Baumreisig und dünnen Holzästen zu bündeln. Später wurden die Holzbündel bei größeren Feuerstellen direkt als Feuerholz in den Herd geschoben oder vorher auf dem Hauklotz zerkleinert, handliche Stücke gehackt, damit man sie in kleineren Herden und Öfen verfeuern konnte.
Die Aufgabe der Knechte war es, die Ställe auszumisten, das Vieh zu füttern, und die Feldarbeit mit Pflug und Egge zu verrichten. Dafür standen vor Jahrzehnten noch keine Maschinen bereit, sondern nur zwei Ochsen, welche unter dem Joch die Geräte zogen. Die fortschrittlicheren Bauern hatten dafür stattdessen schon ein Pferdegespann im Geschirr. Das mag sich einfach anhören, es bedurfte aber viel Geschick, die Gespanne so zu führen, dass es gerade Furchen gab und es musste gekonnt sein, wenn die Peitsche - oder Geißel - knallend über die Tiere schnalzte, ohne sie zu treffen und zu quälen, aber anzutreiben. Und ein Vergnügen war es auch nicht, wenn Schwärme von Mücken und böse stechenden und blutsaugenden Bremsen die Tiere gehörig piesackten und dabei die Zweibeinigen auch nicht verschonten, wenn sie ihnen nervig um die Köpfe schwirrten.
Täglich musste die Knechte die nötige Menge Gras mähen, später Heu und Öhmd und das natürlich alles noch mit der Sense. Das war eine Knochenarbeit. Bei der Getreideernte oblagen ihnen vorwiegend die Mäharbeiten, während die Mägde Garben gebunden haben. Gegen Tagesende hat man gemeinsam die Wagen beladen und hochbeladen zum Hof gefahren. Zuletzt musste alles noch in die Scheuern verfrachtet werden, um es Platz sparend dort unterzubringen. Dies dauerte bis in die Nacht und war insgesamt eine kraftraubende, staubige Angelegenheit, die Durst machte und allen die Kehlen austrocknete.
Im Wald waren die Knechte für die Baumfällarbeiten zuständig, sie entasteten die Stämme und anschließend wurden sie mit Rückepferden aus dem Wald an die Wege geschleift. Später hat man die Stämme auf die Langholzwagen geladen und sie wurden von Fuhrleuten abgefahren. Die zum Verarbeiten untauglichen Stämme hat man vor Ort gleich zu Brennholz gesägt, gespalten und Ster für Ster (Raummeter) gestapelt. Aus dem Reisig der Äste hat man meist in Heimarbeit auch noch Besen gebunden.
Solche kräftezehrenden Tageseinsätze dauerten in der Regel von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Freizeit war für Bauer und Knecht oder Magd meistens ein Fremdwort. Für die Knechte und Mägde war das in früheren Jahrhunderten ein reines Abhängigkeitsverhältnis, nicht weit vom erbärmlichen Sklavenleben entfernt.
Noch zu den Zeiten Luthers lebten Knechte und Mägde in einem Zustand der Rechtlosigkeit und in gnadenloser Ausbeutung. Der wichtigste Tag für sie war Martini, am 11. November. Zu diesem Datum wurden allgemein die Bediensteten in die Winterruhe entlassen und erst an Lichtmess am 2. Februar wieder in Lohn und Brot gesetzt. Häufig wechselte sie bei dieser Gelegenheit auch die Dienstherren. Die Knechte und Mägde suchten sich einen neuen Bauern und diese wiederum hielten nach gesunden, tüchtigen Leuten Ausschau, um sie mit Handschlag und einem Handgeld in die neue Saison zu verpflichten. Es lag somit durchaus im Interesse der Herren, ihre Knechte und Mägde gut zu behandeln, damit sie wiederkamen, oder dass sie neue Kräfte rekrutieren konnten. Schon früher sprach sich sehr schnell herum, wenn ein Bauer, und noch öfters die herrschsüchtige, geizige Bäuerin, das Personal schikaniert und drangsaliert hat, ihnen das Leben schwer machte und wenig oder schlechtes Essen gab. Es blieb auch nicht verborgen, wenn sie keine guten Unterkünfte bereitstellten. Sie bekamen dann irgendwann keine Arbeitskräfte mehr.
Bei fast allen Dienstherren, den Bauern auf ihren kleineren oder größeren Höfen, fehlte es immerzu an Bargeld, wenn es sich nicht um ausgesprochen stattliche Höfe oder um einen der sagenhaft reichen Waldbauern handelte.
Wenn es gut ging, bekam das Gesinde zu den dörflichen Festen oder an kirchlichen Hochtagen ein Trinkgeld und ein paar Stunden frei, damit sie mit Ihresgleichen oder der Dorfbevölkerung feiern konnten. Die Arbeit im Stall, das Ausmisten, die Kühe oder Ziegen melken, die Schweine und alle Tiere füttern und dergleichen, das musste trotzdem auch an solchen Tagen geleistet werden.
Der Knecht oder Magd ist somit eine historische Bezeichnung für Arbeiter, die verschiedenste Aufgaben auf einem Bauern- oder Gasthof zu erledigen hatten. Die größeren Bauernhöfe und die Adelshäuser besaßen viele Mägde und Knechte in ihren Diensten. Hier bestanden durchaus Hierarchien in Großknechten und Großmägden, die über den anderen standen.
Eine Magd durfte nicht heiraten, da sie als Arbeitskraft gebraucht wurde. Nur heimlich konnten sie Liebschaften pflegen, aber das war auf einen engen Kreis begrenzt, doch durchaus gang und gäbe. Meistens waren solche Verhältnisse mit dem Knecht oder den Gleichgestellten von anderen Höfen aus der näheren Umgebung üblich. Sie hatten kaum die Möglichkeit zu reisen und der Radius zu Fuß war begrenzt, außerdem hatten sie im Grunde genommen keine Freizeit, außer wenigen Stunden, um an den erwähnten dörflichen Festen teilzunehmen. Überliefert ist dafür die interessante Sitte, nachdem beispielsweise eine Magd das Taschenmesser eines Knechts beim Vespern weg nahm, so konnte man davon ausgehen, dass der Knecht noch am selben Abend sie in ihrer Kammer besuchen durfte. Doch solche Liebschaften und sexuellen Abenteuer mussten allerdings streng im Verborgenen ablaufen, denn bis in die 1970er Jahre galt noch der Kuppelparagraf, nachdem es unverheirateten Paaren nicht erlaubt war, über Nacht miteinander in einem Zimmer zu nächtigen. Sie hätten sich damit strafbar gemacht.
Das Leben im Schwarzwald, gleich auch in den anderen Gebieten Deutschlands, erscheint uns heute rückblickend als die „gute alten Zeit“ und verklärter Idylle. Doch in der rauen Wirklichkeit war es ein harter Überlebenskampf, denn eng verbunden mit der Natur zu sein, das bedeutete Abhängigkeit und oft mehr Bedrohung als wahrer Segen.
Ein typischer Tag auf einem Bauernhof begann sehr früh. Um fünf Uhr isst man aufgestanden. Bis sieben war schon das Feuer im Herd gemacht und das Morgenessen gekocht, die Kühe gemolken, das Schweinefutter zubereitet, alle Tiere gefüttert und der Stall ausgemistet. Da lag somit schon jede Menge Arbeit hinter jedem. Zum Morgenessen gab es meistens eine Brot- oder Milchsuppe. Dazu traf sich der ganze Haushalt zum ersten Mal am Tag in der Stube. Der Bauer und Bäuerin, Knechte, Mägde und die Kinder saßen miteinander am großen Tisch. Danach ging jeder wieder seinem üblichen Tagwerk nach.
Der Knecht holte Grünfutter von den Wiesen ein und ging dann aufs Feld oder in den Wald, die Kinder und wenn man hatte, auch die Hütebuben, trieben das Vieh auf die Weide und hüteten es tagsüber. Das war kein rumsitzen oder mit einem Grashalm im Mund das Wolkenspiel zu verfolgen. Ständig mussten die Kühe im Auge behalten werden, damit sie nicht auf die Nachbarweiden auswichen oder Gefahren drohten. Weidezäune zum Schutz oder der Begrenzung zu den Nachbarn kamen erst viel später auf. Zudem wurden die großen Wiesen oft für die Heuernte geschont und man ließ die Kühe lieber an Wegrändern oder auf kleineren, abgelegenen Wiesen weiden und dazu mussten sie hingeführt werden.
Die Mägde befeuerten den Herd, putzten das Haus, kochten das Schweinefutter für den nächsten Tag vor, tränkten das Vieh, das im oder am Haus geblieben war. Gegen neun Uhr brachten sie das, sogenannte „s’Nini-Vesper“, mit Brot, Butter und etwas Speck, sowie eine Gutter Most zum Trinken hinaus aufs Feld oder in den Wald. Arbeitete man in der Nähe des Hauses oder bei schlechtem Wetter, dann trafen sie sich manchmal bei größeren Höfen auch in der Gesinde-Stube.
Je nach Jahreszeit arbeiteten alle gemeinsam bis zum Mittag auf den Feldern oder im Wald. Gegen zwölf Uhr zur Mittagspause gingen sie alle zurück ins Haus und dort saß man gemeinsam zum Mittagessen am Tisch. Nur während der Heu- und Getreideernte brachten die Mägde und manchmal auch die Kinder der Bauern das Mittagessen direkt hinaus auf die Felder.
Spätnachmittags gab es noch einmal eine Vesper, mit Brot, Würsten und Speck. Hinterher rundete ein Obstler, ein Zwetschgenwasser oder ein Rossler die Sache ab. Später musste die Tagesernte noch aufgeladen und heimgefahren werden und am Ende des Tages waren erneut die Tiere noch einmal zu versorgen. Der frühere Abend war zudem die Zeit, in der sich die Bäuerin um den Hausgarten kümmern konnte, das war ihr ureigenes Reich, während die Magd andere Arbeiten im Haus zu erledigen hatte.
An bestimmten Tagen warteten auf die Mägde noch zusätzliche Aufgaben, die sie neben den üblichen Tätigkeiten auch noch erledigen mussten. Das war in der Regel alle 14 Tage Brot backen und wöchentlich musste die Wäsche gewaschen werden. Dazu stand keine Waschmaschine zur Verfügung, sondern ein Waschkessel, Bottich und Hackbrett. Im Herbst wurde Kraut gehobelt, wenn dies nicht durch traditionelle, reisende Krauthobler gemacht wurde. Das Kraut kam in Fässer oder Tonkrüge, wurde gesalzen, eingestampft und zu Sauerkraut fermentiert. Wenn es welche gab, mussten auf den Streuobstwiesen die Äpfel und Birnen geerntet und aufgelesen werden, die danach zu Saft gepresst und in Fässern zu Most vergoren wurden.
Im Schwarzwald gehört es zur Tradition, dass zum Essen, als auch zwischendurch auf dem Feld bei der Arbeit nicht Wasser, sondern Most und manchmal viel Most getrunken wurde. Für den häuslichen Bedarf schöpften die weit verstreut liegenden Gehöfte ihr Wasser aus eigenen Brunnen und das war nicht abgekocht und hygienisch nicht immer einwandfrei. Vorsichtshalber tranken alle lieber Most, auch die Kinder, denn das war - in Maßen - gesünder.
Das Getränk hat zwischen 5 und 10 Prozent Alkohol und galt sozusagen zu den Grundnahrungsmitteln. Etwa um 20 Uhr gab es nochmals ein warmes Abendessen mit Kartoffeln, Gemüse und Suppe und seltener mit Fleisch. Das war doch eigentlich eine üppige Verpflegung, könnte man meinen, doch bei der harten körperlichen Arbeit war eine ausreichende Kalorienzufuhr und tagsüber ausreichend trinken sehr wichtig.
War das übliche Tagwerk getan, verblieben, je nach Jahreszeit, noch wenige Stunden für ein Nebengewerbe. Je nach Region wurden Bürsten oder Uhrenteile hergestellt und die Knechte hatten mitunter Reparaturarbeiten am Haus, im Stall und an den Gerätschaften zu tun, während die Mägde mit Wäsche flicken und bügeln beschäftigt waren. Zu Bett ging man erst kurz vor Mitternacht, doch beim ersten Hahnenschrei ging es schon wieder hinaus in den Stall. Wahrhaft, ein hartes, entbehrungsreiches Arbeitsleben.
Für fast alle Aufgaben gab es eine klare Arbeitsteilung. Bei der Heuernte schnitten die Knechte mit der Sense das Gras und luden das getrocknete Heu später auf die Wagen, die Mägde rechten das Gras mit Harken zusammen, wendeten und schüttelten es, bis es trocken war. Der vollbeladene wurde zum Hof und dort in die Scheuern eingefahren. Vor Ort musste es abgeladen und mit den Füßen verdichtet gelagert werden. Sämtliche Hausarbeiten waren ausschließlich Frauenarbeit und somit vornehmlich die Aufgabe der Mägde. Es war undenkbar, dass ein Mann sich in der Küche zu schaffen machte. Umgekehrt war zum Beispiel die Waldarbeit eindeutig Männersache, also die des Bauern und seiner Knechte. Hier waren die Frauen höchstens bei Neuanpflanzungen dabei oder sie sammelten fleißig das Reisig und eine Menge Tannenzapfen als Brennmaterial ein. Selbst die Kinder waren fest in die Hofarbeit eingebunden. Zu ihren Aufgaben gehörte die Versorgung des Kleinviehs, der Hasen und Hühner, aber auch das schon erwähnte Hüten der Kühe und Ziegen.
Im Grunde hat sich der Tagesablauf auf einem Bauernhof über die Jahrhunderte kaum verändert. Zuerst kann der Hof, dann das Vieh und zuletzt die Menschen.
Doch wenn man bedenkt, wie mühsam es früher einmal war, nur einen Topf Wasser heiß zu machen, dann beginnt man zu erahnen, wie umfangreich das Arbeitspensum für die Mägde und Knechte wirklich war. Das schaffte man nur, wenn man gut organisiert war. „Freizeit haben wir eigentlich nie gehabt“, erzählen heute noch die alten Bauern, „höchstens mal am Sonntag, einen halben Tag, nach dem Kirchgang.“ Das galt natürlich auch für das Gesinde.
Man sollte meinen, die Mägde und Knechte kamen aus dem einfachen Volk, aus kinderreichen Familien oder den niederen Schichten. Zumindest im Schwarzwald war das keinesfalls immer so. Das war dem Erbrecht zu schulden. Nur der jüngste Sohn konnte Hoferbe werden. Sie lesen richtig, der jüngste Sohn. Das hatte pragmatische Gründe. Die Höfe durften erstens nicht geteilt werden, damit das Überleben für alle gesichert blieb. Und andererseits sicherte der jüngste Sohn dem Altbauern und der Bäuerin, die nach der Hofübergabe in das Libdig (Leibgedingehaus, ein kleines Nebengebäude) wechselten, naturgemäß eine längere Alterssicherung, denn der Erbe hatte die Pflicht, seine Eltern ausreichend so lange sie noch lebten zu versorgen.
Die älteren Söhne blieben entweder als Knechte auf dem Hof und waren in dieser Position vielleicht gegenüber Fremdkräften ein wenig privilegiert, jedoch keineswegs immer. In den allermeisten Fällen verließen sie aber den Hof und arbeiteten in den aufstrebenden Fabriken der Uhrenindustrie, im Raum Villingen und Furtwangen oder in der Textilindustrie im Wiesental bei Schopfheim und Lörrach. Sehr viele von ihnen wanderten im 19. und 20. Jahrhundert aus und gingen nach Amerika oder auf den südamerikanischen Kontinent nach Brasilien oder Argentinien, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen.
3 ) https://de.wikipedia.org/wiki/Knechtschaft
4 ) https://de.wikipedia.org/wiki/Gesindeordnung
2
Der Ameisler
Wer kennt heute noch den außergewöhnlichen Beruf eines Ameislers, es sei denn, man assoziiert von vorneherein damit die kleinen Krabbeltierchen, die Ameisen, und damit liegt man nicht ganz falsch.
Weniger bekannt sind die Ursprünge dieses Berufes. Vermutet wird, dass es mit der im Mittelalter zunehmenden Käfighaltung von Singvögeln einherging. Im deutschsprachigen Raum sind Ameisler als Berufsstand ab dem 17. Jahrhundert für Teile Österreichs, Bayerns und Böhmens nachgewiesen. Die dazugehörige saisonale Tätigkeit wurde als Ameisln bezeichnet und brachten einen recht guten Gewinn ein. Vom Frühjahr bis zum Herbst konnten Ameisenhaufen alle 2-3 Wochen abgeerntet werden. 5)
Der Name Ameisler, lokal auch Amastrager, ist die Bezeichnung für einen historischen Berufsstand und wird als Ameisln beschrieben. Die Ameisler sammelten und trockneten bei ihrer Saisonarbeit die Puppen der Waldameisen und verkauften sie dann als Vogel- oder Fischfutter. Die Kundschaft bestand hauptsächlich aus Vogelfutterhändlern, die alle eingesammelten und getrockneten Ameisenlarven an Vogelbesitzer verkauften. Eine weitere Verwendung der Ameiseneier, man glaubt es kaum, fand sich in der Zutat für die Herstellung von Arzneimitteln, die damals noch von den Apothekern geleistet wurde.
Von der einst weitverbreiteten Mode, sich daheim Lerchen, Nachtigallen oder Kanarienvögel in Käfigen zu halten, zeugen Renaissancegemälde genauso, wie 300 Jahre später, die Vogelfänger-Arie in Mozarts Zauberflöte. Dessen Familie besaß mehrere Singvögel und auf einer erhalten gebliebenen Rechnung der Familie Mozarts, tauchen tatsächlich Ameisenpuppen auf.
Bis in die 1970er-Jahre konnte man sie noch in den Wäldern von Österreich antreffen. Andernorts war das Ameiseln - zum Schutz der Ameisen und zur Wahrung des ökologischen Gleichgewichts - schon früher verboten worden.
Erlaubnisschein aus Niederösterreich (1953)
Viele Bauern mussten aus existenziellen Gründen noch einem Nebenerwerb nachgehen, wobei die Sammelwirtschaft einen besonderen Stellenwert einnahm. Bereits 1679 konnte man in einem Kräuterbuch des Frankfurter Stadtphysicus Adam Lonitzer über die „Beste Weiß Omeisen-Eyer zu sammeln“ nachlesen. Den ausführlichsten Bericht über das Ameisln lieferte Moritz Alois Becker 1859 in seinem Reisehandbuch für Besucher des Ötscher, in dem er die Tätigkeit detailliert beschreibt. Für Niederösterreich sind neben dem Ötschergebiet die Sammelorte Annaberg, Dunkelsteinerwald, Glasweiner Wald, Gutenstein, Hainfeld, Karnabrunner Wald, Michelstetten, Ottenschlag und Pulkau belegt. Über die Landesgrenze hinaus ist das Ameisln für Tirol, die Oberpfalz, das bayerisch-böhmische Grenzgebiet und Iglau nachgewiesen.
Rund um Hainfeld waren die sogenannten „Amastrager“ bis 1848 sogar zünftig organisiert. Im „Baderschen Gasthof“ hatten sie einen Stammtisch, über dem noch 50 Jahre später eine Blechtafel mit Gewerbezeichen und Spruchbanner aus dem Jahr 1820 prangte: „Wir ‚Amastrager‘ sind weit und breit bekannt als arbeitsame brave Leut’. Wir werden von jedermann hochgeehrt, denn unser Gewerb’ ist schätzenswert, und wollen wir einen guten Braten, einen guten Wein, so kehren wir bei unserer Frau Wirthin ein.“
Die Gewinnung der im Volksmund „Ameiseneier“ genannten Puppen, erfolgte je nach Gegend unterschiedlich. Es lassen sich jedoch überall Parallelen erkennen. Peter Rosegger, (Österreichischer Dichter) der nach eigenen Angaben mehrmals Zeuge der Tätigkeit wurde, beschrieb für das Gebiet um Mariazell eine dreiteilige Vorgangsweise: Zunächst musste der aus Nadeln und feinsten Zweigen bestehende Ameisenhaufen geöffnet werden, wozu etwa ein Heindl (vermutlich eine kleine Schaufel?) verwendet wurde. Anschließend wurden die oberen Schichten in einen Sack geschart oder gesiebt und in einer Butte abtransportiert. Gottlieb Tobias Wilhelm beschrieb 1811, dass das Sammeln von Ameisenpuppen nur bei Schönwetter möglich ist, da die Ameisen ihre Puppen nur dann in den oberen, wärmeren Regionen des Ameisenhaufens umlagern. Als Schutz vor der Ameisensäure rieben sich Ameisler die Hände mit Terpentin oder Holunderblüten ein. Gegen Ameisenbisse setzten der Ameisler auch lange Strümpfe ein. Im nächsten Schritt wurde auf einem sonnigen Anger ein großes Leintuch ausgebreitet, der Rand mit Laub bedeckt, umgeschlagen, und die Ecken hochgespannt. Das Sammelgut leerten die Ameisler in die Mitte des Tuchs aus und warteten, bis die Ameisen ihre Puppen unter den Blättern in Sicherheit brachten. Danach mussten die kleinen Häufchen nur noch eingesammelt und sicher verwahrt werden. Rosegger bezeichnete diesen Schritt als „Auslaufen“.
Abschließend musste die Ware getrocknet oder gedörrt werden. Hierzu verwendete man Holzschuppen mit eigenen Trockenräumen („Oalhütten“, die beispielsweise auf der Ötscherwiese mit Kugelöfen beheizt wurden.
Beispiel eines mächtigen Waldameisenhaufens
Andere Methoden wie das Ausheben von Fanglöchern oder kleinen Wassergräben sind etwa aus dem böhmisch-mährischen Grenzgebiet (Karl Hans Strobl, 1944) oder der Oberpfalz (1920er) überliefert. War die Ware getrocknet und verpackt, wurde sie in der Stadt vorwiegend an Vogelhändler und Züchter verkauft. Ein beliebter Verkaufsplatz war der Wiener Naschmarkt, auf dem um die Jahrhundertwende vor allem Ameisler aus Hainfeld ihre Ware feilboten. Eine Familie Bandion aus Annaberg, die das Sammeln von Ameisenpuppen bis ins 21. Jahrhundert fortsetzte, belieferte zunächst per Motorrad den Meidlinger Markt. Später dann, wurde die Ware vom Händler persönlich abgeholt.
Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Hainfeld noch sechs gewerbliche Ameisler. Durch die zunehmende forstrechtlichen und naturschutzrechtlichen Einschränkungen, sowie die Aufhebung des Zunftzwanges, war es nunmehr jedem erlaubt zu sammeln, der die gesetzlichen Auflagen beachtete und das führte zum langsamen Niedergang dieses Gewerbes. Dennoch hielt sich die Tätigkeit vielerorts bis in die 1970er Jahre, wie eigens ausgestellte Erlaubnisscheine der niederösterreichischen Landesregierung belegen. Zwischen 1957 und 1975 wurden immerhin noch 270 dieser Lizenzen vergeben. Dass das Sammeln von Ameisenpuppen durchaus lukrativ sein konnte, zeigen folgende Zahlen: 1859 erzielte man für eine Saisonernte von 20 Metzen einen Gewinn von 150 bis 500 Gulden, was einem Gegenwert von 100 Metzen Getreide entsprach. In den 1960er Jahren reichte der in nur vier bis sechs Wochen erwirtschaftete Saisonerlös beispielsweise für den Kauf eines Fernsehapparats. 6)
Sicher muss nicht erwähnt werden, dass dieser Beruf heute überall aus Naturschutzgründen strikt verboten ist, denn die oft einen Meter hohen riesigen Gebilde eines Ameisenhaufens sind streng geschützt. Niemand mehr wird in den Ameisen ein Ungeziefer oder Schädling sehen, sondern die Nützlichkeit im ökologischen Kreislauf der Natur. Zu einem Synonym wurde außerdem der sprichwörtliche Fleiß der Ameisen.
5 ) https://berufe-dieser-welt.de/ameisler/
6 ) https://de.wikipedia.org/wiki/Ameisler
3
Blaudrucker
Mit Blaudruck wird eine Färbetechnik bezeichnet, die weiße Küchenschürzen, Topflappen, Tischdecken, Taschentücher und andere Textilien mit prächtigen Ziermustern versieht. Die Technik stammt aus dem asiatischen Raum und kam im 17. Jahrhundert nach Europa. Heute finden sich nur noch sehr wenige Blaudrucker, welche die alte und sehr aufwändige Technik noch beherrschen. Es ist somit tatsächlich ein aussterbender Beruf.
Beim traditionellen Blaudruck wurden blau-weiße Muster auf Naturstoffen, wie Leinen, Baumwolle oder Seide, unter Anwendung der Reservetechnik hergestellt.
Das Drucken des Musters erfolgt mittels einer Deckmasse, „Papp“ genannt, auf dem Gewebe, welches bei der anschließenden Färbung im Färbebad ausgespart wird. So entstehen weiße Muster aus der ursprünglichen Farbe des Stoffes auf blauem Grund. Wegen des blauweißen Dekors wurde im 18. Jahrhundert der Blaudruck auch Porzellan-Druck genannt. Blaudrucker sind spezialisierte Blaufärber, schlussendlich wird ja auch blau gefärbt und nicht blau gedruckt.
Was allgemein „Blaudruck“ heißt, nennen die Fachleute „Reservedruck“, da mit dem Blau nicht gedruckt, sondern gefärbt wird. Das Muster wird durch eine Reservage, „Papp“ genannt, auf dem Stoff abgedeckt und bleibt beim Färben weiß, also „reserviert“. Die Zusammensetzung der Reservage ist für den Erfolg der Arbeit wichtig, denn sie muss auf dem Stoff gut haften. Früher hielten die Druckerfamilien die Zusammensetzung der Druckmasse streng geheim. Manches ist uns jedoch bekannt geworden, da die auf Wanderschaft befindlichen Drucker sich notierten, was sie erfahrenen Meistern abschauen konnten.
So notierte ein Diederich Buddeberg aus Lippstadt in seinem 1810 ausgestellten Wanderbüchlein: Besten weißen Druck: 4 Pfund Ton, 2 Pfund Blaustein, 1 Pfund Grünspan, 1/8 Pfund Weinsteinsäure, 1 1/2 Pfund Gummi. Auch für die Farbküpe, die Färberlösung, gab es die verschiedensten Rezepte.
Wie man in den Bildern sieht, bleiben die „bepappten Stellen“ weiß und nehmen die blaue Farbmischung nicht an, so entstehen die schönen Ornamente.
Durch die Wanderschaft der Blaudrucker kam es nicht nur zum Austausch der Rezepte, sondern auch des Formenschatzes der Druckstöcke, den Models. Eine mittlere Blaudruckwerkstatt besaß Ende des 19. Jahrhunderts etwa 500 bis 1000 Model.
Blaudruckergesellen mussten, um Meister werden zu können, drei Jahre lang auf die Walz gehen. Dadurch verbreitete sich der Blaudruck rasch in ganz Mitteleuropa. Und so ist auch die Ähnlichkeit der Modelmuster zu verstehen. Den größten Aufschwung erlebte der Blaudruck im 17. und 18. Jahrhundert. 1785 erfand der Schotte H. Bell die Walzen-Druckmaschine, wodurch der maschinell billiger hergestellte Gewebedruck nach und nach den handgemachten Blaudruck verdrängte.
Heute wird der Blaudruck industriell mittels Direktdruck und dem Ätzdruck nachgeahmt. Aber es gibt auch noch und wieder einige Textilkünstler, die das traditionelle Blaudruckverfahren praktizieren. Verwendung finden Blaudruckstoffe für Trachten, Kleidung, Schürzen, Kopftücher und modische Accessoires, aber auch als Möbelbezug, Vorhänge, Bettwäsche, Tischtücher und ähnliches.
Im Dezember 2016 wurde der Blaudruck von der Deutschen UNESCO-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. 7)
Vergleichsweise werden heutzutage immer noch Ostereier von Spezialisten mit der gleichen Methode, des Abdeckens mit Bienenwachs, gefärbt. Dort, wo das aufgetragene Wachs am Ei anhaftet, bleiben die Eier beim Färben weiß.
7) https://berufe-dieser-welt.de/die-blaudrucker/
4
Bleistiftmacher
Seit Jahrtausenden werden visuelle Botschaften mit der Hand vermittelt. Sie wurden in Stein geritzt oder mit Holzstiften in weichen Ton, mit bunten Steinen hinterlassen, mit farbigen Säften aufgetragen, tätowiert oder in anderer Weise hinterlassen. Irgendwann ist der findige Mensch auf das Blei gestoßen und konnte damit Zeichen malen. Schon in alter Zeit hatte man erkannt, wie wertvoll es ist, wenn man Botschaften dauerhaft vermitteln kann, denn Nachrichten hinterlassen oder sich einfach mit Worten auszudrücken, seine Meinung, seine Ansichten und Wünsche zu offenbaren, war in alter Zeit nur mündlich möglich.
„Was du schwarz auf weiß besitzt, kannst du getrost nach Hause tragen“, ist ein altbekanntes Zitat von Johann Wolfgang von Goethe.
Bereits die alten Ägypter sollen im nächsten Schritt flüssiges Blei in Schilfrohre gegossen und damit Zeichen geschrieben haben. Das kann man sicher als Vorläufer eines Bleistifts bezeichnen. Dass Blei, das dem Stift den Namen gab, giftig war, wusste zu diesem Zeitpunkt allerdings garantiert noch niemand.
Die im Mittelalter von Gelehrten und Schreibern benutzten Silberoder Bleigriffel hatten mit giftigem Blei bestückte Spitzen, mit denen sich allerdings eher ritzen, denn schreiben ließ. Daher hat man sie etwas abwertend auch Reißblei oder Schreibblei genannt. Gesichert ist, dass seit fast 600 Jahren der Bleistift in der heutigen Form existiert und benutzt wird, doch erst viel später wurde die Bleistiftmacherkunst öffentlich erwähnt.