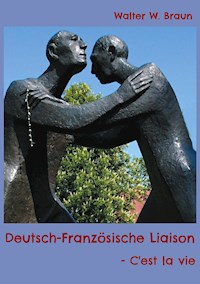Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Schwarzwälder Kirschtorte und der Schwarzwälder Schinken sind weltweit ein Begriff und werden als Originale gehandelt. Solche Individuen gibt es aber auch unten uns Menschen. Es sind herausragende Persönlichkeiten, Charaktere, die man durchaus als Originale sehen und bezeichnen darf. Von einer solch speziellen Persönlichkeit soll hier die Rede sein. Ist es nicht so? Im Leben begegnen uns jahraus, jahrein Menschen, die kaum dem Blickfeld entschwunden sind, haben wir ihre Namen schon wieder vergessen. Mit manchen leben wir Jahrzehnte zusammen, sogar Tür an Tür, und wir wissen trotzdem im Grunde nichts von ihnen. Sie bleiben uns ein Buch mit sieben Siegeln, hinterließen keine Spuren, tauchten kurz einmal auf, spektakulär, vielleicht wie ein helles Strohfeuer oder ein strahlender Komet am nächtlichen Himmel, sie begleiten uns ein Wegstück, hinterließen aber keine Eindrücke in unserem Gedächtnis. Irgendwann sind sie dann ins Meer des Vergessens entschwunden. Dann treffen wir immer mal wieder auf Persönlichkeiten, die uns von Anfang an gefangen nehmen, beeindrucken, mit denen wir uns gerne beschäftigen. Wir empfinden sie als ein Gewinn, ihre Namen sind noch Jahrzehnte in unserem Gedächtnis eingemeißelt und wir erinnern uns gut an kleinste Details und Einzelheiten, als wäre es erst gestern gewesen. Bilder tauchen auf, ob schöne Dinge und Erlebnisse oder Einzelheiten, die eigentlich nicht erwähnenswerte Banalitäten waren, trotzdem, sie sind noch lebendig und präsent.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Das alte Haus am Schrofen
2 Ein gewiefter Geschäftsmann
3 Der Emil-Sepp, ein alter Haudegen
4 Schwerverletzt
5 Mit taffen Frauen auf den Feldern
6 Schwergewichtig
7 Prickelndes Abenteuer am Waldesrand
8 Eine Flasche Bier beim Messmer
9 Einträgliches Tannenzapfenpflücken
10 Der alte Genießer
11 Epilog
Vorwort
Die Schwarzwälder Kirschtorte und der Schwarzwälder Schinken sind weltweit ein Begriff und werden als echte Originale gehandelt. Solche Individuen gibt es aber auch als Menschen, herausragende Persönlichkeiten, die man durchaus als Originale sehen und bezeichnen darf. Von einem solchen soll hier die Rede sein.
Ist es nicht so? Im Leben begegnen uns jahraus, jahrein Menschen, die kaum dem Blickfeld entschwunden, haben wir ihre Namen schon wieder vergessen. Sie hinterließen keine Spuren, tauchten kurz einmal auf, spektakulär, vielleicht wie ein helles Strohfeuer oder ein strahlender Komet am nächtlichen Himmel, sie begleiten uns ein Wegstück, hinterließen aber keine Eindrücke in unserem Gedächtnis. Irgendwann sind sie dann ins Meer des Vergessens entschwunden.
Dann treffen wir immer mal wieder auf Persönlichkeiten, die uns von Anfang an gefangen nehmen, beeindrucken, mit denen wir uns gerne beschäftigen. Wir empfinden sie als ein Gewinn, ihre Namen sind noch Jahrzehnte in unserem Gedächtnis eingemeißelt und wir erinnern uns gut an kleinste Details und Einzelheiten, als wäre es erst gestern gewesen. Bilder tauchen auf, ob schöne Dinge und Erlebnisse oder Einzelheiten, die eigentlich nicht erwähnenswerte Banalitäten waren, trotzdem, sie sind noch lebendig und präsent.
Mit anderen leben wir Jahrzehnte zusammen, sogar Tür an Tür, und wir wissen trotzdem im Grunde nichts von ihnen. Sie bleiben uns ein Buch mit sieben Siegeln.
Von einem außergewöhnlichen Menschen ist hier die Rede, einem Original aus dem Schwarzwald, der in einem entlegenen Nebental der Kinzig nicht nur bei mir seine tiefen Spuren hinterlassen hat, sondern in gewisser Weise mein Leben nachdrücklich prägen konnte. Der Emil-Sepp, Protagonist dieser Familien-Saga, wurde für mich zum Lehrmeister, sowohl im positiven, als auch negativen Sinne.
Gäbe es mehr solcher Menschen, wäre das Leben wahrlich bunter und vielfältiger. Deshalb will ich dem „alten Knochen“, wie er sich selber gerne nannte, hiermit ein Denkmal setzen.
1
Das alte Haus am Schrofen
Ein unangenehm kühlfeuchter Wind blies an diesem nasskalten und ungemütlichen Frühjahrstag des Jahres 1950 durch Tals, als ich zum ersten Mal als 6-jähriger Bub die knarrende Stiege im alten Haus zwischen dem wuchtigen Gebäude des Nachbarn, dem Emil-Sepp und dem etwas bescheideneren Zweifamilienhaus vom Maurermeister-Lehmann aufwärts eilte. Das Gebäudeensemble stand am Schrofen, links im engen Tal, des bekannten Kurortes Nordrach.
Sehr viel war es nicht, was wir an Möbel und Kleidung in die Wohnung hochtragen mussten, die nun für die nächsten vier Jahre unser Zuhause werden sollte. Das waren acht einfache Stühle und ein großer Wohnzimmertisch, die in die Wohnstube kamen, zwei weitere Stühle und Waschkörbe mit Geschirr in die Küche. Dann war es noch das alte Elternschlafzimmer mit Schrank und Doppelbett, Matratzen, sowie zwei Einzelbetten für uns Kinder ins kleinere Kinderzimmer. Eines davon war das Kinderbett für unsere kleine Schwester und das größere mussten mein Bruder und ich uns teilen. Zwei Nachttischschränkchen gab es auch noch. Eines kam zu uns ins Zimmer, das andere ins Schlafzimmer der Eltern. Das schwerste Teil ein alter Küchenherd, der sicher vier Zentner auf die Waage brachte. Und dann waren es noch Küchenutensilien, Kleidung und anderer Krimskrams, das war‘s aber dann schon.
Der Umzug war in einem Tag bewältigt. Der Vater hatte zwei Arbeitskollegen vom Maurergeschäft Lehmann nebenan gewinnen können, die ihm geholfen haben. Es waren bärenstarke Männer vom Bau und der eine meinte auch: „Wenn ich den Herd nicht mit einem Arm tragen kann, dann ist er schwer.“ Doch Spaß beiseite, sie haben ihn zu dritt tragen müssen. „Kumm moch des Ding nit kaputt, s’het Geld koscht.“ frotzelte einer der Träger. Die Stiege hoch zur Wohnung war steil und schmal und das machte es mühsam und schwer. Sämtliche unserer Sachen hat der Kohlenhändler Ewald Körnle vom Untertal uns in einer einzigen Fuhre transportiert. Er war mit seinem offenen Pritschenwagen vorgefahren, hatte ihn aber vorher schon mit ein paar Eimer Wasser oberflächlich sauber gemacht.
Wir drei Kinder waren mit den Eltern von einem noch älteren Haus in der Kolonie hierher ins Dorf gekommen und nun als Mieter eingezogen. Der dreiteilige Gebäudekomplex lag etwa 500 Meter von der Dorfmitte entfernt. Im Dorfkern stand auf kleinem Raum das Rathaus nahe der dominierenden Kirche mit neugotischem Turm über dem Bach und dem Friedhof direkt in der Nachbarschaft. Der Namen „Schrofen“ verrät es schon – steiles, steiniges Gelände. Die Häuser schienen direkt in den rückseitig hoch aufragenden Felsen hineingehauen zu sein. Das Gelände war neben teils nacktem Fels mit allerlei Buschwerk und Dornen bewachsenen. Das alte und ein wenig baufällig wirkende Haus in der Mitte, unser neues Wohnreich, stand sicher als erste, bevor links und rechts die größeren, prächtigeren Gebäude angebaut worden sind. Im ebenerdigen Keller blickte man bergseitige Wand auf nackten Fels und dort sickerte immerzu ein Rinnsal Wasser vom Berg, das sich in einer Rinne im gestampften Lehmboden sammelte und in einem Kanalisationsrohr abgeleitet wurde, das ins Nirgendwo zu verschwinden schien. Vermutlich hatte man beim Bau dieser drei Hauseinheiten viel Fels abschlagen oder sprengen müssen, bis die vorgesehene Grundfläche groß genug war. Somit konnte man durchaus sagen: „Diese Häuser am Schrofen waren auf Felsen gegründet.“
Rückseitig des Hauses stabilisierte eine zwei Meter hohe Steinmauer den Hang oberhalb und darüber befand sich noch ein kleiner Garten, in dem die Mutter Gemüse anpflanzte und Kräuter zog. Danach kamen Felsen und der blanke harte Granit ragte fast senkrecht aufwärts. Das wurde für mich und meinen jüngeren Bruder zum idealen Kletterparadies. Wie oft sind wir da in den Felsen nach oben gestiegen und haben uns als Bergsteiger, Kletterer oder Abenteurer gefühlt. Der Innenhof bot auf einigen Quadratmeter ausreichend Platz. Hier konnte die Mutter ihre Wäsche an längs gespannten Seilen aufhängen und trocknen lassen. Von dieser Mauer sickerte auch ständig Wasser vom Hang, wie im Kellere darunter. Wenn es einmal länger geregnet hatte, verstärkte sich das, ohne dass wir aber eine Überschwemmung in der Wohnung befürchten mussten, wenn, dann eher vom maroden Dach.
Im hinteren Bereich dieses Platzes, zum Lehmann-Maurer hin, war ein kleiner Anbau und mit Plumpsklo aus Holz mit einem kreisrunden Loch in der ausladenden Sitzfläche. Toilettenpapier auf der Rolle war weder bei uns noch bei anderen überall üblich. Dafür hingen ein paar auf etwa DIN A 4 geschnittene Zeitungsabschnitte am Nagel. So war das damals noch, Anfang der 1950er Jahr, in den meisten alten Gebäude, zumindest auf dem Land herrschte noch Bescheidenheit. In den Städten mag es vielleicht schon etwas moderner zugegangen sein, das entzieht sich meiner Kenntnis. Von einem gefliesten und beheizten Bad und einer Toilette mit weißem Keramikklosett und fließendem Wasser konnte keine Rede sein, davon war noch nicht einmal zu träumen. Das änderte sich in den Häusern peu à peu erst zehn bis zwanzig Jahre später, nachdem die Einkommen bei zunehmender Vollbeschäftigung in der Bevölkerung deutlich angestiegen waren.
Der alte Zwischenbau mit grobem Holzbohlenfußboden im nach der Straßenseite zugewandten und spärlich möblierten Wohnzimmer, aber auch im Schlafzimmer der Eltern, sowie der nach hinten ausgerichteten dunklen Küche mit Steinboden, in dem der zentnerschwere Herd unserer Mutter gute Dienste tat. Dem schloss sich das immer etwas duster wirkende Kinderschlafzimmer an, in das kaum Licht von außen eindrang. Die Wohnung war streng gesehen abbruchreif. So eng sah man das damals aber nicht. Jedermann war froh ein bezahlbares Dach über dem Kopf zu haben, da waren unsere Eltern nicht ausgenommen.
Ebenerdig war der separate Zugang in den erwähnten feuchten Keller, in dem die Eltern ihren Kartoffelvorrat lagerten und dort standen das Jahr über zwei gut gefüllte Fässer Most, der Getränkevorrat für den Vater. Reines Leitungswasser, das vielleicht besser gewesen wären, trank niemand gerne, nicht einmal in den kargen Zeiten und täglich eine oder mehrere Flaschen Bier kaufen, das konnte sich die Eltern nicht leisten.
In dem dunklen, feuchten Kellerloch überraschte die Mutter uns Buben einmal dabei, wie wir mit einem langstieligen Steinklopfer-Hammer eine stattliche Ratte traktierten. Sie schrie entsetzt auf und machte uns später bittere Vorwürfe: „Die Ratte hätte euch anfallen, bös angreifen und verletzen können, die beißen arg“, so ihre Sorge. „Das sind keine Kuscheltiere.“ Vielleicht war die Ratte aber schon altersschwach oder krank und hatte sich deshalb nicht gewehrt. Vielleicht hatten wir auch schlichtweg nur großes Glück.
Oberhalb der Wohnung lag der Dachboden, die „Bühni“, wie man im Badischen dazu sagt, direkt unter dem alten, nicht isolierten Ziegeldach. Bei starkem Wind regnete es herein und oft heulte der Wind durch die Ritzen. Auf dem Dachboden lagerte eine Menge altes Zeug von uns oder anderen. Ratsam war es allerdings nicht, mehr als nötig dort herumzulaufen oder sich aufzuhalten. Einmal wollte der Vater von oben etwas holen und ist dabei durch die Decke durchgebrochen und ist in einer Staubwolke mit einem Quadratmeter Schlacken, Stroh und Holz des Zwischenbodens in der Küche darunter gelandet. Zum Glück ist ihm nicht schlimmes passiert. Nur schmerzhafte Prellungen trug er davon, aber keine Brüche. Das zeige aber, wie marode die Bausubstanz war.
Entlang der straßenzugewandten Seite verlief eine breite Auffahrtrampe zu beiden Anwesen, von der aus die Treppen zu den Wohnungen oberhalb aufstiegen. Die damals mit grob geteertem Splitt belegte Dorfstraße ging von Zell vorbei und ins Hintertal, in die Kolonie. Böse Zungen behaupteten, „dort wäre die Welt mit Brettern vernagelt oder es ist das Ende der Welt.“ Eine schmale und kurvige Straße ging aber weiter über das Schäfersfeld und dem Löcherberg ins Renchtal oder hinüber nach Oberharmersbach ins Nachbartal.
Beim Haus auf einem kurzen Teilstück dieser Straße hat mir die Mutter kurz darauf das Fahrradfahren beigebracht, was nicht ganz ohne Schürfwunden an den Fußflächen abging. Beim Üben bin ich mit den nackten Füßen von der Pedale gerutscht und auf dem Split weitergeschlittert. Die Fahrrad-Pedalen dieser alten Rädere waren noch aus Metall und das war mit blanken Sohlen ohne Schuhe sehr rutschig.
Das Ende der Rampe mündete in einen nach vorne offenen Schuppen und darin stand eine Obstpresse, die „Mosttrotte“ und dort lagerten allerhand Gerätschaften vom Emil-Sepp, dem Hausbesitzer und unserem Vermieten. Unter dem Dach dieses Schuppens stand auch sein Allerweltsgefährt, der dreirädrige „Kuli“ trocken, wenn es nicht benützt wurde. „Kuli“ stand für einen sehr geländegängigen Pritschenwagen mit Motor und einem Fahrersitz über dem Motor. Das Fahrzeug wurde mit einem Lenker über dem Vorderrad gesteuert. Die Fahrzeuge fertigte die Maschinenbaufirma Guggenbühler, nur rund hundert Meter unterhalb dem Dorf zu. Später wurden sie unter dem Markennamen „Ladog“ vertrieben und sie werden auch heute noch gebaut. Man darf zu Recht behaupten, sie haben sich in der bergigen Landschaft sehr gut bewährt und erfolgreich durchgesetzt.
Auf der Fahrzeugpritsche lagen immer leere oder gefüllte Säcke und sie dienten allgemein für die Mitfahrer zum Sitzen. Alles, was bei der Arbeit an Hacken und Rechen oder anderem Werkzeug auf den Feldern gebraucht wurde, sowie Zainen und Körbe, wurden ebenfalls damit transportiert. Auf der Pritsche saßen ich, wenn ich dabei war und immer auch einige Frauen, die auf den entlegenen Feldern bei der Arbeit mithalfen.
Der Emil-Sepp steuerte den „Kuli“ und man tuckerte gemächlich, mit allenfalls doppelter Schrittgeschwindigkeit auf der Straße und den Wegen dahin. Wer schnell ging konnte gut nebenher mitlaufen.
Damit kam der Emil-Sepp überall dahin, wohin er wollte und er konnte ungeahnt viel damit transportieren. Nur wenn die Heuernte einzufahren war oder gelegentlich größere Ladungen zu transportieren waren, besorgte er sich einen großen Leiterwagen und zwei Pferde. Sogar mit einem Ochsengespann war ich hin und wieder mit ihm unterwegs. In der Erntezeit musste er nehmen, was als Transportmittel von irgendwoher zu bekommen war. Doch es fand sich immer etwas und die notwendigen Arbeiten konnten getan oder die Ernten eingebracht werden, wenn nicht an diesem Tag, dann an einem anderen. Unter Zugzwang setzte ihn nur das Wetter.
Doch noch einmal ein Blick zurück zum neuen Zuhause. Bei allen geschilderten Nachteilen war die Wohnung im Zwischenbau immer noch eine Verbesserung zu den bescheidenen Wohnverhältnissen zuvor in der Kolonie. Nicht nur meine Eltern durften damals wählerisch sein, alle waren froh, ein bezahlbares Dach über dem Kopf zu haben. Eine Wohnung war knapp, denn auch in Nordrach, einem Nebental der Kinzig im Mittleren Schwarzwald, mussten Flüchtlinge aus dem Osten aufgenommen werden, die nach dem Krieg zu Zigtausenden in den Westen eingeströmt sind. Jeder Gemeinde wurde ein Kontingent zugeteilt und diese Menschen mussten irgendwie und in allem, was noch bewohnbar war, untergebracht werden, auch wenn das noch soweit vom Dorfzentrum entfernt lag.
Der heruntergekommene Wohnungszustand war aber nicht der Grund, was die Eltern zum Umzug ins Dorf und an den Schrofen bewog, sondern das bisher schon von den Großeltern mütterlicherseits bewohnte alte Haus hatte der Eigentümer gekündigt. Es war ein Neubau mit Schuhmacherwerkstatt geplant und sollte deshalb abgerissen werden. Jetzt rächte es sich für die Eltern, dass die 1946 verstorbene Oma Zäzilie, die Mutter unseres Vaters, das alte Haus im Hintertal nicht gekauft hatte, wie es der Vater beabsichtigt und gewollt hatte. Er war vor dem Krieg freiwillig zum Arbeitsdienst gegangen und von da gleich zur Wehrmacht. Erst musste er sich in Russland beim Militär in waghalsigen Einsätzen bewähren. Dafür hatten sie ihm das EK 1 und das EK 2 verliehen. Danach lebte er im Elsass „wie Gott in Frankreich“ und verdiente gut. Von seinem Einkommen brauchte er für sich aber wenig. Von den Ersparnissen übergab er zweimal die Summe seiner Mutter, damit sie das Haus kaufen sollte, in dem die Familie schon denkbar lange wohnte. Die Oma spielte aber lieber die Grande Dame verbraucht das Geld für sich. Mein Großvater war schon lange verstorben, mit ihm wäre es sicher anders gekommen.
Während der Zweite Weltkrieg schon in den letzten Zügen lag, passierte, was nicht hätte passieren dürfen, der Vater ist im Elsass verunglück und erlitt schwerste Verletzungen. Darunter litt er bis zum Lebensende und er kam aus den Kliniken auch erst 1946 wieder nach Hause, in dem Jahr, in dem seine Mutter, meine Großmutter, gestorben ist. Das schlichte Haus, das schon seine Eltern bewohnten, war auch unser zuhause, wir wohnten dort noch fünf Jahre, bis der Hausherr gekündigt hatte. Doch wenn ein Umzug schon unvermeidlich war, dann wollten sie doch lieber ins Dorf hinaus wechseln. Das lag verkehrstechnisch günstiger, als das sechs Kilometer vom Dorf entfernte Hintertal und die Kolonie – „der einzigen Kolonie Deutschlands“, wie man damals das spöttisch bemerkte. Im Dorf gab es einen Kindergarten, der von Nonnen geführt wurde, und verbachte ich noch etwa ein Jahr, bis ich im Herbst 1951 in die Schule kam.
Die Talstraße in die Kolonie führte direkt am Haus vorbei und nur einen Steinwurf entfernt plätscherte der immer gut wasserführende Bach, der vom Hintertal kam, Zell zufloss, dort sich mit dem Harmersbach vereinigte und in Biberach in die Kinzig mündete. Die schlichte Dreizimmerwohnung mit Küche und dunklem, feuchtem Keller gehörte dem Nachbar im linken Nebengebäude, dem Emil-Sepp – sein richtiger Name war Josef Ficht er wurde aber nur Emil-Sepp genannt – und seiner kleinen, rundlichen Frau Walburga, zu der wir Kinder entweder „Oma Walburga“ sagten oder meistens Emil-Seppin, wogegen sie nichts hatte.
Der Emil-Sepp war ein waschechter Nordracher, ein weit über die Region hinaus bekanntes Original, der inzwischen auf die sechzig zuging. Groß war er nicht, vielleicht so 1,75 m und dazu ein wenig übergewichtig, aber seinem Alter entsprechend erstaunlich fit, drahtig und beweglich.
„Meine Vorfahren wohnen seit Menschengedenken schon in diesem Tal unter den Höhen des Mooskopfs. Ich bin überzeugt und mir sicher, sie gehörten zu den Ersten, die vor Jahrhunderten dieses Tal besiedelt und die Ländereien kultiviert haben“, berichtete er mit einmal mit stolzgeschwellter Brust.
„Und unser Name Ficht besagt ja schon, dass wir immer eng mit dem Wald und den Bäumen verbunden waren.“
„Da braucht mir keiner von den Hereingeschmeckten dumm kommen oder etwas vormachen wollten“, fügte er trotzig hinzu.
Der für mich alte Mann war ein echter Haudegen, ein pfiffiger, wortgewandter Schürzenjäger und unglaublicher Sprücheklopfer. Seine Affären mit dem weiblichen Geschlecht schienen legendär und mit dem Mund war er als Liebhaber noch größer. Überdies war er gnitzig (spitzbübisch, schelmenhaft), auch ein ausgesprochenes Schlitzohr. Entsprechend unkompliziert verstand er es, galant mit allen Frauen umzugehen.
Mit seiner kleinen, aber sehr rundlichen Frau betrieb er eine gutgehende Pflanzen- und Baumschule. Doch so klein seine Frau war, so durchsetzungsfähig zeigte sie immer wieder und sie war nie auf den Mund gefallen. Mag ihr Mann noch so viele Affären außer Haus gehabt haben, und in meiner Kinder- und Jugendzeit noch nachgegangen sein, zu Hause hatte sie das Sagen und eindeutig die Hosen an. Wir sahen sie, seit wir sie kannten, nur in der üblichen Bauerntracht, mit nach vorne zugeknöpfter blau gefärbten Bluse, einem weiten Rock und darüber, die über dem rundlichen Bauch und unterhalb des stattlichen Busens vorne gebundenen Schleifen. Die schon silbergrau gewordenen Haare trug sie in einem Kranz um den Kopf geflochten und die Haarpracht eng mit einem umlaufenden Sametbendel (Seidenband) gehalten.
Heimlich lauschten wir Kinder von außen gerne den Beiden lautstark geführten Diskussionen und der in Wellen hin und her gehenden Unterhaltungen in der Küche nebenan. Manchmal hörte sich das wie Streit an, was aber nichts anderes war, als eine deftige Unterhaltung und nachdrücklich geführten Diskussion ohne jegliche Aggressivität. „Wer sich liebt, der neckt sich“, sagt der Volksmund und hier mochte es durchaus zutreffen. Wenn es auch keine innige Liebe war, so war es doch zumindest ein zweckgebundenes freundliches Miteinander. Sie waren seit Jahrzehnten verheiratet und damals verließ kaum einmal eine Frau den Mann, egal was für ein Hallodri er auch war. Sie hätte zu dieser Zeit weder eine Versorgung gehabt noch über Rechte verfügt. Wer geschieden war, war zudem gesellschaftlich diskreditiert und unten durch.
„Wo warsch widder, du Lumpeseggel, du liedriger, hesch widder in’de Wirtschaft hocke un suffe müsse“, hörten wir sie in anpaffen.
„Nei, i war g‘schäftlich unterwegs, loss’mer min Ruh, Aldi“, gab er zur Antwort, und dann gingen sie zur Tagesordnung über.
Man ging im ländlichen Raum und in einem Schwarzwälder Dorf nie zimperlich miteinander um und auch im Badischen wurden derbe Worte unter Eheleuten nicht und niemals auf die Goldwaage gelegt. Andererseits war die Walburga, die Emil-Seppin, eine mütterliche und herzensgute Frau, die uns Kindern viel Gutes tat und wir von ihr oft etwas zugesteckt bekamen. Vielleicht wusste sie, ihr Mann ist mit einer unglaublichen Libido gesegnet und musste sich irgendwo austoben dürfen. Bei ihnen war im Bett vielleicht schon etwas Langeweile eingekehrt oder vermutlich ging da nichts mehr, sie war aber und blieb es, sein älter gewordenes Weib.
Im Obergeschoss unter dem ausladenden Dach wohnte ihre Tochter Maria mit ihrem Sohn Wilhelm. Das war deren ihr Heim und Reich. Für den Enkel vom Emil-Sepp Wilhelm begann ein Jahr später wie auch für mich die Schulzeit und wir begleiteten uns acht Jahre. Das bezog sich keineswegs nur auf die Stunden in der Schule. Oft waren wir gemeinsam unterwegs, heckten Streiche und Dummheiten aus und träumten von spannenden Abenteuern.
Die Wohnung von Tochter und Enkel hatte längsseitig zur Straße hin einen Balkon, von dem sich ein freier Blick hinunter auf die Straße bot, hinüber zur Siedlung „Huberhof“ oder zur yweit oberhalb verlaufenden Höhenlinie, den Flacken, dem Teschenkopf und der Simonsebene. Diese Höhengebiete auf der rechten Talseite von Nordrach sollten für mich später noch mehrfach eine wichtige Rolle spielen.
Unter dem mächtig ausladenden Satteldach war der Heuschober mit direktem Schacht nach unten in den Kuhstall. Auf diese Weise konnte das Heu von oben auf direktem Weg vom Dachboden zu den Kühen im Stall geschafft werden. Der weitläufige Dachboden mit vielen verstaubten Ecken war für uns an Regentagen eine ideale Spielfläche. Oft haben wir mit Wilhelm und anderen dort verstecken gespielt oder allerhand Dummheiten ausgeheckt. Die Fläche schien uns riesig, bot zudem genügend Versteckmöglichkeiten und wir konnten unsere Fantasien ausleben, Räuber und Schandarm spielen und was sonst damals in der Kinderzeit üblich war. Nur auf den Schacht mussten wir achten. Dort war einmal jemand, wie uns der Emil-Sepp drohend weiß machen wollte, hinuntergestürzt und bei den Kühen gelandet. Er habe sich dabei schwer verletzt. Ob es stimmte, oder uns nur zu Vorsicht anhalten sollte, weiß ich nicht. Ich denke, es konnte nicht sein, denn ein Sturz von rund 10 Meter wäre sicher nicht ohne schwerwiegende Folgen geblieben.
Der großflächige Dachboden bot Raum für das eingelagerte Heu, für Brennholz, Gerätschaften und vielem anderen. Es war für mich schon erstaunlich, was auf solche einer begrenzten Fläche alles untergebracht werden konnte. Nur hatte es zu anderen Bauernhäusern einen Nachteil, es gab vom Berg her keine Zufahrt. Alles, was auf die „Bühni“ hochgeschafft werden sollte, musste von der Auffahrt auf der Straßenseite mit der Seilwinde hochgezogen. Dafür hing am obersten Firstbalken eine Umlenkrolle und über sie lief ein dickes Seil. Je nachdem, was hochtransportiert werden sollte, mussten kräftige Hände ordentlich ziehen, bis die Last oben war und dort abgenommen werden konnte.
Maria, die Tochter vom Emil-Sepp hatte sich während dem Zweiten Weltkrieg mit einem Mann verlobt, zur Heirat ist es aber nicht mehr gekommen. Von ihm bekam sie im Dezember 1944 ihren Sohn Wilhelm. Der Verlobte ist nach dem Krieg nicht mehr nach Hause gekommen und blieb dauerhaft vermisst. Von Nordrach sind 88 Bürger im Krieg gefallen und insgesamt 47 galten als vermisst. Vermutlich ist der zukünftige Schwiegersohn des Emil-Sepp in Stalingrad gefallen. Sie haben nie mehr etwas von ihm gehört, deshalb musste die Mutter ihren Sohn Wilhelm alleine aufziehen oder sie tat es gemeinsam mit seinen Großeltern.
„Wilhelms Vater wurde von dem Verbrecher Hitler in Stalingrad als Kanonenfutter verheizt“, klagte der Emil-Sepp einmal, im Gedenken an den möglichen Schwiegersohn. „Millionen Menschen sind diesem braunen Teufel und seiner Bande zum Opfer gefallen. Ich hoffe, der Teufel heizt ihnen in der Hölle gehörig ein.“ So wütend wie in diesem Augenblick habe ich ihn noch nie gesehen.
In vielen Stunden, während ich mit dem Emil-Sepp alleine in den Weihnachtsbaumkulturen oder in den Wäldern unterwegs war, wurde er für mich zu einem guten Lehrmeister über die jahrhundertelange Geschichte des Tales. Er erzählte mir die Sage vom Moospfaff. Eine von drei erzählten Varianten war: Es war ein Mönch vom Kloster Allerheiligen, der einst auf dem Weg zu einem Sterbenden die Hostie verloren hat. Seiter streift er als ruhelose Seele um den Mooskopf und durch die dichten Wälder, um arglose Wanderer zu erschrecken.
„Bisch ihm scho emol begegnet?“, wollte lachend von mir wissen.
„Nein, das muss aber auch nicht sein, Angst habe ich keine, aber schnell rennen kann ich gut“, erwiderte ich genauso hintersinnig.
Viele andere Geschichten wusste er mir ebenfalls noch zu erzählen und auch von Sagen und Mythen, die man sich früher an dunklen Abenden bei Kerzenschein in den Stuben zum Besten gab und den Kindern damit ein Schaudern über den Rücken jagte. Langweilig ist es mir geworden, wenn ich mit ihm unterwegs war. Spannend und prickelnd waren aber nicht nur seine Erzählungen, bei denen ich immer überlegen musste: „Will er mich jetzt auf den Arm nehmen, kann das sein, war das wirklich so, was er mir sagte, ist das echt?“ Dann war es wieder an einem speziellen Tag und er fuhr mit mir nachmittags ins langgezogene Ernsbachtal hinein, an dessen Ende man zum Gengenbacher Naturfreundehaus kommt. Dort ließen wir uns manchmal an einem Tisch vor dem Haus niederlassen und er hat mir eine Flasche süßen Sprudel spendierte. Diesmal überraschte uns auf halber Strecke ein heftiges Gewitter. Ein Bauer lief mit ein paar Kühen auch gerade ein Stück weit vor uns eilig seinem Hof zu, um ins Trockene zu kommen. Der Emil-Sepp hatte mit mir schon unter dem Dach einer Hütte am Wegrand Schutz vor dem heftigen Regenguss gefunden. Wir sahen, wie ein greller Blitz in der Nähe der Kühe einschlug. Sie wurden nicht getroffen, spürten aber vielleicht den Stromfluss, denn eine der Kühe machte einen mächtigen Satz vorwärts und rannte mit hochgestelltem Schwanz davon. Es ist ihr nichts passiert und der Bauer konnte sie schnell wieder einfangen.
Bei einer anderen Gelegenheit fuhren wir zum „Eckle“ hoch. Von dort bietet sich, wie auf einem Balkon, ein traumhafter Blick ins Dorf und ins weitere hintere Tal. Etwas weiter oberhalb kamen wir am sogenannten „Judenfriedhof“ vorbei, der dort zwischen hochgewachsenen Bäumen etwas versteckt liegt und einst nach jüdischer Sitte vom Dorf weit abseits im Wald angelegt wurde.
„Hier fanden viele junge jüdische Frauen ihre letzte Ruhestätte, die vor dem Zweiten Weltkrieg aus ganz Deutschland als Lungenkranke nach Nordrach kamen und im Sanatorium Rothschild behandelt und gepflegt wurden, doch verstorben sind. Man hat diese bedauernswerten Geschöpfe hier in einem eigenen Friedhof nach den Ritualen des jüdischen Glaubens beerdigt“, informiert er mich.
„In den 1930er Jahren und noch bis weit über Krieg hinaus hatten wir auch in Nordrach ein paar dieser kleinen Hitler, solche üblen Hetzer, die speichel-leckend dem schwarz-schnäuzigen Gröfaz (größter Feldherr aller Zeiten – wie er sich nannte) nachgerannt