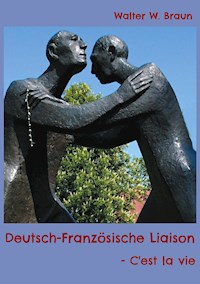Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aufgewachsen in einem engen Tal im Mittleren Schwarzwald, wurde der Autor von den Bergen geprägt. Zahlreiche Bergtouren führten aber erst im reiferen Alter auf mittlere und hohe Berge, und immer war es dann ein erhabenes Gefühl, weit oben über allem zu stehen, dabei Geschäft, Alltag, Sorgen und Stress im Tal zu lassen. Wichtigste Erfahrung wurde: Man kann noch sehr lange, wenn man schon lange nicht mehr kann. Nicht alle Ziele wurden erreicht, manchmal zwangen Umstände, das Vorhaben abzubrechen. Trotzdem war jede Unternehmung mit Freunden und Kameraden ein Erlebnis, in einer grandiosen Bergwelt unterwegs sein zu dürfen und dabei die Sinne zu norden oder zu entschleunigen, wie es heute heißt. Unterwegs in den Bergen ist der Körper in jedem Augenblick mit allen Sinnen gefordert, sind ständig neue Eindrücke zu verarbeiten. Das macht den Kopf frei und man lernt, den Inneren Schweinehund zu besiegen. Als Gegenpol in einer technisierten Welt und sterilen Umgebung, bieten die Berge Ausgleich und Ruhezonen für Geist und Auge. Erfreulich ist, dass wieder mehr junge Menschen das erkennen und die Natur für sich entdecken. Dabei gilt es zu bedenken: In den Bergen ist es wie im Leben, es geht nie einfach nur von A nach B, sondern oft steil bergauf und steil bergab. Schön ist dabei, wenn man auf den Wegen die richtigen Begleiter an der Seite haben darf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 717
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
„Je höher der Wanderer steigt, umso mehr weitet sich der Blick, bis zum Gipfel der ganze Rundblick frei wird“ Zitat von Edith Stein
„Der Weg ist das Ziel“, so sagte es Konfuzius. Keine Frage, es ist immer ein beglückendes Gefühl, nach einem anstrengenden und mühsamen Aufstieg den Gipfel erreicht zu haben und endlich auf dem höchsten Punkt eines Berges zu stehen. Das ist Lohn der Mühe, des Willens und der Selbstüberwindung. Es ist ein Triumpf, verbunden mit der tiefsten Freude es geschafft zu haben, wenn die Kondition gestimmt, das Wetter mitgespielt hatte und sich nun dem Auge eine traumhafte Kulisse, eine uneingeschränkte Rundum- und Weitsicht eröffnet. Welches erhabene Gefühl ist es, hoch oben über allem zu stehen, was tief unten im Tal in den Niederungen zurück hat bleiben müssen. Dann ist es ein Sieg über das eigene Ich, „den inneren Schweinehund besiegt zu haben.“
Körperliche Aktivitäten in den Bergen, fordernde Wanderungen, das ist Erholung pur. Körper und Geist werden in jedem Augenblick und mit allen Sinnen gefordert, nicht nur während einem steilen Aufstieg oder beschwerlichen Abstiegen verbundenen Mühe, sondern überdies mit der Verarbeitung vielfältigster Eindrücke, die in jeder Sekunde auf uns einströmen und die es zu verinnerlichen gilt. Da lassen sich sehr schnell Alltag und Sorgen, einfach alles was zurück ist und – im wahrsten Sinne des Wortes – tief unten liegt, vergessen. Man steht gewissermaßen – und das nicht nur physisch, sondern auch psychisch – über den Dingen und darf die Welt aus einem völlig anderen Blickwinkel, einer anderen Perspektive betrachten.
Walter W. Braun
Bühl, im Jahre 2013
Inhaltsverzeichnis
1.
Kindheit im Schwarzwald
2.
Lehrzeit
3.
Bei der Marine
4.
Begegnung mit den Bergen
Bayern
Auf dem höchsten Berg Spaniens
In den Schweizer Bergen
Mangelnde Kondition
Härtetraining im Schwarzwald
Erster Urlaub in den Bergen
Der erste Zweitausender
Sportliche Aktivitäten
Erneut auf dem Teide (Teneriffa)
Wieder im Montafon
Dreiländerspitze, der erste Dreitausender
Und immer wieder Wanderungen
Erste Begegnung mit dem Matterhorn
Breithorn, der erste Viertausender
Anlauf zum Mönch
Schicksalhafte Begegnung mit Hans
Fit im Mittelalter
Große Gran-Paradiso-Tour
Schwebend zum Nebelhorn
Durst auf dem Hindelanger Klettersteig
Abenteuer König Ortler, 3905 m
Regentour am Watzmann
Hohe Tauern mit Großvenediger
Großglockner mit Biwak auf dem Eis
Zweiter Versuch am Watzmann
Bergamasker Alpen (Italien) mit doppeltem Handicap
Watzmann zum Dritten
Achtzehn Mutige im Mindelheimer Klettersteig
Erste Stubai-Tour
Neuer Versuch am Matterhorn
Spritztour zur Zugspitze
Erfolgreich am Mönch
Frust am Matterhorn
Neue Ziele mit Hans
Hindelanger Klettersteig zum Zweiten
Zweite große Stubai-Tour
Zuckerhütl und andere Dreitausender
Mit Familie in Zermatt
Urlaub im Zillertal
Ski-Langlauf im Schwarzwald
Säntis (Schweiz) zum Ersten
Hans hört auf
Kreuzspitze, 3155 m und Lassörling, 3098 m
DAV-Konditionstouren
Zweiter Urlaub im Zillertal
Klettersteige am Arlberg
Noch einmal zur Zimba
Mit Familie im Zillertal
Kletterspaß in den Dolomiten
Der Schwarzwald bietet auch viel
Gleitschirm-Tandemflug bei Garmisch
Dritter Besuch der Zugspitze
Mit Rainer in Saas Grund
Der Gemmisteig hoch über Leukerbad
Zweite Kletterei in den Dolomiten
Schnee im Sommer auf dem Venediger Höhenweg
Luftige Klettersteige in der Schweiz
Dolomiten zum Dritten
Erneut im Zillertal
Erlebnistour am Arlberg
Erfolg im Gemmisteig
Mit dem Glacier-Express ins Wallis (Schweiz)
Im Tannheimer Tal
Noch einmal am Säntis
Wieder in Kandersteg und im Gemmisteig
Plaisier am Gardasee
Mit Rainer erneut im Montafon
Auf König Ludwig II. Spuren
Die Strada Alta (Italien)
Auf Sions Höhen im Wallis (Schweiz)
Gemmisteig zum Dritten
Das Wiiwegli im Markgräflerland
Tage am Silvretta-Stausee
5.
Schlussgedanken
1
Kindheit im Schwarzwald
Das 2000-Seelen-Dorf Nordrach ist eine ländlich geprägte Gemeinde im Mittleren Schwarzwald und liegt idyllisch in einem Seitental der Kinzig im Ortenaukreis. Von Offenburg erreicht man den sich über 10 Kilometer ins Tal hinziehende Luftkurort über Biberach und Zell am Harmersbach oder aus dem Renchtal von Oppenau-Ibach über den Löcherberg und Schäfersfeld. Die Nordracher Bürger erwiesen sich schon immer als recht bodenständige und tief mit der Region verwurzelte Menschen. Im Mittelalter wurde der Nachbarort Zell freie Reichsstadt und Unterharmersbach freies Reichstal. Nur den Nordracher Rebellen blieb das versagt und es kam zum Bauernaufstand gegen das Kloster Gengenbach. Sie hatten allerdings mit ihrem Widerstand keinen Erfolg; den rebellischen Geist gaben sie trotzdem nie auf.
Das enge Tal steigt im Höhenprofil von rund 300 Meter in der Dorfmitte auf fast 900 Meter an. Höchster Punkt der Gemarkung ist der weithin sichtbare Mooskopf, mit einem im 19. Jahrhundert aus Sandstein errichteten Aussichtsturm. Von ihm bietet sich ein fantastischer 360-Grad-Blick ins Rheintal ins Kinzig- und Renchtal, weit über den Rhein hin zum oft im grauen Dunst zurückweichenden Vogesenkamm. Bei guter Sicht sind manchmal die schneebedeckten Gipfel der Alpen auszumachen.
Das Gebiet wird von viel Wald dominiert, der an manchen Stellen bis in den Talgrund reicht. Die dichten Wälder und undurchdringlichen Felslabyrinthe, wie sie bei der „Heidekirche“ oder am „Katzenstein“ und anderswo zu finden sind, waren schon in alter Zeit der Nährboden für die Sagen, wie die des „Moospfaff“. Mystische Hexen- und Teufelsgeschichten schürten diffuse Ängste bei denen, die diese Bereiche durchstreifen mussten. Das Leben spielte sich einst auf den Höhen ab und noch heute zeugen Relikte von alten Höhenhöfe vom kargen Leben ihrer einstigen Bewohner.
Bekannt und ausgezeichnet wurde Nordrach dank der guten und weitgehend nebelfreien Schwarzwaldluft. Das Dorf ist seit dem 19. Jahrhundert ein anerkannter Luftkurort. Endlos weite Wanderwege führen tief in die Seitentäler, sie verlaufen auf und über die Höhen und in alle Richtungen. Heute sind sie gut beschildert und für Naturbegeisterte bestens begehbar. Und immer wieder eröffnen sich auf den freien Hochflächen traumhafte Aussichtsblicke oder wir stoßen auf geschichtsträchtige Sehenswürdigkeiten an den Wegen. Über den Mooskopf verläuft der 115 Kilometer lange Kandel-Höhenweg und er wird zwischendurch vom Renchtalsteig tangiert. Der Moosturm ist auch für die Mountainbiker ein beliebtes Terrain, wegen der Steilheit in manchen Abschnitten aber eine echte Herausforderung.
Die früher selbständige „Kolonie“, die im 19. Jahrhundert ein Ortsteil von Nordrach wurde, war die Heimat meiner Großeltern väterlicherseits. Meine aus Bürchau im Kleinen Wiesental stammende Mutter kam 1945 in das Tal. Die „Kolonie“ im hinteren Tal liegt rund 6 Kilometer vom Dorfmittelpunkt entfernt.
Meine Mutter musste die Schwiegermutter in den letzten Monaten des Lebens pflegen, und ich wurde knapp ein Jahr alt nachgeholt. Nach meiner Geburt im Elsass, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges und der Flucht der Mutter mit weiteren Verwandten zurück in die ursprüngliche Heimat, wurde ich im ersten Lebensjahr von den Verwandten in Bürchau und der Holl versorgt.
Die Großeltern mütterlicherseits bewirtschafteten seit Anfang der 1940er Jahre einen Hof in Hesingue (Häsingen) im elsässischen Sundgau, nahe der Grenze zu Basel. Im November 1944 mussten sie den Ort vor der heranrückenden französischen Armee verlassen. Die Mutter mit mir, die Oma und weitere Familienmitglieder flüchteten in die rund drei Kilometer entfernte Schweiz und kamen dort erst einmal über mehrere Wochen in Internierung. Erst dann durften sie in die ursprüngliche Heimat weiterziehen, aus der sie fünf Jahre zuvor ins Elsass umgesiedelt sind. Die kleinen Dörfer Bürchau und Holl – heute im Gemeindeverbund Kleines Wiesental – liegen im südlichen Schwarzwald, am Fuß des mit 1415 Meter das Tal dominierenden, mächtigen Belchens.
In der „Kolonie“ existierte bis ins 19. Jahrhundert eine florierende Glasfabrik. Für die Glasherstellung wurden große Mengen Holz benötigt, dazu Quarzsand und Pottasche. Alles war reichlich vor Ort vorhanden. Die „Fabrik“ zog viele Arbeiter mit ihren Angehörigen an, die eine auskömmliche Beschäftigung in der Glasbläserei oder als Waldarbeiter fanden. So blühend das Handwerk sich lange Zeit entwickelt hatte, so schnell war es wieder zum Erliegen gekommen, nachdem der Wald abgeholzt und im Glasofen verfeuert worden war. Große Teile der Bevölkerung verarmten, und bald herrschte in der abgelegenen Siedlung bitterste Armut. Anfang des 19. Jahrhunderts mussten 159 Bürger das Land mehr oder weniger gezwungen verlassen. Sie bekamen ein Handgeld oder die Schiffspassage ab Le Havre, an der französischen Atlantikküste, nach Amerika bezahlt. Die Menschen wurden kurzerhand abgeschoben, wie Gottfried Zurbrügg in seinem historischen Roman: „Westwärts, Wellenreiter“ bewegend und detailgetreu schildert. Die armen Teufel, diese Hungerleider, wollte man einfach nur los sein, und nicht einmal die Hälfte hat die Strapazen überlebt. Schon während der Überfahrt auf See starben viele im Sturm oder verloren durch Krankheiten ihr Leben.
Später kauften Dr. Otto Walther und seine Frau Hoppe Adams die leerstehenden Gebäude der ehemaligen Glasfabrik und richtete ein Sanatorium für Lungenkranke ein. Er hatte herausgefunden, dass die gute Luft, sowie die weitgehende Nebelfreiheit im Tal heilungsfördernd sich bei Tuberkuloseerkrankung auswirkte. In über hundert Jahren fanden zahlreiche Menschen in dem zuletzt als LVA-Klinik geführten Haus Heilung. Seit den 1960er-Jahren litten immer weniger Menschen an dieser Krankheit und man konnte sie erfolgreich ambulant behandeln. Das Haus wurde deshalb zur weltweit anerkannten Fachklinik für Gefäßkrankheiten umgewidmet.
Vom Talschluss in Nordrach-Kolonie führen die Wegverbindungen über den Berg ins benachbarte Renchtal, andere über den Löcherberg ins Harmersbachtal. In der Verbindung zur Kornebene und dem Mooskopf gehen mehrere Wege nach Gengenbach und Offenburg sowie ins Rheintal. Eines ist jedoch überall gleich, wohin man auch wollte und zu beinahe jedem Ziel, man muss immer steil bergauf – und die Wege sind an vielen Stellen mühsam und beschwerlich.
Hier in dieser entlegenen Ansiedlung, gefühlt am Ende der Welt, lebten seit Generationen meine Großeltern väterlicherseits. Nach dem Zweiten Weltkrieg bewohnten auch meine Eltern das alte, gemietete Häuschen, nachdem die Großeltern gestorben waren. Anfang der 1950er-Jahre wollte der Hausbesitzer auf dem Platz einen Neubau mit integrierter Schuhmacherwerkstatt bauen, das alte Haus musste weichen und wurde abgerissen. Die Eltern bekamen die Kündigung und mussten umziehen. Wie es so oft im Leben ist, hat alles seine zwei Seiten. Ein Unglück ist manchmal ein Glück, und so nützten die Eltern die aufgezwungene Situation, sie wechselten aus dem Hintertal, der abgelegenen Kolonie, ins verkehrsgünstiger gelegene Dorf.
Etwas oberhalb vom Dorf, am Schrofen, gab es ein stattliches Anwesen das dem „Emil-Sepp“ gehörte. Der Mann im mittleren Alter besaß Baumschulen, verkaufte Baumsetzlinge und pflegte großflächig Weihnachtsbaum-Kulturen. Seine Familie wohnte im neueren Hauptbau und dann bestand noch ein älterer Querbau, in direkter Anbindung zum Nachbargebäude vom Maurermeister Lehmann. Der alte Zwischenbau mit 3-Zimmer-Wohnung, Keller und Bühne – wie der Dachboden landläufig genannt wurde – konnten 1950 die Eltern mieten und beziehen.
Die „alter Burg“ war rückseitig an steile, hochaufragende Felsen angebaut, der Kellerboden bestand aus gestampftem Lehm – naturbelassener Boden würde man heute dazu sagen – und vom blanken Fels sickerte ständig Wasser. Das ersparte den Kühlschrank, und im feuchten Element fühlten sich die Ratten wohl.
Allzu viel Auswahl für bessere Wohnmöglichkeiten gab es in jenen Tagen nicht. Die Gemeinde Nordrach musste nach dem Kriege, so wie viele andere Städte und Dörfer auch, die ins Land geströmten Flüchtlinge aus dem Osten, aus Schlesien und Ostpreußen aufnehmen. Für uns Kinder, für mich und meinen jüngeren Bruder, war die Qualität der Wohnung eher nebensächlich. Wir interessierten uns mehr für die Umgebung, und die bot vielfältigste Möglichkeiten zum spannenden Zeitvertreib. Der mangelnde Wohnkomfort war da kein Thema. Wir hatten nicht einmal jeder ein eigenes Bett zum Schlafen, ich musste das mit meinem jüngeren Bruder teilen.
Rückseitig der Wohnung und der Straße abgewandten Seite ragten steile Felsen senkrecht empor und in diesem Refugium konnten wir Buben nach Herzenslust klettern. Vielleicht wurden hier schon bei mir die Grundlagen für das sichere Gefühl am Felsen, die absolute Schwindelfreiheit in jeder Lage und egal welcher Höhe gelegt.
Gut möglich ist auch, dass ich aus der Enge des Tales bedingt, ein Gen für die Berge und Natur schon mit in die Wiege gelegt bekommen habe. Oder ist solches dem Schwarzwälder allgemein gegeben, neben den Eigenschaften wie Bodenständigkeit, Zähigkeit und unbedingter Überlebenswille? Schließlich spielte viele Jahrhunderte zuvor – oder waren es tausend Jahre? – das Leben in der Region auf den Höhen ab. Die Hochflächen um die Kornebene, auf dem Schäfersfeld und andere Gemarkungen im Höhengebiet waren einst besiedelt, ich erwähnte schon die Höhenhöfe, von denen heute noch Relikte zeugen und die wieder gepflegt werden. Auf den Höhen und in den Wäldern weideten Tiere, es gab Siedlungen, und manche Überreste an Orten und Plätzen erzählen heute noch davon und erinnern an das karge, entbehrungsreiche Leben der armen Bewohner.
Während meiner Kindheit war es noch nicht die Zeit, in der wir Kinder einfach nur Kinder sein durften und spielend den Tag verbracht haben. Den Eltern fehlte es immer an ausreichendem Einkommen, und um die schmale Haushaltskasse aufzubessern oder auch Geld für mich zu haben, musste ich es verdienen und dazu gab es bei den Bauern auch für Kinder immer eine Gelegenheit. Oft habe ich Pferde oder Ochsen beim Pflügen geführt, habe Kartoffeln in der Ernte aufgelesen, oder im Sommer beim Heuen geholfen, manchmal mit Zeinen (Körbe) gespaltenes Holz bei Dorfbewohnern auf deren Dachboden tragen und sauber aufgestapelt. Viele solcher einfachen Tätigkeiten gab es und dafür bekam ich ein paar Pfennig oder ein, zwei Mark.
Über Jahre konnte mich unser Nachbar, der „Emil-Sepp“, bei Arbeiten in seinen Pflanzungen oder in den Weihnachtsbaum Kulturen gebrauchen. Der knorrige Mann war ein echtes und manchmal auch großzügiges Urgestein, deshalb war ich gerne bei ihm. Mindestens einmal im Jahr musste das wild wachsende Gras, Dornen und Unkraut in den Nordmannstannen-Kulturen mit der Sense oder Sichel beseitigt werden. In den Pflanzschulen waren die jungen Baumpflänzlinge auf den Feldern umzusetzen. Nach der Aussaat wuchsen sie in der Baumschule in Büscheln heran, danach wurden sie dem alten Standort entnommen und einzeln, Stück für Stück, in etwa zehn Zentimeter tief ausgehobenen Gräben exakt wieder in Zeilen eingelegt. So konnten sie sich ein oder zwei Jahre weiter entwickeln, wachsen und größer werden, bevor sie erneut ausgegraben und im Wald oder am endgültigen Standort einen Platz fanden.
Nach dem Umzug ins Dorf war es mir möglich, noch knapp ein Jahr in den Kindergarten zu gehen und danach schloss sich die Schulzeit an. Zur Einschulung in der Volksschule Dorf ging meine Mutter alleine, sie musste die nicht sonderlich spektakuläre Zeremonie ohne mich erledigen. Ich war an diesem Tag beim Großbauer Muser vom Dorf auf dem Feld bei der Kartoffelernte. Wegen einer Stunde Einschulung opferte damals niemand einen Tag und verzichtete auf ein paar Pfennige Verdienst. Und eine Schultüte gab es in unseren Kreisen nicht, ich wusste nichts von diesem Brauch und kann mich auch nicht erinnern, dass Kinder in jener Zeit in Nordrach eine Schultüte trugen.
Meine Kinderjahre verliefen in einfachen Verhältnissen haben mich schon sehr früh geprägt. Ich war körperlich schmächtig, aber mit zunehmendem Alter zäh und sehr ausdauernd, und den Gleichaltrigen meistens in der Schnelligkeit überlegen, was mir in manchen Situationen Vorteile verschaffte.
In den ersten zwei Schuljahren wurde noch umfänglich gelernt, die Natur wurde mit einbezogen und bei schönem Wetter wurden wir irgendwo draußen unterrichtet. Dazu wanderte Fräulein Christine Milz, unsere sehr strenge Klassenlehrerin, mit der Klasse in die nähere Umgebung. Wir lernten auf der Wiese oder im Wald, quasi im Schulzimmer der Natur. Mehrmals sind wir zum „Katzenstein“ auf die Höhe, zur markanten Felsengruppe weit oberhalb des Dorfes, auf dem Höhenrücken zwischen Nordrach und dem benachbarten Schwaibacher Tal, nahe bei Gengenbach. Dort stand auf dem wuchtigen Felsen schon damals eine große Aussichtsbank, die uns Kindern als Schulbank diente. Wer dort keinen Platz mehr fand, setzte sich nebenan auf den blanken und von der Sonne erwärmten Felsen. Hin und wieder gingen wir zum Maileseck, von wo aus sich uns wir wie auf einem Balkon ein freier Blick auf das Dorf und weit ins Tal auftat. Wir saßen im Gras auf der Wiese am schrägen Hang und lauschten, was uns die Lehrerin zur Nordracher Geschichte zu erzählen wusste.
Nicht weit entfernt davon befindet sich im Wald ein jüdischer Friedhof, über dessen Hintergrund sie uns lang und breit aufklärte. Wir bedauerten die jungen Frauen, die an Tuberkulose erkrankt waren und im „Sanatorium Rothschild“ erfolglos hatten Heilung gesucht, die aber leider verstorben sind. Zu Tränen rührend fanden wir die Geschichte vom Hermersbur und dem Drama um die unglückliche Magdalena, Tochter des Vogts vom Mühlstein, die Heinrich Hansjakob bewegend in seinem Roman „Vogt auf Mühlstein“ schilderte. Der Vater zwang seine Tochter den reichen Hermersbur zu heiraten, sie liebte aber den armen Schlucker Öhler-Toni, der Müller von der Rautschmühle, und am Ende starb sie an gebrochenem Herzen. Bei dieser Erzählung gingen unsere Blicke hinüber zur anderen Talseite zum Mühlstein, dem Übergang von Nordrach in das Schottenhöfer Tal und ins Harmersbachtal.
Wir wohnten rund vier Jahre in der alten Wohnung „am Schrofen“, dann war der marode Bauzustand so schlecht, dass es unzumutbar wurde. Der Vater ist einmal auf dem Dachboden eingebrochen und durch die Decke hinunter in die Küche gestürzt. Zum Glück ist ihm oder anderen nichts passiert, es ging ohne größere Blessuren ab. Das Dämmmaterial der Lehmriegel aus Stroh hatte vermutlich den Sturz etwas gedämpft.
Auf der „Bind“ bekamen wir eine bessere Wohnung mit 3 Zimmern und Küche und dort zogen wir 1954 ein. Fortan hatten wir drei Kinder zwar immer noch nur ein Zimmer für uns, aber zumindest jeder sein eigenes Bett und ich auch noch einen etwas Platz für ein Bücherregal. Das war nicht unwichtig, denn Lesen war eine meiner großen Leidenschaften, und der Bücherbestand war inzwischen umfangreich angewachsen. Dazu gehörten einige, die ich von der Lehrerin signiert mit den Zeugnissen für gute Leistungen überreicht bekommen hatte.
Unmittelbar bei der „Auf der Bind“, eine Siedlung aus ein paar Häusern, begann ein steiler mit Hecken und halbhohen Eichen bewachsener Hang. Hier führte der Weg zum Kohlberg, Pfaffenbacher Eck und zur Kornebene. Für mich und weitere Buben und Mädchen aus der Schule oder der Nachbarschaft war das steile, dichte Waldgelände ein ideales Revier. Wir lebten noch in einer Zeit ohne Computer und Nintendo, es gab kein Handy oder MP3-Player und in den wenigsten Wohnungen stand schon ein Fernseher. Die karge Freizeit verbrachten wir draußen und das unabhängig vom Wetter. Wir Kinder waren immerzu aktiv und in Bewegung, hatten viele Ideen und kannten keine Langeweile, und nur wenn es gar nicht anders ging oder schon dunkelte, gingen wir heim. Zuhause beschäftigte ich mich mit Lesen oder ich bastelte Schiffsmodelle aus bedruckten Kartonvorlagen, die ich mir vom Taschengeld kaufte oder geschenkt bekam. Die vorgezeichneten Teile musste ich akkurat ausschneiden, falzen und danach exakt kleben. Unter anderem bastelte ich ein etwa einen Meter messendes amerikanische Kriegsschiff mit vielen diffizilen Aufbauten. Damit war ich wochenlang beschäftigt, bis es endlich fertiggestellt war. Zwischendurch gab es bei mir Phasen, in denen ich gerne mit Bleistift und Pinsel umging und Aquarelle und Portraits malte.
Die Weitläufigkeit des Tales, die topografischen Gegebenheiten, sie waren bestens geeignet, Ansätze, Grundlagen und Begeisterung für die Berge und Höhen zu entwickeln. Schon in jener Zeit bestand in Nordrach eine rührige DAV-Untersektion der Sektion Offenburg, die 1960 gegründet worden war. Damals gab es schon sehr aktive und engagierte Bergsteiger. Sie hatten das Matterhorn schon bestiegen und die Eiger-Nordwand, andere waren sogar im Himalaya unterwegs. Das waren natürlich an den Stammtischen im Dorf beliebte und sehr ergiebige Themen.
Die gute Kondition und Ausdauer hatten wir uns in der Kinderzeit so nebenbei antrainiert. Das Terrain brachte in vielen Bereichen den Kreislauf immer wieder gehörig in Schwung, und nicht nur wegen der guten Schwarzwaldluft rangen unsere Lungen keuchend nach mehr Sauerstoff, wenn wir auf steilen Wegen unterwegs waren oder querfeldein durch die Wälder rannten. Unter solch natürlichen Gegebenheiten und in diesem Umfeld benötigten wir kein Fitness-Studio, die Natur alleine genügte vollkommen.
In der Regel musste ich überallhin zu Fuß unterwegs sein. Ich rannte oder ging mit anderen dutzende Kilometer bergauf und bergab oder einfach querfeldein über Wiesen, durch den Busch und dichten Wald und manchmal mitten durch urwaldähnliche Flächen. Später bekam ich ein altes Fahrrad, das natürlich nicht mit modernen Mountainbikes heutiger Art vergleichbar war und sogar noch ohne Gangschaltung war, trotzdem waren die steilen Waldwege und Straßen nie ein Hindernis. Notfalls oder bergauf, musste ich das Fahrrad schieben, und nur bergab konnte ich fahren, da lief es fast von alleine.
Seit dem achten Lebensjahr musste ich mir das Geld, das ich für Kleidung oder Schulsachen und andere Dinge benötigte, auch selber verdienen. Anfangs verkaufte ich den Bäuerinnen auf abseits gelegenen Höfen und den Hausfrauen im Tal feinduftende edle Seifen. Die ländliche Bevölkerung war froh, wenn sie die benötigten Waren direkt ins Haus geliefert bekamen. Das ersparte ihnen den weiten Weg in den Kolonialwarenladen, wie die kleinen gutsortieren Geschäfte damals hießen und die alles führten, was ein Haushalt allgemein brauchte.
In den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts trafen sich die Männer noch regelmäßig an den Stammtischen in einem der örtlichen Gasthäuser. Und dort stiegen auch Reisende, mobile Händler, ab, die im Dorf ihre Waren feilboten. Sie übernachteten und suchten auch gleich noch Untervertreter, die im Dorf bekannt waren und ihre Waren im Tal verkaufen mochten. Auf diese Weise vermittelte mein Vater für mich weitere diverse Kleinverdienste. Einmal bekam ich einen Posten neumodische, weiße Kunststoff-Tischdecken mit Damaststruktur, die ich den Frauen anbieten und verkaufen sollte. Solche abwaschbaren und pflegeleichten Tischdecken kamen in den Haushalten und speziell bei den Bauern sehr gut an. Wenn einmal der Mostkrug umfiel oder jemand die Suppe verkleckerte, war das fortan kein Malheur mehr. Ich bin alle losgeworden und bekam dafür eine Armbanduhr mit Federarmband. Das war eine tolle Sache, denn nicht jeder meiner Schulkameraden besaß und trug eine Armbanduhr, oder genau betrachtet die allerwenigsten. Da war ich stolz wie „Bolle“.
Unser Vater arbeitete zeitweise als Gemeindearbeiter und damit stand ihm auch verbilligter „Schlagraum“ zu. Er durfte im Gemeindewald angefallenes Restholz bergen und zu Brennholz verarbeiten. Das waren überwiegend dicke Äste und starke Zweige, die beim Holzfällen und entasten anfielen. Sie wurden in Meterstücke zerkleinert und gebündelt. Je steiler und abseits das zugeteilte Los lag, desto billiger war es, und da es zuhause immer am Geld mangelte, war das Billigste für den Vater gerade recht.
Die Plätze lagen durchweg weit entfernt und oft hoch oben in den Wäldern und dort wurde das Brennholz direkt vor Ort aufbereitet. Nicht selten hatten wir zuvor ein oder zwei Stunden Wegstrecke zurückzulegen, bis wir ankamen und mussten auch noch einen Leiterwagen hinter uns herziehen. Schon das war beschwerlich. Vor Ort ging es aber dann erst richtig zur Sache. Wir Buben, teils unterstützt von der Mutter, musste die Äste und das dürre Stammholz erst vom steilen Hang an den nächsten Weg runter ziehen. Unten im flacheren Bereich oder auf dem Waldweg bearbeitete es der Vater und sägte das Holz auf Meterlänge zu. Die dünneren Äste wurden danach zu Wellen gebündelt, während wir einige docke Holzstangen als untere Schicht direkt auf den Wagen packten. Wellen waren runde Bündel Astholz, auf einen Meter zugerichtet und im Wellenbock auf etwa dreißig Zentimeter Durchmesser gepresst und mit Draht oder einer Wiede – einer gewundenen Haselnuss- oder Weiderute – zusammengebunden.
Im Leiterwagen lag die Unterschicht aus den langen, dünnen Holzstangen, darauf kamen weitere Einzelhölzer und obendrauf Bündel für Bündel die Wellen. Der Wagen wurde so hoch wie möglich beladen, damit die Tagesausbeute in einer Fuhre abtransportiert und heimgefahren werden konnte. Den schwer beladenen Wagen galt es auf den häufig sehr uneben, mit vom Regen tief ausgewaschenen Furchen durchzogenen Waldwegen sicher talwärts zu bringen. Die Kunst bestand darin, den schwer beladenen Wagen unter solchen widrigen Verhältnissen unter Kontrolle zu behalten. Die untere Schicht der längeren Holzstangen ragte zwei oder drei Meter nach hinten über und durch Gewichtsverlagerung konnte man abbremsen. Das Holz schleifte auf dem Boden, und wenn es zu steil wurde, setzten wir Kinder und die Mutter uns noch drauf. Dank der Hebelwirkung bremste das so weit ab, dass der Wagen nicht zu schnell wurde und noch lenkbar blieb. Trotzdem ist er uns einmal durchgegangen, kippte seitlich weg und stürzte den Hang hinunter in den Wald. Zum Glück kam der Vater noch frei und wurde nicht überrollt oder unter der schweren Last begraben. Ein ärgerliches Malheur war es trotzdem, denn wir mussten die gesamte Ladung wieder mühsam aus dem unwegsamen Gelände bergen und den Handwagen neu beladen. Vor Wut schimpfte der Vater wie ein Bürstenbinder, und war er wütend, konnte er dazu lästerlich fluchen.
Über die Wintermonate war es unsere tägliche Aufgabe, wir mussten nach der Schule erst ein oder zwei Stunden Holz sägen und spalten und in die Wohnung bringen, damit genügend Vorrat für den Herd und Kachelofen bereit lag. Wer hatte einmal den Sinnspruch geprägt? „Holz heizt dreimal, das erste Mal im Wald, das zweite Mal beim Sägen und Spalten und das dritte Mal im Ofen oder Herd.“
Nachdem ich Tischdecken verkauft hatte, brachte ich vorhandenen Abonnenten wöchentlich die bestellten Zeitschriften des Speyerer Klambt-Verlages vorbei. Sogar die Bauern liebten solche Klatschblätter wie „Heim und Welt“. Einige neuen Abonnenten konnte ich noch dazugewinnen, das brachte mir dann ein paar Mark extra ein und manchmal bekam ich beim Kassieren noch ein paar Pfennige Trinkgeld. Ein Teil davon verwendete ich zu gerne für Süßigkeiten, und hauptsächlich für die von mir geliebten Karamellen, die es für zwei Pfennige pro Stück im Kaufladen gab. Diese Bonbons waren edler und einzeln in Papier verpackt, sie lagen nicht einfach lose im Glasbehälter wie die ordinären Gutsele mit Himbeergeschmack oder was der Kaufladen sonst noch im Dorf feilbot.
Äußerst lästig empfand ich auf den Höfen die überall herumlaufenden Hunde, die bei den teils weit abseits gelegenen Häuser und Bauernhöfen anzutreffen waren. Sie waren allgemein an der Kette angebunden, hatten aber manchmal einen zu großen Radius. Manche liefen auch frei herum. Mehrmals wurde ich von so einer Bestie ins Bein oder in den Po gebissen, dann kam die besorgte Bäuerin und desinfizierte die Wunde mit Schnaps. Das war dann noch schlimmer als der Hundebiss, das bereitete Höllenqualen. Wenn‘s dann gut ging, gaben sie mir zehn Pfennig als Schmerzensgeld, was kaum ein Trost war. Vorwiegend beließ man es aber bei bedauernswerten Worte. Vielleicht dachten sie, der Bub verdient doch auch so schon genug an der Zustellung.
Bei allen Tätigkeiten und Aktivitäten legte ich Woche für Woche immense Strecken mit vielen Höhenmeter zurück. Die Bauernhöfe lagen weit abseits und verstreut auf den Höhen der Flacken, im Stollengrund, auf dem Mühlstein oder ich musste auf der anderen Talseite zum Kohlberg, in den Merkenbach und zu anderen Gewanne. Nordrach liegt auf etwa 300 Höhenmeter und der Mühlstein und die Flacken rund 550 Meter hoch. Um mit dem Fahrrad fahren zu können war es zu steil, da blieb nur es bergauf zu schieben und erst talwärts zu fahren.
Wenn ich die Zeitschriften zustellte, bekam ich ab und zu ein „Trinkgeld“. Das war mir immer am Liebsten. Stattdessen bekam ich aber öfters ein Stück Brot mit Marmelade oder Honig drauf, gelegentlich auch schon mal einen Ring Wurst oder ein Stück Speck für zu Hause, worüber sich mehr meine Eltern freuten. Während der Obsterntezeit meinte es eine Bäuerin einmal besonders gut und drückte mir eine große Tüte frisch geernteter Zwetschgen in die Hand. Nach meiner Erinnerung waren das gut und gerne zwei oder drei Kilo und die hätte ich bei noch vier Kilometer Fußweg nach Hause tragen sollen. Unterwegs wurde mir die Tüte zu lästig und ich warf das Zeug in den Wald; feine Zwetschgen hin oder her.
Sonderlich clever war das nicht, eher etwas unüberlegt, denn die Bauernfamilie lief gelegentlich den gleichen Weg, so auch fast immer sonntags, wenn sie zur Kirche ins Dorf gingen. Dabei entdeckte die Bäuerin die Tüte mit Zwetschgen im Wald liegen und konnte sich leicht einen Reim darauf machen, wie und durch wen sie dorthin gekommen sind. Nachdem ich wieder auf den Hof kam, wurde ich von der Bäuerin gehörig gescholten. „Wir werden dir nie mehr etwas geben“, schimpfte sie. Doch um Ausreden war ich nie verlegen, ich sagte: „Die Tüte ist mir aufgerissen und die Zwetschgen sind zu Boden gefallen. Eine andere Tüte oder eine Tasche hatte ich nicht und so konnte ich das Obst nicht mehr einsammeln.“ Ob sie es mir geglaubt hatte, weiß ich nicht.
Die Mutter verdient mit Kleinhandel ebenfalls etwas dazu. Sie lieferte Käse, Mettwurst und Fisch in Dosen an Bestellkunden aus. Zuerst holte sie bei der Stammkundschaft die Bestellungen ein. Wenn später die kommissionierte Ware vom Händler uns zugeliefert war, mussten wir Buben sie an die Kunden ausliefern und kassieren. Später kam noch eine Vertretung für den „Nudelpeter“ hinzu. Der mittelständische Nudel-Hersteller produzierte unter diesem Namen irgendwo im Schwäbischen und die Nudeln waren bei der Kundschaft für beste Qualität bekannt und beliebt. Für die Abnehmer auf den entlegenen Höfen war es bequemer, wenn ihnen die Ware direkt ins Haus geliefert wurde, und feine Nudeln stellten stets eine willkommene Abwechslung im Speiseplan dar. Wochentags kamen sonst nur Kartoffeln aus dem eigenen Anbau auf den Tisch. Dafür gab es sonntags häufig Sauerbraten oder Rinderbraten und da passten breite Nudeln mit viel Soße gut dazu. Wie schon beim Käse und anderer Ware, kümmerte sich die Mutter um die Bestellungen. Der Hersteller lieferte uns jede Bestellung einzeln in Tüten verpackt zu und wir Buben brachten sie den Kunden.
Damit wir die Ware sicher und sauber ausliefern konnten und das bei jedem Wetter, stellte uns der „Nudelpeter“ einen Fahrradanhänger mit verschließbarem Verdeck bereit. Doch das Gespann war schwer und wir mussten es talaufwärts mühsam schieben. Erst auf dem Rückweg und talwärts hatten wir es einfacher und konnten fahren. Beim Wohnhaus gab es ebenerdig einen offenen Vorraum mit Bretterverschlag. Dort lagerten die Wellen aus dem Wald und zusätzlich zwei bis drei Ster zugekauftes Scheiterholz, das wir nach und nach sägen und spalten mussten. Im anderen Teil war ein geschlossener Keller und dort lagerte das Jahr über ein reichlicher Vorrat an Kartoffeln, Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten. Unsere Mutter verstand es trefflich, auf zwei gepachteten Feldern alles was wir an Gemüse übers Jahr brauchten zu ziehen und zu ernten. Natürlich ging das nicht ohne unsere Hilfe. Wir Kinder wurden dazu nicht erst gefragt, dass wir mithelfen mussten, das war selbstverständlich.
Im Herbst und bis ins Frühjahr beförderten wir mit dem Handwagen mehrere Zentner Mist auf die Äcker und wir trugen dutzende gefüllte Eimer mit elend stinkender Jauche aufs Feld. Vom Frühjahr bis in den Herbst gab es zwischendurch Unkraut zu jäten und im Herbst nach der Ernte wurden die Felder umgegraben. Zum Pflügen hatten wir weder Pflug noch Ochsen oder Pferde, wir gruben Zeile für Zeile mit dem Spaten um. Kurzum, es gab für uns Kinder übers Jahr und das vom Frühjahr bis in den Winter reichlich Arbeit. Im Herbst lagerten dann mindestens zehn Zentner Kartoffeln im Keller und auf den Pritschen standen viele Reihen gefüllte Gläser mit eingewecktem Obst, Gurken und Gemüse. Auf einem Strohbett lagerten Äpfel und Birnen. Zusätzlich wurden zwei Zentner Kraut zugekauft, gehobelt und im Fass eingestampft. Das ergab einen hundert-Liter-Steintopf voll Sauerkraut. Und zu guter Letzt standen zwei Fässer mit Äpfel- und Birnenmost trinkbereit im Keller.
Nach guter alter Väter Sitte wurden in jenen Jahren viel mehr Vorräte angelegt und gelagert, wie dies heute der Fall ist, und so war auch bei uns. Die fleißigen Hausfrauen haben alles Mögliche in Gläser eingeweckt. So wurden Weck-Einmachgläser zum Synonym. In vielen Haushalten wurde im Herbst mindestens ein Schwein geschlachtet, das Fleisch eingepökelt, Speck und Würste in der Vorratskammer luftgetrocknet oder die Wurst wurde in Dosen haltbar gehalten. Ausreichend Vorräte zu haben, das waren ein Muss, sie gehörten in jedem Haushalt noch unverzichtbar dazu. Tiefkühltruhen gab es kaum, das war noch nicht so gängig, zumindest nicht bei uns im Dorf und wir selber besaßen nicht einmal einen Kühlschrank. Erst um 1960 bildeten sich in den Dörfern Genossenschaften, und das auch in Nordrach, die ihren Mitgliedern an einem zentral gelegenen Ort in einer Anlage Kühlfächer zum Mieten boten. Meine Eltern mieteten auch ein Fach, in dem sie danach ein Teil der Vorräte länger haltbar einlagern und aufbewahren konnten.
Die Wälder und freien Flächen rund um Nordrach boten reichliche Erntemöglichkeiten. Während der Saison sammelten oder raffelten wir wochenlang Heidelbeeren. Mit einem Heidelbeerkamm, der „Raffel“ streiften wir die Beeren vom Strauch und so war das viel effektiver, als jede Beere einzeln zu pflücken. Überhaupt arbeitete unsere Mutter gerne mit System. Die Heidelbeeren reiften in den tieferen Lagen oberhalb des Tales früher und dort wurde begonnen. Je nach Reife der Beeren arbeiteten wir uns nach und nach höher und zwei oder drei Wochen später waren die Flächen rund um den Mooskopf dran. In diesem Bereich auf knapp unter 900 Meter reiften die Beeren etwas später, es gab aber mehr, die Ausbeute war besser. Der Nachteil war, wir hatten mindestens zwei Stunden Fußmarsch vor uns und zurück natürlich den gleich weiten Weg, auch wenn es abwärts leichter zu laufen war.
In den Sommermonaten kam es vor, dass uns die Mutter in den Ferien schon um 2 oder 3 Uhr aus den Betten holte, damit wir kurz nach Tagesanbruch vor Ort ankamen und – das war wichtig – die besten Plätze auswählen konnten. Man kann sich denken, wir sind anfangs noch halb im Schlaf und mit hängenden Köpfen hinter oder neben ihr hergetrottet. Unermüdlich zog sie mit uns auf die waldfreien Höhen, und egal bei welchem Wetter. Noch heute erinnere ich mich mit Schaudern an heftigste Gewitter, die uns manchmal auf der Kornebene und rund um den Moosturm überraschten. Von allen Seiten drängten die dunklen, bedrohlichen Gewitterwolken aus dem Südwesten heran, blieben am Berg hängen und es donnerte so urgewaltig, so kurz hintereinander, dass wir fürchteten, die Welt geht augenblicklich unter.
Diese entfesselnden Naturgewalten waren für uns Kinder sehr beängstigend und sie verfolgten mich manchmal noch nachts in den Träumen. Und etwas anderes machte mir auch große Angst. In der Bevölkerung wurden damals gerne die wildesten Schauermärchen erzählt. Wir hörten von Menschen, die auf dem Feld vom Blitz erschlagen wurden oder von Kugelblitzen getroffen, die mit grellem Licht durch die Räume schwirrten. Überhaupt hat man in jenen Tagen noch sehr viel fantasiert und die beängstigenden Geschichten wurden von Generation zu Generation weitererzählt. Wir hörten vom „Moospfaff“, wurden von Hexen, Dämonen und bösen Geistern gewarnt, die Menschen unverhofft erscheinen können und sie in die Irre führen wollen. Das blieb nicht ohne Wirkung auf unser kindliches Gemüt.
Zwischendurch kamen wir in einen Tag, an dem es ununterbrochen regnete. Noch bevor wir Heidelbeeren raffeln konnten, waren wir schon klitschnass, und entsprechend mies war unsere Lust und Laune. Von heller Begeisterung konnte bei uns Buben wirklich keine Rede sein. Unsere Mutter aber blieb bei aller Unbill unverdrossen, sie spornte uns immer wieder an und ermunterte uns, auch wenn wir maulten und murrten. Und selbst dann, wenn es in Strömen regnete, sah sie schon irgendwo die Sonne hervorbrechen. Der Gedanke aufzuhören und heimzugehen, wäre ihr nie in den Sinn gekommen. „Lueg do, z’Sun schient scho“, war einer ihrer Lieblingssprüche, dabei waren wir nass wie die Katzen im Bach. Mit klatschnassen Klamotten am Leib wurde uns kalt, außerdem war es unsäglich unangenehm durch die nassen Heidelbeersträucher zu streifen, durch meterhohes Farn oder halbhohe Hecken und triefendes Gebüsch. Solche moderne Synthetik- und Outdoor-Bekleidung, die in kürzester Zeit wieder trocken wird, gab es noch nicht. Doch glücklicherweise, das darf man sagen, hatten wir mehr schöne und trockene Tage, an denen es uns leichter fiel und wir locker unser Tagespensum schafften.
Noch eine andere Sache bereitete uns Ängste, die Kreuzottern, eine einheimische giftige Schlangenart und zu jener Zeit weit verbreitet. Auf den Höhen der Heimatregion stieß man häufig und überall auf sie. Etwas, das sich versteckt, unsichtbar und lautlos bewegt, schleicht oder kriecht, das war uns äußerst suspekt. Manchmal sahen wir eine oder mehrere dieser Schlangen zusammengerollt und unbeweglich auf einem sonnenbeschienenen Steinhaufen ruhen oder sie schlängelnden blitzschnell vor uns ins Gebüsch. Wenn sich so eine Kreuzotter gestört fühlte und flüchtete, stellte sie sich durchaus manchmal mit dem Kopf im rechten Winkel gut 20 Zentimeter auf und bewegte sich sehr schnell in Zickzacklinien vorwärts. Das weckte in uns Kinder die wildesten Fantasien; ja wir befürchteten ernsthaft, so ein Biest würde uns verfolgen, einholen und beißen. In solche einem Falle wären wir so weit oben auf den Höhen und fernab von jeglicher Hilfe verloren gewesen. Wie hätten wir wissen sollen, dass sich die Kreuzottern mehr vor uns Menschen fürchten, als umgekehrt. Sie sind sehr scheu und suchen meistens das Weite, lange bevor wir sie zu Gesicht zu bekommen.
Wenn wir später nach Stunden raffeln die vollen Heidelbeerkörbe nachmittags beim Händler abgeliefert und das Geld in der Tasche hatten, waren sämtliche Ängste und Anstrengungen des Tages schnell wieder vergessen. Die Mutter brauchte den Zusatzverdienst dringend für die Haushaltskasse und wir Kinder waren auch stolz, wenn wir für uns etwas Geld verdient hatten.
In den 1950er-Jahren gab es rund um die Kornebene und um den Mooskopf weite Heidelbeerflächen. Die Gebiete waren über Jahrzehnte fast völlig frei vom hohen Baumbewuchs. Der Grund lag darin, dass nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg die Franzosen im Rahmen der auferlegten Reparationsverpflichtungen den Wald in riesigen Bereichen komplett abholzten und die Stämme ins Elsass und übrige Frankreich abtransportierten. Hinterher gab es auf den Höhen und in weiten Gebieten nur noch wenige alten hochgewachsenen Bäume und mächtige Schwarzwälder Tannen.
Innerhalb weniger Jahre hatten Heidelbeersträucher diese freien Flächen erobert und flächig besiedelt. Sie fanden auf den sonnenbeschienenen Höhen ideale Bedingungen und gediehen bestens. Soweit das Auge blickte, wechselten sich Heidelbeeren mit Himbeersträuchern und Brombeerhecken ab. Erst etwa 30 Jahre später war der natürlich gewachsene oder nachgepflanzte Wald wieder hoch und dicht, die Heidelbeeren wurden verdrängt. Dann kam der zweite Weihnachtstag 1999 und mit ihm der Orkan „Lothar“ mit seiner verheerenden Wirkung. In dessen Folge sind innerhalb Minuten die dichtesten Wälder großflächig auf den Höhen wie Streichhölzer umgefallen. Der ewige Kreislauf der Natur begann erneut, wieder gab es für zwei Jahrzehnte viel mehr Licht und Platz für niedrige Gewächse und Sträucher aller Art auf den betroffenen Flächen, erneut entstand eine üppige Biodiversität.
Bis Mitte der 1960er-Jahre strömten zum Beerensammeln die Menschen in Scharen aus dem Offenburger Raum, dem Hanauerland und Rheintal fußläufig auf die Höhen. Heute würde vermutlich kaum noch irgendjemand freiwillig drei oder mehr Stunden Fußmarsch in Kauf nehmen, nur um ein paar Pfund Beeren zu ernten. Sie fahren allenfalls mit dem Auto an eine günstig erreichbare Stelle und pflücken dort. Diese heutige Entwicklung ist dabei durchaus erwünscht und wird eher positiv gesehen. In besonders geschützten Gebieten dürfen die Beeren überhaupt nicht mehr gepflückt werden oder nur noch kleinen Mengen zum sofortigem Verzehr. Man will das vom Aussterben bedrohte Auerhuhn schützen und erhalten und dessen Hauptspeise sind Blätter und Beeren der Heidelbeersträucher.
In der Saison ernteten wir zu dritt täglich im Durchschnitt 60 bis 70 Pfund Heidelbeeren. Dafür trugen meine Mutter und ich jeweils einen Rückentragekorb und zusätzlich befüllten wir noch einen 10-Pfund-Henkelkorb, wenn es die Flächen hergaben. Den trug ich mit gemeinsam mit meinem Bruder. Erst wenn die Gefäße einigermaßen gut gefüllt waren, durften wir an den Heimweg denken, und das war meistens erst nach 16 Uhr. Wenn man dann bedenkt, wie früh wir zu Hause schon losgegangen sind, dann waren das sehr lange Tage. Und hatten wir alles beim Händler glücklich abgeliefert, waren wir längst noch nicht zu Hause. Für den Heimweg benötigten wir, auch mit flotten Schritten, nochmals mindestens eine Stunde.
Wer wollte heute seinen Kindern solche Strapazen noch zumuten? Glückerweise war die Zeit überschaubar und auf wenige Wochen beschränkt, denn irgendwann war es mit den Heidelbeeren oder anderen Beeren vorbei, dann zählte nur noch, was wir verdient haben und was ich davon zurücklegen konnte.
Während der Saison kam der Händler aus dem Dorf täglich zur Kornebene hochgefahren und kaufte vor Ort die Heidelbeeren auf, auch das was wir ablieferten, was uns natürlich sehr entgegenkam. Wir mussten nicht die vollen, schweren Körbe den weiten Weg nach Hause tragen. Ich denke, das wäre bei dem Volumen und dem Gewicht auch nicht möglich gewesen. Schon alleine vom Moosturm zur Kornebene waren es ungefähr drei Kilometer. Auch da trugen wir an den vollen Körbe auf dem Rücken und den zusätzlichen Henkelkorb schon schwer, sehr schwer sogar, und immer waren wir heilfroh, wenn wir beim Händler ankamen. Was hätte auch auf dem weiten Weg dorthin ungewollt passieren können? Es hätte nur einer von uns oder die Mutter stolpern müssen. Mit so etwas musste auf den steinigen, unebenen Wegen immer rechnen. So ein Missgeschick wollten wir uns nicht einmal ausdenken.
Der Händler hatte eine transportable Dezimalwaage dabei und wog die angelieferten Heidelbeeren gleich ab, dann bekamen wir den aktuellen Tagespreis ausbezahlt. Der lag anfangs höher und je mehr angeboten wurde, desto weniger war ein Pfund wert. Das Gesetzt der Marktwirtschaft galt auch damals und sogar auf den Höhen. In der mehrere Wochen andauernde Saison kam ich im Schnitt auf rund 300 Mark, was Mitte bis Ende der 1950er-Jahre ein stolzes Sümmchen war, das war mit dem Monatsverdienst eines einfachen Arbeiters vergleichbar. Neben den Heidelbeeren sammelten wir noch in geringerem Umfang Himbeeren und Brombeeren, die aber von der Mutter überwiegend zur Herstellung von Marmeladen benötigt wurden und nur einen geringen Teil verkauften wir dem Händler oder ging an private Abnehmer.
Natürlich kannten wir uns in Nordrachs Wäldern bestens aus und wussten ergiebige Plätze, an denen Pfifferlinge und Steinpilze wuchsen. Auch diese wurden teils verkauft, überwiegend aber im Eigenbedarf verbraucht.
Unmittelbar beim Haus begann der Wald, somit quasi direkt vor der Haustüre. Neben dem schon erwähnten Weg hoch zum Kohlberg, kam man in den Merkenbach, Hasenberg und zu anderen entlegenen Ecken oberhalb des Tales. Diverse Wegverbindungen führten vom Dorf zum Maileseck, zum Pfaffenbacher Eck oder Katzenstein, andere ins Ernsbachtal. Die bequemeren Wanderwege wurden gerne von den Patienten der Sanatorien begangen, die beim Spaziergang Abwechslung zu den nicht sonderlich beliebten Liegekuren fanden, zumindest, wenn sie noch einigermaßen gut zu Fuß waren oder sie suchten eine Gelegenheit für ein Tête-à-Tête mit dem anderen Geschlecht, was in den Kliniken streng verboten war.
Auf der anderen Talseite gegenüber waren die Wege nicht weniger steil. Dort oberhalb war die Gemarkung Stollengrund und noch höher kam man zu den mächtigen, mystischen Felsengebilden der Heidenkirche, die einst Kultstätten gewesen sein soll.
Auf mehreren Wegen kommt man durch den Regelsbach oder Schanzbach zu den bewohnten Höhengebieten, den Flacken, oder durch den Hutmacherdobel zum Mühlstein der etwa auf der Höhe von 500 Meter ist. Der Mühlstein ist der Pass oder Übergang zu den Schottenhöfen, dem Paralleltal, in dem damals noch Bergbau betrieben wurde. Bis in die 1960er-Jahre hat man Schwerspat abgebaut, ein Grundstoff für die chemische Industrie. Von den Schottenhöfen geht es das Tal hinaus ins Harmersbachtal. Kurz gesagt, unser Revier war unendlich groß und bot viel Freiraum. Es fanden sich auch immer Schulkameraden beiderlei Geschlechts, die mit mir umherstreiften und zu irgendwelchem Blödsinn oder Unfug bereit waren.
Im hinteren Ernsbachtal wohnte eine ältere Bäuerin alleine in ihrem alten, bescheidenen Häuschen, das direkt unterhalb der Waldgrenze am steilen nach Südwesten ausgerichteten Hang stand. Der Übermut muss uns an einem Sonntagnachmittag getrieben haben, die Frau zu foppen. Ein ständig kläffender Hofhund, ein weißer Spitz, war ihr Begleiter und diesen Kläffer wollten wir ärgern. Womit wir aber nicht gerechnet hatten, die Frau nahm das nicht hin und verfolgte uns mit ihrem Hund kilometerweit über Stock und Stein. Wir waren perplex, wie ausdauernd und hartnäckig diese für uns alte Person sein konnte. Erst nach einer längeren Strecke war es uns gelungen, sie endlich abzuhängen, und noch lange hörten wir das aufgeregte Bellen ihres Kläffers.
Während unserer ausgedehnten Streifzüge im Gelände fiel uns an einem anderen Sonntagnachmittag ein mächtiger Steinbrocken am Wegrand auf. Weit unterhalb des Waldes stand inmitten der Wiesen ein stattlicher Bauernhof, dem aber ursprünglich nicht unser Interesse galt, sondern es war der Stein. Der Teufel muss uns wieder einmal geritten haben, wir wollten den Stein ins Rollen bringen und mühten uns ihn zu bewegen, Dann aber nahm der Brocken immense Fahrt auf, genau in Richtung des Hofes, sprang haushoch und schlug auf dem Vorplatz nahe dem Hauseingang wie eine Bombe ein. Exakt dort stand ein hölzerner Leiterwagen und den zerlegte es beim Aufprall regelrecht in seine Einzelteile. Durch den gehörigen Krach aufgeschreckt, kamen die Bewohner wie die Ameisen aus dem Haus, und wir mussten erkennen, es sind junge Männer dabei, und sie waren sicher ein halbes Dutzend, die wohl zu Besuch weilten. Sie hatten uns, die Übeltäter, trotz der Distanz schnell ausgemacht und nahmen die Verfolgung auf. Zu unserem Glück lagen zwischen ihnen und uns gut hundert Höhenmeter im steilen Hang und das verschaffte uns einen passablen Vorsprung. Doch sie sehr weit hinter uns her, bis sie uns endlich aus den Augen verloren hatten. Zum Glück wurden wir offensichtlich nicht erkannt, zumindest folgten unserem Bubenstreich keine Sanktionen.
Einer meiner Schulkameraden war Wilhelm, der Enkel vom „Emil-Sepp“, unserem früheren Nachbarn und Vermieter. Trotz gleichem Alter war er größer als ich, körperlich kräftiger, und er war ein verwöhntes Einzelkind, der alles hatte, alles bekam, was er sich nur wünschte. Zur Erstkommunion mit zehn Jahren bekam er unter anderem einen Fotoapparat geschenkt. Wie war ich damals neidisch auf ihn. So etwas konnte ich mir nie leisten, und geschenkt bekam ich auch keinen, doch fotografieren, das war schon damals meine Leidenschaft, mein Traum. Stattdessen musste ich mich mit einer billigen kleinen Box begnügen, die ich mir auf dem Jahrmarkt für 3,50 Mark kaufen konnte. Trotzdem habe ich damit Schwarz-Weiß-Bilder gemacht, und es sind die ganz wenigen, die ich heute noch aus meiner Kinderzeit besitze.
Mit diesem Wilhelm war ich öfters in einem der Seitentäler oder irgendwo auf den Höhen in Wald und Flur unterwegs und wir haben dabei so nebenher manches Abenteuer gesponnen. Einmal waren wir keuchend auf einem schmalen und sehr steilen Pfädchen zum Katzenstein hinauf unterwegs und sahen Gold auf dem Weg, das hell glänzend im Sonnenlicht schimmerte. Was wir fanden, waren kleine Plättchen und wohl Pyrit, Glimmer oder ein anderes glänzendes Mineral, wir träumten aber vom großen Reichtum und sahen uns schon als erfolgreiche Goldschürfer.
Ein anderes Mal waren wir, aus einem nicht mehr bekannten Grund, an einem windstillen, angenehm sonnigen Nachmittag weit oberhalb des Schanzbachs im weglosen Gelände unterwegs. Plötzlich brach auf einer Lichtung gegenüber und in Sichtweite, aus dem Unterholz eine riesig erscheinende Wildsau wildschnaubend, mit furchteinflößendem Getöse und hielt über die grasbewachsene Fläche geradewegs auf uns zu. Das war kaum mehr als ein Steinwurf von uns entfernt. Blitzschnell war ich im nächststehenden Baum – das war ich fix –, dann staunte ich aber nicht schlecht, denn der sonst so behäbige und schwerfällige Wilhelm hatte es auch auf den Baum geschafft. Jetzt saßen wir schlotternd im dürren Geäst. Die Wildsau wollte sich auch einfach nicht mehr abziehen, sie blieb in der Nähe des Baumes und scharrte angriffslustig auf dem Boden und pflügte mit der Schnauze die Waldnarbe um. Natürlich fantasierten wir mit flauem Gefühl im Magen bei dem Gedanken, es könnte der Sau gelingen den Baum auszugraben und der fällt mit uns um. Vermutlich hatte sie nur nach Engerlingen gegraben oder nach Eicheln gesucht, wir waren aber vor entsetzlicher Angst in Panik. Irgendwann trollte sie sich dann doch davon und wir durften aufatmen. Ungeduldig, aber erst nach einer ausreichenden Wartezeit, getrauten wir uns vom Baum und rannten schleunigst hinunter ins Dorf und heim.
Einer betagten Frau im Dorf brachte ich wöchentlich die bestellte Zeitschrift. Ich war zwölf Jahren alt und sie schenkte mir ein Paar gebrauchte Ski. Vermutlich waren sie von ihrem verstorbener Mann. Die Dinger waren noch echte, von einem Schreiner angefertigte Bretter mit altmodischer Lederbindung, solche, wie sie heute im Museum stehen. Nach jeder Saison mussten die Skispitzen gespannt werden, damit sich der Bogen nicht verflachte. Sie waren viel zu lang und passten auch überhaupt nicht zu meiner Körpergröße. Doch das störte mich nicht im Geringsten. Ich hatte jetzt ein paar eigene Ski und lernte damit passabel Skilaufen. Diese alten Bretter benutzte ich mindestens drei lange Winter. Neue und moderne Skier hätte ich mir niemals leisten und kaufen können. Dafür hatte ich kein Geld und die Eltern hatten es auch nicht. Von den Verwandten und anderen, die mir nahestanden, war ebenfalls nichts zu erwarten oder die dachten nicht einmal an so etwas, vermutlich kannten sie meinen Wunsch nicht einmal.
Im Alltag war es völlig normal und selbstverständlich, dass wir fast überallhin zu Fuß gingen. Im Dorf gab es nur wenige, die schon ein Auto besaßen. Wer motorisiert war, der besaß allenfalls ein Motorrad und noch mehr waren mit Mopeds, die kleinere Version, mobil. Das konnte sich ein Normalbürger zumindest noch leisten.
Ich fuhr mit einem alten klapprigen Fahrrad und das war noch ohne Gangschaltung. Damit kommt man auch weit, aber nicht in einem langgezogenen Tal, in dem es überall bergauf geht, und in die Seitentäler hinein waren die Wege noch steiler und meistens in einem krottenschlechten Zustand. Da machte es mit dem Fahrrad wenig Freunde oder es blieb mir nur eines, das Rad aufwärts zu schieben, um allenfalls talwärts damit zu fahren. Erst mit etwa zwölf Jahren konnte ich ein Gebrauchtrad mit 3-Gang-Schaltung kaufen. Das kostete 60 Mark und damit mein bis dahin über Jahre gesamtes gesparte Geld. Trotzdem, es war ein Fortschritt und machte mich stolz.
In der Schule wurde uns die Möglichkeit geboten, dass wir beim Lehrer Ernst Gropp Spar-Wertmarken der Sparkasse Zell erwerben durften, und natürlich hielt uns der Lehrer immer wieder zum eifrigen Sparen an. Diese Wertmarken gab er einmal in der Woche aus, und er achtete streng darauf, dass möglichst alle seine Schüler auch kauften, was er manchmal mit einer kleinen Belohnung unterstützte. Solche Marken gab es in Stückelungen ab zehn Pfennig. Wenn möglich, kaufte ich auch jedes Mal welche und klebte sie dann in ein Sammelheft. Wenn das Heft voll war, trug ich es mit heimlichem Stolz zur Bankfiliale der Sparkasse im Dorf, und dort schrieb der freundliche Filialleiter Josef Heisch die Summe meinem Sparbuch gut. Von ihm bekam ich manchmal ein Bleistift oder ein Radiergummi, immer aber ein paar Bonbons.
Mit dem besseren Fahrrad tat ich mich etwas leichter und ich war eine Idee schneller unterwegs, was nicht unwichtig war. Von Zell nach Nordrach-Kolonie waren es zwölf Kilometer und diese Strecke fuhr ich mehrmals in der Woche, und sicher einmal auch nach Haslach, das war dann die doppelte Entfernung. Auch sonst legten wir größere Strecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück. Gelegentlich wanderten wir sonntags oder an einem Feiertag zur Kornebene, wo es schon ein bewirtschaftetes Naturfreundehaus gab, das den Wanderern Getränke, Brot und eine heiße Wurst bereithielt. Auf der gegenüberliegenden Talseite war es der 1906 schon eröffnete Landgasthof „Vogt auf Mühlstein“, auch ein beliebtes Ziel an den Sonn- und Feiertagen. Diesem Haus mit langer Tradition setzte einst Heinrich Hansjakob, Bestsellerautor und „Rebell im Priesterrock“, in einem seiner Bücher ein literarisches Denkmal. Er lebte Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts und veröffentliche 74 Bücher mit hohen Auflagen. Die traurige Geschichte des kaltherzigen „Vogt auf Mühlstein“ und seiner unglücklichen Tochter erwähnte ich schon. Sie gehörte zu seinen literarischen Erzählungen und soll sich auf dem stattlichen Hof, der heute noch fast unverändert existiert, zugetragen haben.
Bekamen wir unterwegs Durst, tranken wir aus einem der vielen kleinen Rinnsale und klaren Gewässer, die gurgelnd ins Tal plätscherten. Begleiteten wir die Eltern, spendierten sie uns manchmal eine Flasche süßen Sprudel oder wir durften im Gasthaus Most trinken. Lange war das Getränk aus der Mode. Most, auch als Sidre bekannt, oder Äppelwoi, bei den Hessen, wird heute wieder mehr hergestellt und aus Äpfeln und Birnen von gepflegten Streuobstwiesen gewonnen. Damals aber war es noch sozusagen ein Grundnahrungsmittel in der Bevölkerung. Tagsüber wurde bei der Arbeit in Feld und Flur neben Wasser hauptsächlich Most getrunken, und das nicht zu gering. Zu Hause war es auch nicht anders. Der Most gehörte zum Essen dazu, wie auch sonst zwischendurch und abends. In vielen Gasthäusern konnte der Gast ebenfalls Most als billigeres Getränk bestellen.
Die Kirchengemeinde Haslach, der meine Familie seit Anfang der 1950er-Jahre in der NAK angehörte, war Teil des Kirchenbezirks Offenburg. Mehrmals im Jahr waren wir zu überregionalen Fest-Gottesdiensten in die Offenburger Kirche eingeladen. Da wollten natürlich dabei sein. Angesichts des schmalen Budgets musste der Vater zumindest ein Teil des Fahrgelds sparen. Statt die Gesamtstrecke mit der Bahn zu fahren, marschierten wir zu Fuß vom Dorf über das Pfaffenbacher Eck hinüber nach Schwaibach und dort das weite Tal hinaus bis zum Bahnhof in Gengenbach. Erst dort bestiegen wir den Zug und durften noch bis Offenburg fahren. Der Weg über den Berg dürfte gut zehn oder zwölf Kilometer weit gewesen sein, bei mehreren hundert Meter Höhenunterschied, und zurück ging es in der gleichen Weise, nur umgekehrt. Solche Fußmärsche im Sonntagsstaat waren weder ein Hindernis noch eine besondere Herausforderung, sie gehörten für uns zwischendurch einfach dazu. Doch ehrlich gesagt, wir Kinder waren nicht immer davon begeistert und öfters haben wir gemurrt oder wir versuchten uns davor zu drücken. Doch das half nichts, und am Ende haben wir es unbeschadet überstanden.
Gemeinsam mit dem Vater und meinem Bruder sind wir einmal übers Schäfersfeld hinüber ins Renchtal gelaufen, weil wir in Oppenau an einem Festgottesdienst teilnehmen wollten. Auf der Höhe wählte der Vater eine Abkürzung und wir liefen querfeldein durch das Gelände. Plötzlich versperrte uns ein mit Stacheldraht bewehrter Wildzaun den Weg. Was blieb zu tun? Zurücklaufen wollten wir nicht, also stiegen drunter durch. Dabei blieb der Vater mit seinem neu gekauften Sakko am Stacheldraht hängen und riss sich eine Dreiangel (größeres Loch) in den Stoff. Fluchend ging er weiter. Zum Glück gab es damals noch Schneider, die das Kunstflicken beherrschten. Hinterher sah man von dem Malheur nichts mehr.
Wenn einmal das Wetter nicht so mitspielte, fanden wir an regnerischen und kalten Tagen schnell eine andere Beschäftigungen oder Abwechslung im Trockenen. Im Elternhaus eines meiner Schulkameraden war im Erdgeschoss eine stillgelegte Schreinerei, in der einst sein Opa noch werkelte. Dort stöberten wir gerne zwischen altem Werkzeug, Hobeln, Sägen und anderen Dingen, hier lagerten Bretter, Werkzeug und Schablonen. Noch mehr gab es Sägemehl und Staub und dann war da noch der spezielle Geruch nach Holz und Harz. Diese alte Werkstatt war für uns eine wahre Fundgrube, ein Eldorado, und inspirierte zu kreativen Basteleien. Da konnte es draußen ruhig regnen, schneien oder stürmen. Wir bauten kleine Schiffchen, die wir später im Bach schwimmen ließen oder sägten Bretter zu, die wir in unser „Burg“, einer tief im Wald versteckten Bretterbude, gut gebrauchen konnten und darin verbauten.
Eines Tages entdeckten wir zufällig eine in einem Schränkchen gut versteckte 9-mm-Pistole mit einem Packen Patronen. Sie stammte vermutlich noch aus dem Ersten Weltkrieg. Das Ding war spannend, das wollten wir sofort ausprobieren. Wir eilten im Quartett hoch zum Pfaffenbacher Eck, tief in den Wald an einen Platz, an dem wir uns im Umfeld einer Hütte ungestört und unbeobachtet fühlten. Ein mulmiges Gefühl beschlich uns schon, und keinem war wohl bei der Sache, es reizte uns aber zu sehr damit zu schießen. Die anderen getrauten sich das nicht zu tun, deshalb nahm ich die Pistole in beide Hände, entsicherte sie und zielte auf einen Holzbalken der Hütte. Krachend löste sich der Schuss und durchschlug glatt den Holzbalken, und auch noch den Baum dahinter. Donnerwetter, das war heftig, das tat einen solchen Schlag und das war uns dann doch zu heiß. Etwas belämmert schlichen wir zurück und legten das Ding, wieder gut in Ölpapier verpackt, an den Fundort zurück.
Noch während der Schulzeit tat sich mir eine zusätzliche Einnahmequelle auf. Ich verkaufte die „Bild am Sonntag“ und Käufer waren hauptsächlich Männer in den Sanatorien. Sie wollten sich ausführlich über die Fußballspiele vom Samstag informieren. Rechtzeitig vor dem Frühstücksbeginn stand ich sonntags im Dorf am Eingang zum Speisesaal beim Kurhaus, und zum Mittagsessen bei der Lungenheilstätte in der Kolonie. Beim Gang zum Essen mussten die Patienten an mir vorbei und viele kauften die Kult-Zeitung. Ein paar Abnehmer und Dauerbezieher im Ort hatte ich auch noch. Im Schnitt verdiente ich damit wöchentlichen zehn Mark und zu den Feiertagen Ostern und Weihnachten und so, bekam ich manchmal noch ein paar Pfennige extra. Das behielt ich so bei, auch noch während der Lehrzeit, und bis ich von zu Hause ausgezogen bin.
Insgesamt legte ich so Woche für Woche hunderte Kilometer mit dem Fahrrad zurück oder ging zu Fuß, ohne dass ich groß darüber nachgedacht hätte und eine Alternative gab es auch nicht. Das war der normale Alltag, das gehörte zum Leben dazu. Vermutlich haben sich bei mir schon damals die Grundlagen und Basis für Ausdauer und Kondition gebildet, was mir in späteren Jahren und bis heute im höheren Alter noch zugutekommt.
2
Lehrzeit
Die achtjährige Schulzeit endete bei mir Ende März im Jahr 1959 und schon am 1. April begann ich die Lehre zum Kaufmann im Groß- und Einzelhandel in einem Landmaschinen-Fachbetrieb in Biberach. Vom ersten Tag an fuhr ich bei Wind und Wetter an den Wochentagen mit dem Fahrrad über zwölf Kilometer von zu Hause nach Biberach und abends wieder zurück. Eine Hürde war es nicht, ich hatte auch keine andere echte Alternative. Mit dem Linienbus und dem Zeller „Bähnle“ wäre das zu umständlich gewesen und viel zu teuer. Natürlich besaß ich weder moderne Outdoor-Kleidung noch Hightech-Klamotten, wie sie heute die Radler tragen, die wind- und wasserdicht sind. Wenn es regnete, war ich trotz Regenschutz oft nass bis an die Hüften. Und auch in der kälteren Jahreszeit musste ich mit dem Rad ins Geschäft fahren und das blieb nicht immer ohne Folgen. Schon während dem ersten Lehrjahr bildeten sich Frostbeulen an den Fußzehen, die mir im Winter noch jahrelang wiederkehrende Probleme verursachten.
Der Weg zur Arbeit war aber nicht nur lästig oder beschwerlich, es machte auch Spaß. Während der Heimfahrt traf ich mich in Zell mit anderen Kameraden aus dem Dorf. Sie waren ebenfalls Lehrlinge oder „Stift“, wie man uns nannte, dort in den Betrieben. Heimwärts radelten wir gemeinsam und das was kurzweiliger. So nebenbei heckten wir Streiche aus oder ließen uns zu Dummheiten hinreißen. Einmal haben wir ein leer stehendes Gebäude am Weg ausbaldowert und natürlich haben wir unterwegs Zigaretten ausprobiert. Wenn keiner von uns welche hatte, weil das Geld dafür fehlte, dann taten es auch Brombeerblätter in Zeitungspapier gewickelt. Zudem hatte ich eine spezielle Quelle für Zigarren. Die guten Kunden im Geschäft bekamen, wenn sie wollten, eine Zigarre und dafür standen im Büro mehrere Kistchen bei mir in Verwahrung. Davon ließ ich schon mal ein zwei oder drei für uns mitgehen und ich hatte nicht einmal ein schlechtes Gewissen dabei. Doch ich fand weder an Stumpen, Zigarren oder Zigaretten wirklichen Geschmack; das Zeug war nichts für mich, und ich sah dann auch nicht ein, etwas zu konsumieren, wovon ich keinen Nutzen hatte. Den fragwürdigen Genuss überließ ich nach der kurzen Probierphase liebend gerne den anderen. In späteren Jahren entwickelte sich beim mir geradezu eine Aversion gegen das Rauchen und in meiner Familie wurde nie geraucht. Auch unsere beiden Kinder und die drei Enkelkinder haben nie mit Zigarettenrauchen begonnen.
Im ersten Winter während der Lehre fielen die Temperaturen in einer Kältephase zeitweise tagsüber auf minus 10 Grad in den Keller, es war „sibirisch kalt“. An so einem kalten Tag kamen wir aus Jux und Tollerei während der Heimfahrt auf die Schnapsidee und machten eine ungewöhnliche Wette. „Wer wagt es, mit freiem Oberkörper von Zell nach Nordrach zu fahren?“ Mit mir nahm noch einer die verrückte Wette an. Der Preis sollte es ein Kasten Bier sein. Den uns Entgegenkommenden fielen fast die Augen aus dem Kopf, als sie uns bei dieser Kälte mit nackigem Oberkörper fahren sahen. Schon nach kurzer Zeit empfand ich die Kälte nicht mehr unerträglich, der Oberkörper hatte sich schnell daran gewöhnt oder angepasst und wärmte von innen. Wir durften nicht schneller als die anderen fahren, und diese sollten auch nicht unnötig bummeln. Die eiskalten Hände durften wir während der Fahrt auch nicht in die Hosentasche stecken und keine Handschuhe tragen. Infolgedessen fror ich erbärmlich an den Händen und ganz schlimm an den Ohren. Trotzdem haben wir die Wette gewonnen und ich bekam hinterher nicht einmal einen Schnupfen. Stattdessen schimpfte meine Mutter gehörig über so einen Blödsinn, nachdem ihr die Sache zu Ohren gekommen war.