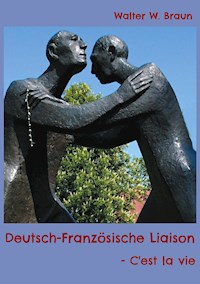Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gerhard Lösch war ein Kind seiner Zeit. Mit Spreewasser getauft und absolutem Machtanspruch setzte er seine egoistischen Interessen in seinem Umfeld mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln durch. Vor allem eines wollte er unbedingt erreichen: Viel Geld verdienen, reich und unabhängig werden. Die Autoren erzählen hier die Geschichte seiner Jugend und Entwicklung in der Weimarer Republik und im Hitlerdeutschland. Seine Kriegserlebnisse und den Kampf ums Überleben im Nachkriegs-Chaos, wie sie abertausende Menschen prägte. Unterdrückt und niedergeduckt, um ihr Leben betrogen in der Nazizeit, versuchte er den Krieg irgendwie zu überleben. Kam kaum, dass er einmal durchatmen konnte, in den kommunistischen Schlamassel hinein und wurde wegen ein paar kleineren Schiebergeschäften, in die stalinistischen Unterdrückungs- und Einschüchterungs-Zuchthäuser der DDR, Torgau und Bautzen eingelocht. Nach Stalins Tod in den Westen abgeschoben, strebte er dem Lichte zu, die Sonne ging plötzlich nicht mehr im Osten auf, sondern glänzte im goldenen Westen. Damit begann sein Aufstieg aus bescheidensten Anfängen, zu einem der größten und bedeutendsten Handwerksbetriebe in der Bundesrepublik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Ena mit Spreewassa getofta
Die Zechprellerei
Die Arbeitssuche
Der Prozess
Das Urteil
Der Erste Weltkrieg
Gerhard Lösch und seine Charakterzüge
Die Gang
Die Eltern von Horst Reiner Menzel
Der Ernst des Lebens beginnt
Greta Lösch und Heinrich Kowalski
Gerhard Lösch im Zweiten Weltkrieg
Der Einsatz in Frankreich
Horst Reiner Menzel
Emma und Alfred Lösch
Gerhard Lösch im Knast
Der Aufstand Hungerstreik am 13. März 1950
Der Aufstand am 31. März 1950
Horst Reiner in der Lehre und die Flucht
Gerhard Lösch das Verkäufergenie
Gerhard Lösch der Unternehmer
Der monatliche Status
Die Mauertrockenlegung
Wenn‘s dem Esel zu wohl wird
Zurück ins Blitzschutzgeschäft
Neue Heimat in der Ortenau
Ein gewieftes Schlitzohr
Gute Mitarbeiter sind die halbe Miete
Mauertrockenlegung
Spezielle Spezies, die Vertreter
Ein Lukratives Zusatzgeschäft
Personelle Entwicklung
Freizeitvergnügen am Pool
Neuer moderner Firmensitz
Neue Verkaufsstrategien
Kooperation mit Fertighaushersteller
Genialer Clou mit dem TÜV
Betriebliche Feiern und Unternehmung
Herber Schicksalsschlag
Altersdomizil Cannes
Der Falschspieler
Eine folgenreiche Steuerprüfung
Neubeginn unter Horst Reiner
Die Traum von der eigenen Firma ist geplatzt
Die Monteure, eine spezielle Spezies
Dem Wettbewerb werden wir unheimlich
Veränderungen
Die letzten Jahre bei Lösch
Eine Episode mit unschönem Ende
Trennung und klare Verhältnisse
Verkauf und das Ende einer Erfolgsgeschichte
Ein erfülltes Leben geht zu Ende
Schlussbemerkung und Resümee
Anhang 1, Donar, der Gott des Gewitters
Anhang 2, Die Geschichte des Blitzableiters
Vorwort
Von null auf hundert. Der Protagonist dieses Buches hatte nie etwas erfunden oder eine besondere Kompetenz in irgendeinem Handwerk vorweisen können, aber Gerhard Lösch war ein Autodidakt, der seinesgleichen suchte. Er hatte zwar eine Verwandtschaft, aus deren Reihen der Neffe hervorging, der in dieser Geschichte eine bedeutende Rolle spielt, aber von einer Dynastie kann sicher nicht die Rede sein. Er bekam einen Stiefsohn, den seine Frau mit in die Ehe brachte, der unter dem dominanten Stiefvater litt, aufbegehrte und schon in jungen Jahren auf tragische Weise ums Leben kam. Sie waren die einzigen, die das familiäre Unternehmen hätten weiterführen können. Aber es kam anders, Lügen, Intrigen und Egoismus triumphierten, wie in vielen Firmen, die nach dem Krieg zu schnell in den Himmel schossen. Ein Blitzschutz-König, das war er in seinem Reich und in der Branche, ein Monarch im Tun und Handeln und er wurde es wahrlich ohne große eigene Anstrengung und Zutun. Sein Verdienst war es allerdings, immer die richtigen Leute zu finden, die ihn am Ende dorthin brachten, wohin er wollte: an viel, viel Geld. Seine große Stärke im Leben war, ein Gespür für Menschen zu haben, sie für sich einzunehmen und zu gewinnen. Sein Credo war: „Jeden Tag steht ein nützlicher Idiot auf, den du vor deinen Karren zu spannen kannst, du musst ihn nur finden.“ Sie alle arbeiteten für ihn willig und engagiert, ohne dass er sich selber die Hände – auch im übertragenen Sinne – schmutzig machen musste.
Walter W. Braun, Schwarzwaldautor
Horst Reiner Menzel, Autor und Aphoristiker
September 2021
1
Ena mit Spreewassa getofta
Erzählt von Horst Reiner Menzel
Einführung
Wenn jemand denkt, er wäre heimatverbunden, so ist diese Frage überhaupt nicht mehr korrekt zu beantworten. Es gibt zu viele Menschen auf der Welt, die nicht mehr an ihrem Geburtsort oder in ihrer Ursprungsheimat leben, sondern zufällig irgendwo auf der Welt strandeten. Was ich meine ist, den echten Brandenburger, der hier geboren wurde, in die Schule ging, im Sportverein tätig war, um dann am Ende seines hoffentlich langen Lebens sein müdes Haupt auf dem städtischen Friedhof seiner Heimatstadt zur Ruhe zu betten, den gibt es kaum noch. Dieser Typus: „Bleibe im Lande und nähre dich redlich“, ist eine sehr seltene Spezies geworden. Doch gerade diese Menschen, die alle Straßen und Winkel ihre Stadt wie ihre eigene Hosentasche kennen, sie sind es, die das Gemeinwohl ihrer Heimat prägen. Leute die ihre Stadt kennen und erleben, Heimatgefühle entwickelten, sterben langsam aus. Das ist auch ein Hauptgrund unserer heutigen Zerrissenheit, wie auch im Umgang der Menschen mit- und untereinander. Eine neue Zivilisationskrankheit breitet sich rasant aus. Wer ein Leben lang den Nachbarn kannte, der wird sich nie erdreisten ihn zu bestehlen oder ihn zu beleidigen, vor eine S-Bahn zu stoßen oder seiner Tochter ein Leid antun. Wenn ja, wäre er in dieser seiner Stadt nicht mehr tragbar und müsste aus ihr verschwinden, weil alle erzieherisch mit dem Fingen auf ihn zeigen würden. Was hätte er hier noch zu erwarten?
Von Wilhelm Busch stammt der weise Spruch: „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert“. Heutzutage muss man sich gar keine Sorgen mehr machen, der neue Spruch lautet:
„Ist der Ruf erst mal zerbrochen, darf man auf Bewährung hoffen. Heut` versteckt man vor Gericht, hinter Aktenordnern sein Gesicht.“
Rei©Men
Von einem bemerkenswerten Menschen, den das Leben arg gebeutelt hat, der kaum eine Chance hatte anders zu werden, als es ihm die Zukunft gestattete, soll hier berichtet werden. Von einem, der sich durch alle Widrigkeiten des Lebens hindurchkämpfte und dabei auch kräftig seine Ellenbogen gebrauchte. Er wusste es immer:
Es war die Lust an der Demütigung, sie gab ihm immer wieder neuen Schwung.
Rei©Men
Sein Wahlspruch war:
Die Faulheit ist mein Freund, die es immer gut mit mir meint.
Rei©Men
Seine Erfahrung: „Es ist nahezu unmöglich sich ohne Lügen und Tricksereien durchs Leben zu schlagen.“ Das hatte Gerhard Lösch, der Protagonist dieses Buches, schon in jungen Jahren am eigenen Leibe erfahren müssen. Doch bisher stand er der Wahrheit immer noch näher als der Lüge. Ungewöhnliche Ereignisse und das unbarmherzige Umfeld im Leben eines Menschen können das Pendel aber schnell nach gut oder böse ausschlagen lassen.
Seine Heimat
Die idyllische Stadt Spremberg finden wir etwa 20 Kilometer südlich von Cottbus entfernt. Sie grenzt an den sächsischen Landkreis Bautzen und im Norden an Cottbus. Sie liegt im äußersten Osten Deutschlands, 25 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Die Altstadt ist eingebettet in einer lieblichen Auenlandschaft zwischen zwei Spreearmen und einer idyllischen Insel in der Mitte. Die Spree fließt mitten durch die Stadt, die sich mit der Talsperre Bräsinchen zu einem beliebten Naherholungsgebiet in unmittelbarer Nähe entwickelt hat. Außerdem entspringen zwei Gewässer im Bereich des Gemeindegebietes, die Kochsa und das Hühnerwasser.
Zwischen 1871 und 1918 galt der Ort noch als geografischer Mittelpunkt des Deutschen Reiches; darüber gibt ein Gedenkstein Auskunft, der sich nur wenige Meter vom Originalstandort befindet. Und genau in diesem preußischen Landstrich haben die Lösch‘s ihre Wurzeln.
Die sagenumwobenen Lutchen umtanzen den Babenberg in der Babina Gora
Anmerkung:
Einer Wendische Volkssage nach, sind die Lutchen kleine Leute, die in unauffindbaren Erdhöhlen wohnen, in der Nacht hervorkommen und ihr Unwesen treiben. 1)
1 )http://www.faszination-spreewald.de/sagen/Ludki.html
2
Die Zechprellerei
Ursprünglich war Alfred Lösch – der Vater von Gerhard Lösch – auf der Wanderschaft aus seiner alten Heimat, der Oberlausitz, wo er in Neugersdorf geboren wurde, seine Kindheit und Jugend verlebte, in der Kleinstadt Spremberg gelandet, wo er nach seinem Vorhaben nur über Nacht bleiben wollte. Das hatte sich so ergeben, nun war er aber in eine üble Zechprellerei hineingeraten. Ein paar Wanderburschen hatten sich „französisch verabschiedet“ und ihre Zeche nicht bezahlt, waren einfach verschwunden, bevor der Wirt sie abkassieren konnte. Alfred hatte mit den anderen nichts zu tun, er kannte sie erst wenige Stunden, seit er mit ihnen am gleichen Tisch gesessen hatte. Er aber war noch da, doch sein restliches Geld reichte nicht aus, um den anderen ihre Schulden mitzubezahlen.
Dem Gastwirt war das egal, er hielt sich an den, der noch am Tisch saß. Alfred Lösch bestand aber darauf, nur seine eigene Zeche zu begleichen, doch das Schlitzohr von Gastwirt holte die Polizei und behauptete, dass er die anderen Burschen eingeladen hätte. Die Ortsbüttel wollten ihn ins Gefängnis stecken, doch ein anderer Gast hatte die Szenerie beobachtet und verriet dem Beamten, das Gleiche wäre schon mehrmals passiert. Vermutlich hatten der Wirt und seine verschwundenen Gäste die gleiche Masche des Öfteren abgezogen. Die Typen, die sowieso nur in seiner Wirtschaft herumlungerten, machten das Spielchen mit und der Wirt steigerte auf diese linke Art und Weise seinen Umsatz.
„Also“, sagte der örtliche Polizeibeamte, „dann kommen jetzt alle mit aufs Revier und da schreiben wir ein schönes, langes Protokoll, damit wir alles schriftlich vorliegen haben. Und ich sage euch jetzt schon, dass ihr eure Aussagen alle unterschreiben werdet.“
Ja, der Mann kannte seine „Pappenheimer“, und war sich der Machtausübung in seinen Amtsräumen wohl bewusst. Da hatten schon ganz andere Sünder vor der Staatsmacht kapituliert. Alfred Lösch machte die Ankündigung des Polizeibeamten keine Angst, er war schon wiederholt mit den Behörden zusammengestoßen, doch da handelte es sich immer nur um kleinere Vergehen, die der hiesigen Polizei bestimmt nicht bekannt waren. Deshalb gab er sich gelassen und unterstützte den Beamten, indem er darauf bestand, dass diese „Gaunerei“, wie er sie nannte, aufgedeckt werden müsse. Nun merkte der Gastwirt wohl, dass er „mit Zitronen gehandelt hatte“ und beschwichtigte den Beamten. „Gut, ich sehe ein, dass der Bursche die anderen Kerle erst hier kennengelernt hat und ich verzichte auf meine Forderung, die werden mir schon noch mal übern Weg laufen und dann schnappe ich sie mir.“ „Wenn sie einverstanden sind“, sagte er zu Alfred, „dann bezahlen sie ihre eigene Zeche, dann will ich von einer Anzeige wegen Zechprellerei absehen.“
Selbst in seinem jungen Leben hatte Alfred schon mehrfach schlechte Erfahrungen gemacht und war, wie man so schön sagt: „Ein gebranntes Kind.“ „Herr Wirt, was bin ich ihnen schuldig?“ Der Wirt nannte eine Summe und nahm das dargereichte Geld an, damit war vor Zeugen die Schuld beglichen. „So, das wäre erledigt, aber ich bestehe auf einem Protokoll. Der Vorfall könnte mir später weiter anhängen und muss protokolliert werden.“
Der Polizist grinste ein klein wenig und dachte kurz nach. Er konnte natürlich die Sache auf sich beruhen lassen, doch er witterte mit diesem Wirt weiteres Ungemach und vor allem neue Arbeit, die auf ihn zukommen könnte, wenn er hier larifari handelte. „Also, dann alle mit aufs Revier.“ Der Zeuge vom Nebentisch, hatte bislang nur zugehört und war bass erstaunt, als der Polizist ihn aufforderte, mit zur Polizeiwache zu kommen. Der Wirt versuchte noch ein paar Ausflüchte, wie: „Man will doch keinen Ärger mit der Polizei bekommen, nein, niemals.“ „Auf geht’ s“, befahl der Polizist, „ich will nichts mehr hören.“ Hinterher, als dann die leidige Sache aktenkundig geworden war, unterschrieb jeder der Beteiligten und sie gingen ihres Weges. Was aber keiner ahnte, ja ahnen konnte, die Angelegenheit war damit noch lange nicht aus der Welt geschafft.
3
Die Arbeitssuche
Nach dieser unangenehmen Sache hatte sich Alfred Lösch nach einem Nachtquartier umsehen wollen, aber der Gast, der für ihn ausgesagt hatte, fragte nach, wo er unterkommen wird. Nachdem er gehört hatte, dass er es noch nicht wisse, nannte er ihm dann die Adresse einer Witwe, die Betten vermietet. „Wollen sie morgen weiterziehen, oder suchen sie eine Arbeit?“, fragte er weiter. „Ja, ich weiß nicht so recht, nach diesem negativen Erlebnis, fällt es mir schwer, das heute noch zu entscheiden. Eigentlich hatte ich schon vor, weiterzuziehen. Wissen sie denn, ob hier irgendwo Leute gesucht werden?“ „Ich arbeite bei der Post und gestern ist uns ein Briefträger ausgefallen. Ja, ja, ich weiß, da muss man sich in der Stadt auskennen“, schob er nach. „Können sie lesen und schreiben? Dann würden sie probeweise erstmal als Briefsortierer bei uns anfangen.“ „Klar doch, ich bin 8 Jahre in die Schule gegangen, da hat meine Mutter drauf bestanden.“ Alfred dachte er höre nicht richtig: Briefsortierer, er hatte ja bisher schon alles Mögliche gemacht und sich als Gelegenheitsarbeiter, Stallknecht und Laufbursche durchgeschlagen.“ „Briefsortierer“, überlegte er laut, „was verdient man denn da so?“ „Sie haben einen 10-Stundentag und bekommen als lediger Anlernling 20 Pfennige in der Stunde, das sind etwa 40 Mark im Monat.“ Alfred fiel aus allen Wolkentürmen, bisher hatte er nicht einmal die Hälfte bekommen. „Wo muss ich mich denn melden?“, fragte er den neuen Bekannten. „Kommen sie morgen früh um 7 Uhr auf das Hauptpostamt und fragen sie nach Otto Krüger.“ „Danke für alles“, rief er dem freundlichen Helfer noch hinterher, dann war Krüger schon weg.
„Was zu Otto Krüger wollen sie, was wollen sie denn von dem?“, war die zweifelnde Frage des ersten, der ihm mit einer blauen Postuniform über den Weg lief und den er ansprach. Dabei schaute er Alfred Lösch von oben bis unten genau an. Beim Blick auf die ausgelatschten Stiefel, stand sein Urteil über den Charakter des Taxierten bereits fest. Er hatte schon ein paar Kraftausdrücke auf der Zunge, kam aber nicht dazu sie auszuspucken. „Ah, da sind sie ja, pünktlich, wie die Post. Kommen sie gleich mal mit mir“, meldete sich nun sein freundlicher Helfer von gestern. Dem Postuniformierten fiel die Kinnlade herunter, der nächste Griff ging an sein ergrautes Hinterhaupt, das er beim Nachdenken immer an der gleichen Stelle und mit zusammengekniffenen Augen kratzte.
In der aufstrebenden Industriestadt Spremberg war es für junge kräftige Burschen, die arbeitswillig waren, kein Problem, eine angemessene Arbeit zu finden. Es war aber schon etwas Besonderes, wenn im Bekanntenkreis erwähnt wurde: „Der ist bei der Post angestellt.“ Da kamen in der Reputation nicht einmal Bankangestellte mit.
Nach ein paar Wochen hatte sich Alfred Lösch in der Sortierstelle ganz gut eingelebt. Die Arbeit war nicht schwer, man musste nur die Adressen auf den Briefen und Päckchen lesen und sie gekonnt in den richtigen Sack zur Weiterbeförderung werfen. Dabei durfte kein Fehler passieren, sonst landete der Brief in Aachen statt in Aalen. Die Arbeit gefiel ihm gut und inzwischen hatte er sich in Spremberg bestens eingelebt und war schon beinahe sesshaft geworden.
Die Witwe Emma Bär hatte aus erster Ehe ein allerliebstes Töchterlein. Das Kind war sechs Jahre alt und hieß Hildegard. Zu ihrem Leidwesen war Emma Bärs Mann vor einiger Zeit an Tuberkulose gestorben. Da dauerte es nicht lange, Emma und Alfred hatten sich ineinander verliebt und machten Pläne für eine gemeinsame Zukunft; sie wollten so schnell wie möglich heiraten. Die Witwe Emma passte gut zu ihm, in der Wohnung war genügend Platz für ein junges Paar und die Oma Bertha freute sich schon klammheimlich auf weitere Enkelkinder.
Der sparsame Alfred Lösch hatte sich ein paar Groschen auf die Seite legen können, weil er inzwischen auch bei Bertha und Emma mit am Tisch saß. Insgeheim hatte er eine heimliche Leidenschaft und das war seine eigentliche Profession, die er aber nicht ausleben konnte, weil sich in Kaiserzeiten nicht jeder Berufswunsch erfüllen ließ. Er wäre zu gerne Förster geworden. Die Försterstellen waren sehr begehrt und standen nur den hochherrschaftlichen Häusern auf den Gütern und den Waldbesitzern zur Verfügung. Die infrage kamen, hatten ihre Gönner, wenn ein Lehrling gesucht wurde, ging es kaum nach Eignung oder Talent, sondern nur um Beziehungen. Solche „Türöffner“ hatte er leider nicht gehabt, und in seiner Jugend durfte er immer nur an Treibjagden teilnehmen.
Doch selbst das fehlte ihm nun unsäglich, deshalb war er nach Feierabend und an den Wochenenden, oft in den Wäldern der Umgebung unterwegs. Aus Büchern hatte er sich einen guten Grundstock an reichem Wissen angeeignet, und alle sagten zu ihm: „Du hast den Beruf verfehlt.“ Inzwischen hatte er sich mit seinem Leben ausgesöhnt, denn er hatte es ja nun ganz gut getroffen. Im Wald kannte er jedes Eichhörnchen persönlich. In jedem Fuchs- oder Dachsbau wusste er, wenn Nachwuchs angekommen war. Die Vögel in Wald und Flur waren seine gefiederten Freunde. Dabei muss man wissen, dass die Wälder in der damaligen Zeit von Wild überquollen, weil Jagen nur den privilegierten Herren und ihren Jagdfreunden gestattet war. Doch die kümmerten sich kaum um das Kleinwild, was zur Folge hatte, dass sich Hasen und Kaninchen ungemein vermehrten. Da war man froh, wenn es Bauern oder Leute wie Alfred gab, die diese Plage ein wenig dezimierten. Auch kleine Singvögel standen nicht auf dem Zettel der Jagdherren und dienten nur der Ernährung von Greifvögeln, die wurden aber seitens der Jäger ausschließlich wegen der Trophäen geschossen, die man sich ins Jagd-Zimmer hängen konnte.
Die beiden, Alfred und Emma, waren noch in einem Alter, wo bei jungen Menschen die sexuelle Neugier am anderen Geschlecht sehr ausgeprägt ist, überhaupt, wenn die Früchte der Begierde sehr hoch hängen. So dauerte es auch nicht lange, dann war Emma schwanger geworden. Oma Bertha freute sich, dass sich alles so schön anließ und bereitete die Hochzeit vor, während Emma und Alfred zum Standesamt gingen und das Aufgebot bestellten. Beide legten ihre Geburtsurkunden vor, doch als der Standesbeamte sah, dass Alfred aus Neugersdorf stammte, verlangte er von ihm, dem Auswärtigen, ein Leumundszeugnis.
Weil Alfred noch nicht lange in der Stadt lebte, gab es nur eine Möglichkeit, er musste das Zeugnis in seiner Heimatstadt anfordern. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, fiel aber anders, als erwartet aus. „Aus Neugersdorf gebe es über Alfred nichts Negatives zu berichten, aber von der Polizei in Spremberg würde eine Anfrage vorliegen, die besage, dass Alfred dort in eine Zechprellerei verwickelt worden war.“ Das hatte er nun nicht erwartet, Emma und Bertha waren schockiert, und obwohl Alfred seine Unschuld beteuerte, glaubten ihm die biederen Bürgersleute kein Wort. Was eine kaiserliche Behörde festgestellt hatte, das musste auch stimmen, da bestand überhaupt kein Zweifel.
Zudem hatte sich die Angelegenheit schnell in der ganzen Stadt herumgesprochen, und Emma weinte bitterliche Tränen, während Bertha drauf und dran war, ihren „noch nicht Schwiegersohn“ vor die Tür zu setzen. Was konnte Alfred jetzt noch tun? Er sprach bei der Polizeibehörde vor und bekam zur Auskunft, dass man in dieser Sache nichts machen könne. Der Wirt hätte zwar seine Anzeige zurückgenommen, aber das sei kein Beweis für seine Unschuld. Er müsse hier oder in seiner Heimatstadt Einwohner benennen, die für ihn bürgen würden.
Die bittere Enttäuschung wirkte sich bei Alfred Lösch auch auf seine Arbeit im Postamt aus. Der einzige Mensch, der noch an ihn glaubte, war nach dem ersten Schock Emma, und das hielt ihn aufrecht. Durch diese Situation ergaben sich aber nun Spannungen zwischen Mutter und Tochter, die sich immer mehr aufbauten. Inzwischen verlangte Bertha, dass sich Emma trotz ihrer Schwangerschaft von Alfred trennen sollte, weil die Sache mit der Zechprellerei inzwischen schon das Stadtgespräch geworden war.
Der Wirt des Gasthauses „Zum Löwen“ Paul Andres, hatte ein Übriges getan und seinerseits gegen Alfred gehetzt, weil er meinte, so seine eigene Reputation aufbessern zu können. Immerhin stand ja Aussage gegen Aussage, und die beteiligten jungen Burschen waren unauffindbar. Immer wieder wurde er von seinen Gästen nach der Sache gefragt, wie das damals gewesen sei, und so musste er, ob er wollte oder nicht, wieder und wieder die gleiche Geschichte erzählen, die er dann jedes Mal mit neuen Details zusätzlich ausschmückte.
Unter den böswilligen Zeitgenossen galt Alfred Lösch inzwischen als hergelaufener Lump, der sich bei Bertha und Emma eingeschlichen und sogar das arme Töchterchen missbraucht hatte. Nüchtern betrachtet, stand die Sache für den Beschuldigten gar nicht gut.
Natürlich kam auch seinem Chef Otto Krüger die Angelegenheit zu Ohren. Er ließ Alfred in sein Büro kommen, machte ihm Mut und riet ihm, die nicht stattgefundene „Zechprellerei“ gerichtsanhängig zu machen. Er sah für Alfred sonst keine andere Möglichkeit aus der Sache ungeschoren herauszukommen. Dabei war Otto Krüger doch eigentlich der einzige Zeuge gewesen. Nur, er musste oder wollte sich in seiner Position als Postchef aus der Angelegenheit heraushalten, schließlich hatte er auch Verantwortung für seine Familie. Er riet Alfred sich einen Anwalt zu nehmen und gegen den Löwen-Wirt Klage einzureichen. „Das ist für sie der einzige Weg, ihren guten Namen wiederherzustellen“, riet er ihm offen und ehrlich. Der andere Weg wäre gewesen, so schnell wie möglich aus Spremberg zu verschwinden. Das kam aber nicht infrage, da Alfred seine Emma ehrlich liebte, und er musste auch wegen ihres ungeborenen Kindes bleiben. Beim gemeinsamen Abendessen erklärte er den beiden Frauen, warum er den gerichtlichen Weg einschlagen muss.
Schon am nächsten Tage suchte er den Anwalt Johann Eckstein auf. Der kannte natürlich diese böse Geschichte vom Hörensagen, ließ sich aber von Alfred Lösch alles noch einmal genau und bis ins Detail erzählen. Ab und zu machte er sich Notizen und stellte Zwischenfragen. Zuletzt ließ er sich von Alfred Lösch eine Vollmacht unterschreiben.
Als erste Maßnahme besorgte er sich das polizeiliche Protokoll, dann ging er mit seinem Mandanten alle Einzelheiten noch einmal sorgfältig durch. Alfred sorgte sich hauptsächlich wegen der Bezahlung des Anwaltes, doch Eckstein zeigte sich zuversichtlich, dass er den Prozess gewinnen würde. „Wenn wir den Prozess gewinnen, bleiben die Kosten bei Paul Andres hängen“, beschwichtigte er.
4
Der Prozess
Der Gerichtstermin begann mit der Eröffnungsrede des Anwaltes Johann Eckstein, von der klagenden Seite. Er beschuldigte den Gastwirt Paul Andres der üblen Nachrede, Alfred Lösch hätte angeblich seine Zeche nicht bezahlt. Er verwies auf das bei der Polizeibehörde vorliegende Protokoll, worin sich die streitenden Parteien geeinigt hatten, dass die Angelegenheit als erledigt betrachtet werde. Trotzdem hätte der Gastwirt in der ganzen Stadt die angebliche Zechprellerei von Alfred Lösch herumerzählt und damit dessen guten Ruf beschädigt. Erschwerend käme hinzu, dass der Beklagte, Paul Andres, mit diesen Falschinformationen für seine Gaststätte neugierige Gäste angelockt und aus der Situation zu Unrecht noch ein Geschäft gemacht habe. So habe er fortwährend zum Nachteil des Klägers gehandelt und nicht nur sein Ansehen beschädigt, sondern beinahe seine Existenz zerstört. Der Anwalt erhob einen Schadenersatzanspruch in Höhe von mindestens 500 Reichsmark.
Der Gastwirt Paul Andres andererseits, war sich seiner Sache absolut sicher, dass man ihm nichts nachweisen könne, deshalb hatte er erst gar keinen Anwalt mitgebracht. Er, der Beklagte, begann den schon hinlänglich bekannten Sachverhalt zu seinen Gunsten darzustellen, konnte damit aber kaum noch jemanden beeindrucken. Dann wurde Otto Krüger, der Postchef, in den Zeugenstand gerufen und vom Richter daraufhin belehrt, dass er hier vor Gericht die Wahrheit zu sagen hätte und er sich vorbehalten würde, ihn zu vereidigen.
In seiner Aussage bekundete Otto Krüger, dass er die jungen Burschen zuvor schon ein paar Mal im Gasthaus Löwen gesehen hätte. Er erwähnte auch, dass er den Eindruck gehabt hätte, dieses Spielchen mit der Zechprellerei schon einmal erlebt zu haben. Der Richter wollte wissen: „Ob das nur sein Eindruck gewesen sei, oder ob er beschwören könne, dass da ein falsches Spiel im Gange gewesen sei?“ „Nein“, sagte Krüger, „beschwören kann ich das nicht.“
Genau in diesem Moment entstand eine kleine Unruhe im Gerichtssaal. Ein Mann war aufgestanden und rief laut: „Aber ich kann es beschwören.“ „Kommen sie doch bitte einmal vor in den Zeugenstand und erzählen sie uns, was sie wissen. Wie ist denn ihr Name und wo wohnen sie?“, ließ sich der Richter vernehmen. Der Gerichtsschreiber notierte die Angaben, damit waren die Formalitäten erledigt. „So Herr Becker, wir hören.“
In den nächsten zehn Minuten erzählte Becker den erstaunten Zuhörern und dem Gericht alle Einzelheiten seines eigenen Erlebnisses. Dann griff er in die Jackentasche und zauberte eine Gasthausquittung hervor, die bewies, dass er an dem besagten Abend 21 Humpen Bier getrunken und bezahlt hatte. „Ja, dann sind sie doch wohl unter dem Tisch eingeschlafen, oder, wie war das, Herr Zeuge?“ „Ne, Herr Richter, der kam janz nüchtern nachhause und hatte ene Wut im Bauch, die sich gewaschen hatte.“ „Ist das ihre Frau?“ „Ja, Herr Richter, dat isse, wie se leibt un lebt.“
„Also, Frau Becker, nu kommse och mal vor und azähle se ma, wassa ihne jesacht hat.“ „Herr Richta, ich kenn ja meine Aujust nu schon 40 Jahre, aber, dat der sich so dämlich hat verschaukeln lassen, dat hat ma mächtich geärjat. Zuerst hab ichn dat nich jeglobt, aba nun is ma klar, was der Andres so für Geschäftchen macht. Wir wern och noch off Rückzahlung vaklajem, wo nu feststeht, dassa jelogen hat.“
„Gut Frau Becker, das machen sie, ich freue mich schon darauf.“
„Also, Herr Andres, haben sie noch etwas dazu zu sagen, wenn nicht, könnten wir den Fall abschließen. Außerdem würde ich ihnen dringend anraten, dem Herrn Becker die unrechtmäßig abverlangte Summe von, wie hoch war das? Ja, hier ist ja der Beleg, also 19,50 Reichsmark zurückzuerstatten, dann ist das auch gleich erledigt, andernfalls, sie haben es ja gehört, werden wir uns hier bald wiedersehen.“
Der Richter ließ im Tonfall keinen Zweifel, dass was er sagte, auch ernst gemeint war.
5
Das Urteil
Der Anwalt Johann Eckstein hatte sein Plädoyer gehalten und das Urteil über Paul Andres stand eigentlich schon fest, es musste nur noch geschrieben werden. Beim Richter handelte es sich um einen jovialen älteren Herrn, auch nicht frei von Vorurteilen über die Jugend und speziell verärgert, über die immer mehr um sich greifende Sorglosigkeit im Umgang mit der Moral. Da wollte er zuerst mit seinem Urteil ein abschreckendes Beispiel geben, doch dann las er zufällig einen Satz zum Thema: „Meinungen“ in einem juristischen Fachblatt. Darin mahnte ein junger Jurist seine Kollegen an, sich nicht allzu schnell den vorherrschenden Meinungen anzuschließen, sondern erst einmal nach kluger Überlegung, sich seine eigene Meinung zu bilden, statt alles nachzuplappern, was andere zu einem Thema geäußert hatten.
Das hatte nicht unbedingt etwas mit der Juristerei zu tun, sondern bezog sich mehr auf sogenannte Meinungsmache, von Politikern und der Presse, die sich ja oft als die selbsternannten Moral-Apostel darstellten, sich aber dann, frei nach dem Motto: „Was kümmert mich mein dummes Geschwätz vor vorgestern“, nie um die Folgen ihres Tuns bekümmern.
Vor dem Reden, erst mal überlegen, ist immer Überlegen.
Rei©Men
Der große Schriftsteller Mark Twain soll einmal gesagt haben, mahnte er an: „Wir schätzen die Menschen, die offen ihre Meinung sagen – vorausgesetzt, sie meinen das Gleiche wie wir.“ Dann zitierte er auch noch Christian Friedrich Hebbel, der anmerkte: „Es gehört mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben.“ Das war der Punkt, der ihn zum Nachdenken anregte. Wie war das denn nun, wer hatte von dem Vorgang profitiert und wer waren die Opfer? Das gab den Ausschlag für sein Urteil.
Der Tenor seines Urteils lautete: „Alfred Lösch kannte niemanden, als er die Stadt zum ersten Mal betrat, auch nicht die verschwundenen Burschen. Die Profiteure waren eindeutig der Wirt und die unbekannten Zechbrüder. Einleuchtend war, Alfred Lösch war als einzigem der Beteiligten bekannt, dass er überhaupt kein Geld für die Zeche der anderen in der Tasche hatte. Warum hätte er sie dann alle einladen sollen? Wohingegen der Wirt, Paul Andres, durchaus wusste wie er die Situation einzuschätzen hatte. Da waren einmal der fremde, unbekannte Wanderbursche, dann die Rumtreiber und Tunichtgute. Es wäre seine Obliegenheit gewesen, zu beurteilen, wer die Bestellungen aufgegeben hatte.
Die Aussage unseres allseits geschätzten Postdirektors, Herrn Otto Krüger, der zufällig anwesend war und die Szene beobachten konnte, war eindeutig. Alfred Lösch hatte nur einen Humpen bestellt, getrunken und bezahlt. Diese Vorgänge sind auf der Polizeiwache protokolliert worden. Man hatte im beiderseitigen Einvernehmen die Angelegenheit gütlich beigelegt.
Das Nachkarten des Wirtes hat eindeutig den guten Ruf des unbescholtenen Bürgers unserer Gemeinde beschädigt. Ich verurteile deshalb Paul Andres zu 100 Reichsmark Strafe und zur Unterlassung weitere rufschädigender Äußerungen über Alfred Lösch, außerdem wird Alfred Lösch ein Schmerzensgeld in Höhe von 300 Reichsmark zulasten von Paul Andres zugesprochen. Die Sitzung ist geschlossen.“
6
Der Erste Weltkrieg
Am 28. Juli 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Viel Zeit war Alfred Lösch und seiner Frau Emma in ihrem jungen Glück nicht beschieden, denn nun musste er an die Front. Dort bekam er von Emma einen Brief, konnte ihn jedoch nicht gleich lesen. Nach der Postverteilung in den Schützengräben, da hatte er endlich Zeit und las den von seiner Frau sehnsüchtig erwarteten Brief in aller Ruhe durch. Endlich hatte er dafür Zeit gefunden. Sie schrieb ihm, dass er am 3. Januar 1915 Vater einer Tochter geworden sei und sie hätte sie Greta genannt. Die Geburt hätte sie, auch dank ihrer Mutter, gut überstanden, die ständige Sorge um ihn aber weniger.
Der junge Vater kämpfte zwar nicht direkt im Schützengraben, war indessen aber anderen Gefahren ausgesetzt, wenn er mit seinen Kollegen und mit den Pferdefuhrwerken, die ein- und ausgehende Post von der Bahn in die Verteilerstationen und zu den einzelnen Kompanien bringen musste. Da kam es öfters vor, dass ganze Postwagons zerschossen wurden. Der Feind machte eben keine Unterschiede zwischen Nachschub für die Front und begehrte Postsendungen. Anschließend musste er und andere Postler die Feldpostbriefe mühsam wieder einsammeln und überprüfen, ob sie noch zustellbar waren. Seine Vorgesetzten waren jedoch bemüht, die „gelernten Postler“ nicht erhöhten Gefahren auszusetzen, denn für diese Fachleute hatten sie keinen Ersatz und die Post- und Päckchen-Zustellung wäre sonst zusammengebrochen.
Mitte des Jahres 1916 holte Hindenburg zum großen Schlag gegen Russland aus, während Alfred Lösch zum Obergefreiten befördert worden war und zudem eine Woche Fronturlaub bekam. Danach sollte er an die russische Front abkommandiert werden, um dort beim Aufbau des Feldpostwesens mitzuwirken.
Emmas Herz machte einen gewaltigen Hüpfer, als sie seinen Brief in Händen hielt. Schnell bereitete sie alles für seine Ankunft vor. Doch die Enttäuschung war riesengroß, als der nächste Brief ankam. Doch eine kleine Hoffnung war ihnen geblieben, denn als Sammelstelle der Postler für den Russlandeinsatz, war die Stadt und der Bahnhof in Cottbus bestimmt worden. Dort wurde die neue Einheit zusammengestellt. Alfred Lösch schrieb seiner Frau: „Liebe Emma, komm bitte am 11. Juni 1916 nach Cottbus und bring Klein-Greta mit.“
Er wartete schon eine Stunde vor der Ankunft des Zuges aus Spremberg auf dem Bahnsteig. Endlich stand der Zug, die Lokomotive schnaufte in regelmäßigen Intervallen, zu den unendlich vielen Küssen, die ausgetauscht werden mussten. Emma hatte gleich Oma Bertha mitgebracht, die dann mit dem Kleinkind Greta am Nachmittag wieder nach Spremberg zurück dampften. Währenddessen genoss das junge Paar die traute Zweisamkeit einer einzigen Nacht, die ihnen blieb, denn am nächsten Morgen rollte der Transportzug in Richtung Osten.
Wochen später schrieb Emma ihrem Mann: „Du musst gut auf dich aufpassen, ich bin wieder schwanger geworden und hoffe, dass du diesen Wahnsinn überleben wirst.“ Alfred war durch diese Verlegung in relativ ruhigere Kriegsgebiete gekommen, denn nach den großen Schlachten bei Tannenberg geriet der Krieg im Osten immer mehr zum Stellungskrieg. Nachdem die Bolschewiki die Macht übernommen hatten, kapitulierte Russland und der Krieg war damit auch für ihn so gut wie beendet.
Als er 1918 endlich glücklich nachhause durfte, tobte in Deutschland die Influenza, auch die „Spanische Grippe“ genannt, mit geschätzt zwischen 20 und 50 Millionen Toten, alleine in Europa. Das Land lag darnieder und der Versailler Vertrag knebelte Deutschland unbarmherzig.
Seine Frau Emma hatte im Kriegswinter 1917 den Sohn Gerhard zur Welt gebracht. Der sah genauso aus wie die Kohlsuppe, die sie seit Monaten essen mussten. Infolge der Mangelernährung war bei Emma die Muttermilch versiegt. Der Arzt befürchtete schon, dass das Kind wohl nicht überleben würde.
Doch die gute Oma Bertha hatte vorgesorgt und eine trächtige Ziege von einem Bauern erworben. Das Tier gab genügend Milch, um den kleinen Gerhard, und auch noch ihr Zicklein, durchzubringen. Tagsüber lag der kleine Junge statt in seinem Kinderbett, in der Bratröhre des Küchenofens, streng bewacht von Mama Emma und Oma Bertha.
So fand der Vater seinen Sohn bei der Heimkehr vor. Er hatte sein Geburtsgewicht von 900 Gramm in einem dreiviertel Jahr gerade Mal verdoppelt. Jetzt war aber der Vater zu Hause, betreute den Gemüsegarten, pflanzte Obstbäume an und stahl auf den Spreewiesen und an den Feldrainen Gras und wohlschmeckende Kräuter für die beiden Ziegen. Hinzu kamen seine Erfolge bei der Kaninchenjagd. Dadurch verbesserte sich merklich die Situation und es reichte, die Familie mit den drei Kindern gut durchzubringen.
Die Arbeitsplätze bei der Post waren während des Krieges mit Frauen besetzt worden und sein Gönner, Otto Krüger, war inzwischen in Pension. Die große Arbeitslosigkeit zwang Alfred Lösch zuerst wieder in sein altes Metier zurück, der Kleintier-Wilddieberei. Der Anteil an jagdbarem Wild hatte sich kolossal vermehrt, und die paar verbliebenen alten Förster kamen kaum hinterher, es zu dezimieren. Deshalb drückten sie ein paar Augen zu und ließen die Wilddiebe gewähren. Die Bevölkerung brauchte in diesen Zeiten Nahrungsmittel, doch wo sollten sie herkommen? Viele Bauern waren gleich zusammen mit ihren Pferden eingezogen worden, und die wenigen Zurückkehrenden mussten die Landwirtschaft erst wieder mühsam und zeitraubend „anschmeißen“.
In vielen Bereichen der Wirtschaft, in der Verwaltung und im produzierenden Gewerbe, hatten die Frauen das Kommando übernommen und die räumten ihre Arbeitsplätze wegen der von den Fronten zurückflutenden Männer nicht freiwillig. Endlich produzierte man bei Michelsohn in der Schlesischen Straße auch wieder Kammgarn, statt Uniformtuche. Nachdem Emma seit ihrer Jungmädchenzeit schon dort angestellt gewesen war, nur durch die Schwangerschaften unterbrochen, arbeitete sie wieder dort. Zuerst versuchte Alfred Lösch wieder bei der Post unterzukommen, aber vergeblich. Dafür erreichte Emma, dass ihr Mann bei Michelsohn eine Anstellung als Pförtner und Nachtwächter fand, im Schichtdienst mit zwei anderen Männern.
Hier arbeitete er mit den anderen im Wechsel rund um die Uhr. Man mochte zu dieser Anstellung für einen kräftigen Mann in den besten Jahren stehen wie man wollte, doch für Alfred Lösch war das in dieser Zeit die ideale Position. Sie ließ ihm genügend Zeit für seine „Nebentätigkeiten“. Mehrmals brachte er lebende Kaninchen nachhause, die er in einem mit dünner Angelschnur geflochtenen Netz gefangen hatte. Die Tiere sperrte er dann in einen selbst gebauten „Karnickelstall“, wie die Spremberger zu sagen pflegten, wo sie sich zur Freude der kleinen Greta „wie die Kaninchen vermehrten“ und laufend Proteine lieferten, wenn man ihnen nur genügend Wasser, Gras und Küchenabfälle zu fressen gab. Mittlerweile hopsten die Karnickelkinder schon durch die Küche. Zum Leidwesen von Alfred gewöhnten sich aber die Kinder so an ihre Lieblinge, dass sie natürlich nie geschlachtet werden durften.
Dann zogen die bisher im Obergeschoss wohnenden Mieter aus, sie hatten eine größere Wohnung in den neu entstandenen Gebäuden der GeWoBa (Gemeinnütziger Wohnungsbau) gefunden. Durch den günstigen Umstand gab es mehr Platz im Haus und die Oma zog nun ins obere Stockwerk um. Ein Kellerraum wurde ebenfalls frei, in dem Alfred sich eine kleine Werkstatt einrichtete. Bald standen ein Fahrrad und ein Anhänger darin, nun konnte er nach Herzenslust in Feld und Wald herumgondeln, ausreichend Futter für die Tiere an den Wegrändern schneiden und genügend Holz für den Winter sammeln.
Bei seinen Rundgängen durch den Betrieb ging Alfred Lösch unregelmäßig mit seinem Schlüssel zu den Stechuhren und überprüfte nachts das Werksgelände, damit nichts gestohlen wurde. Wenn alles ruhig war, konnte er sich schon auch einmal eine Mütze voll Schlaf gönnen, bis der nächste Rundgang anstand. Seit die Gewerkschaften den 8-Stunden-Tag durchgesetzt hatten, wechselte er sich mit seinen beiden anderen Kollegen rund um die Uhr in diesem Rhythmus ab. Das rollierende System hatte den unschätzbaren Vorteil, dass er nur alle drei Wochen von abends zehn bis sechs Uhr morgens Dienst tun musste. Für ihn blieb jetzt noch etwas mehr Freiheit für seine Leidenschaft Natur, Wildtiere und die Familie.
Seine Aktivitäten beschränkten sich nicht nur auf das Kaninchen fangen. In der Stadt und im Umland bestand auch eine große Nachfrage nach Singvögeln, die man damals für die Vogelbauer-Haltung in den Haushalten noch nicht züchtete. Die Vogelfänger entnahmen sie einfach der Natur und verkauften den Fang auf den Wochenmärkten. Im Krieg waren diese Aktivitäten völlig eingeschlafen, doch nun steigerte sich die Nachfrage nach den singenden, schilpenden und flötenden Hausgenossen wieder deutlich.
Mit diesem Nebenjob hatte sich Alfred Lösch schon in seiner Heimat einen schönen kleinen Zusatzverdienst verschafft. Jetzt nahm er diese Tätigkeit wieder auf, dafür weilte er in seiner Laube, der Rauch aus dem Schornstein stieg himmelwärts, er saß neben dem Öfchen und rührte das Leinöl, bis es zum zähen Kleister eingedickt war. Das war eine nicht ganz einfache Arbeit, wie mancher vielleicht denken mag. Das Feuer musste über mehrere Stunden gut dosiert unterhalten werden. Am Anfang brannte es hell, man musste nicht viel rühren und aufpassen, aber je dicker die Masse wurde, desto schwerer fiel das Rühren, und wenn dann nach vielen Stunden der Leim soweit fertig war, dann glühte im Öfchen nur noch etwas rote Glut. Das war der Zeitpunkt, wo er die vorbereiteten Leimruten in die Masse tauchte und sie einzeln an einer Schnur aufhing und antrocknen ließ. Frühmorgens, wenn alle allgemein noch schliefen, zog er los. Die Ruten steckten mit den klebrigen Enden in mehreren aufgebohrten Bambusröhren, und damit ging er in den Wald, wo er schon lange vorher die Büsche mit den beliebtesten Singvögeln ausgespäht hatte.
Dort band er seine Leimruten mit dunkler Biese an Ästen und Sträuchern fest und ging ein Stückchen weiter zur nächsten Fangstelle. Manchmal setzte er auch einen Lockvogel in einem Käfig aus, der mit seinem Konzert seine Artgenossen anlockte. Stunden später kam er mit seinen selbstgebauten Vogelkäfigen zurück und sammelte die Vöglein, die ihm „auf den Leim gegangen waren“ ein, doch bevor er sie in die Käfige hineinsetzte, putzte er ihnen mit viel Hingabe und mit frischem Leinöl das Gefieder sauber.
An den Markttagen stand er dann mit seiner Stieftochter Hildegard und Tochter Greta an einem aufgestellten Dreibock aus langen Stangen, an denen die Vogelkäfige hingen und bot seine singende Ware feil. Töchterchen Greta hatte in der Schule das Flötenspiel gelernt und sie lockte nun, wie weiland der „Vogelhändler“ in der Mozart-Oper, die Käufer mit ihren Trillern an und Hildegard sang dazu: „Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig heissa, hopsassa.“
Inzwischen hatte er ja auch den Garten seiner Schwiegermutter übernommen und baute noch mehr Obst und Gemüse für die Selbstversorgung an. So ging für die Familie Lösch alles seinen bescheidenen und beschaulichen Gang und verbreitete ein gewisses Glück zwischen den Weltkriegen. Die Welt drehte sich derweil weiter, doch schon gab es unheilvolle dunkle Wolken, die sich drohend am Firmament abzeichneten.
7
Gerhard Lösch und seine Charakterzüge
Kaum war Gerhard vier Jahre alt, nahm Alfred ihn das erste Mal ins Gelände mit, doch der Junge interessierte sich nicht für die Natur, ihre Vielfalt und deren enormen Reichtum. Lieber stromerte er an den Bächen und im Gebüsch herum, scheuchte die brütenden Kiebitze auf und raubte ihnen die Eier, die er dann gleich auslutschte, oder er ärgerte fleißige Wildbienen, bis sie über ihn herfielen. Das Geschrei danach konnte man bis in die nahe Stadt hören. Am liebsten stocherte das Bürschchen in Teichen herum, fing Frösche, die er dann mit einem hohlen Rohrkolbenhalm aufpustete, bis die armen Tiere platzen. Da halfen weder gutes Zureden, noch Erklärungen, Belehrungen, nicht einmal Verbote, der Junge war schon mit fünf, sechs Jahren beratungsresistent und schwer erziehbar.
Mit zunehmendem Alter entwickelte er sich zum Egoisten mit den zwei Gesichtern. Er verstand es genial alle für sich einzunehmen, aber vor allem andere mit Ausführungs-Anweisungen vorzuschicken und sich selber geschickt in der Deckung zu halten. Vom eigennützigen Tun bemerkten seine Mitmenschen wenig, denn seine Argumente waren meistens so überzeugend, dass seine „Opfer“ dachten, er würde ihnen selbstlos etwas Gutes tun wollen. Das böse Erwachen kam erst später, nämlich dann, wenn sie mitbekamen, sie sind nur ausgenutzt worden. Wenn er dann merkte, dass er durchschaut war, ließ er die anderen gnadenlos fallen, weil es ihm intuitiv bewusst war, dass sie sich ein zweites Mal nicht mehr von ihm hereinlegen ließen.
Doch bei der objektiven Betrachtung dieses egoistischen Fehlverhaltens, musste man ihm zugestehen, dass viele, die sich auf ihn eingelassen hatten, am Ende auch von ihm profitierten. Selbst wenn sie keine kommerziellen Vorteile verbuchen konnten, so waren sie an Erfahrungen reicher geworden. Zumindest hatten sie sich weiterentwickelt und vielleicht gelernt, wie man im Geschäftsleben auch auf anständige Art und Weise zu Wohlstand und Ansehen gelangen kann. Einige waren in ihrer späteren Entwicklungsphase sogar durch ihn reich geworden, weil sie die teilweise unredlichen Machenschaften des Protagonisten und Verführers übernommen haben und in eigenes Bares umzumünzen verstanden. Da gab es auch Mitläufer, die mit und durch ihn sogar mit den Gesetzen in Konflikt gerieten, ins Gefängnis mussten, oder hohe Geldstrafen zu berappen hatten. Manchen dieser ausgebufften Typen half er wieder auf die Beine, nachdem sie aus dem Gefängnis entlassen worden waren.
Die Mehrheit trennte sich jedoch von dem Hasardeur und desavouierte ihn. Solche Verhaltensweise bestrafte er allerdings dann auf Lebenszeit, meist noch mit versteckten Angriffen auf ihre Integrität, ihre Reputation oder ihr Vermögen. Die Bitte um Verzeihung oder Eingeständnisse seiner Mitschuld, das war von ihm nicht zu erwarten, eher ein weiterer Versuch, den Delinquenten erneut für seine Zwecke einzuspannen. Manche ließen sich darauf ein und machten nochmals eine Bauchlandung.
Unterordnung gab es für ihn nur, wenn er merkte, dass ihm jemand intellektuell überlegen war. Dann biederte er sich an, dienerte und zeigte sich von seiner allerbesten Seite. Wenn jemand, der ihn kannte, als wenn er ihn selber geformt hätte, sein reziprokes Schauspiel beobachtete, seine Versuche sich anzudienen, wenn er redete, bis ihm der Speichel in den Mundwinkeln antrocknete, dem blieb nur, sich angewidert abzuwenden, bevor er sich übergeben musste. In seiner Heimat- und Industriestadt Spremberg fand Gerhard Lösch keine Arbeit, was nicht verwunderte, denn er hatte nichts gelernt und konnte keinen Beruf nachweisen. Wenn er auch nichts war und nichts konnte, dumm war er aber keineswegs, im Gegenteil, er schien das Glück gepachtet zu haben. Sein angeborener Instinkt sagte ihm: „Dann fange ich eben mal ganz klein an und such mir eine Lehrstelle.“ In einer Installationsfirma wurde er fündig. Dort konnte er zwar kein Geld verdienen, aber er hatte wenigstens ein Dach über dem Kopf und zu essen und zu trinken. Das Getränk bestand allerdings hauptsächlich aus Leitungswasser, oder wenn mal ein Kollege zu seinem Geburtstag eine Kiste Bier spendierte. Dazu gab es regelmäßig noch eine Flasche 40-prozentigen Korn, die von Hals zu Hals die Runde machte. „Jeder eine Daumenbreite am Flaschenrand“, das war das Maß, welches eingehalten werden musste, und die Kollegen schauten ganz genau hin, ob der Daumen während des Trinkens nicht „aus Versehen“ mal etwas verrutschte.
Die Arbeit war nicht schwer, doch er merkte schnell, dass das biedere Handwerk nicht sein Metier war. Es dauerte auch nicht lange, dann setzte ihn sein Meister im organisatorischen Bereich ein. Mit den Händen arbeiten war überhaupt nicht sein Ding, er arbeitete lieber mit seiner großen Schnauze. Die Gesellen waren genervt, beschwerten sich beim Chef und ließen ihn an keine Arbeiten mehr heran, weil er wie sie sagten: „das einmalige Talent besaß, andere für sich arbeiten zu lassen“, aber im Umgang mit Materialien und Werkzeugen ein Totalausfall war. Ja, sie verlangten, dass er verschwinden sollte. Damit hatte er in dieser Firma abgegessen und musste gehen.
Von seinem Vater, der ja die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges hinter sich hatte, hatte er gelernt, sich nie unterzuordnen, sondern sich immer an die Spitze des Geschehens zu stellen. Nur so kannst du die Übersicht behalten und die Dinge zu deinem Nutzen gestalten. Gibst du das Steuer aus der Hand, lieferst du dich anderen aus. Lasse nie zu, dass ein anderer aus deiner Gruppe die Führung übernimmt, du musst sie mit der Faust verteidigen, sonst wirst du sie nie zurückgewinnen. Setze sie zu deinem Nutzen ein, aber achte darauf, dass die anderen ihren Anteil am Erfolg erhalten, sonst werden sie dir nicht mehr folgen. Spreche immer sachlich und sanft mit deinen Leuten, schreie sie nur ausnahmsweise an, aber denke immer daran, dass deine Argumente überzeugend sein müssen. Diskutiere mit allen über alles, prüfe die Argumente der anderen und mache sie zu deinen eigenen, wenn sie gut sind. Wenn du deine Befehle erteilst, dann überlege genau wer was kann. Übertrage nie Aufträge, welche den Einzelnen überfordern. Zeige immer mit dem Finger auf denjenigen, dem du einen Auftrag erteilst, so vermeidest du Missverständnisse.
Das Fingerring-System
Erst einen Zeigefinger heben, dann dich furchtbar wichtig geben. Nun und dann mit viel Effekt, zeigen auf ein Schaff-Objekt.
Und nun kommt es darauf an, wer denn was am besten kann. Schaust die Opfer an und sagst, du machst dies und du machst das.
Ist dir dieses Ding geglückt, lehnst du dich entspannt zurück. Und lässt deine Muskeln schlaffen, denkst, lass doch die anderen schaffen.
Rei©Men
Das war so ungefähr das, was er am besten konnte und vor allem ein Leben lang anwendete. Aber hinter seiner biederen Fassade steckte noch eine weitere Gemeinheit seines Charakters. Wenn irgendetwas schiefging, waren immer die anderen daran schuld. Nie und nimmer, wie konnte das nur sein, erkannte er an, selber einen Fehler gemacht zu haben.
8
Die Gang
Im Stadtgebiet bildeten sich Gruppen von Halbwüchsigen, die angestachelt von Rivalitäten in den Stadtteilen, harte Kämpfe untereinander austrugen. Da gab es mitunter schon mal blutige Nasen. Die Gang von Gerhard Lösch in der Südstadt wurde als „Algerianer Messastecher“ bekannt, obwohl keiner von ihnen ein feststehendes Messer besaß. Wie dieser neue Stadtteil im Süden von Spremberg zu den Namen „Algerien“ kam, ist in Vergessenheit geraten. Die Jungs besaßen bestenfalls kleine Taschenmesser, mit dem üblichen angehängten Werkzeugvorrat, wie sie damals alle Burschen haben wollten. Sinn und Zweck dieser Rivalitäten war die Revierverteidigung, so eine Art Geheimpolizei die alle Vorgänge beobachtete und dem Gruppenchef meldete. Darüber hinaus durchstreiften stets mehrere Gruppenmitglieder die genau abgesteckten Reviergrenzen der anderen Gangs. Das hatte ihnen niemand befohlen, das war einfach so, musste wohl schon seit Urzeiten in den Genen schlummern und von Generation zu Generation weitergegeben worden sein.
Nach der Erdbeerernte waren die Süßkirschen in der Kirschallee reif, dann saßen die Mitglieder der Gang in den Bäumen und schlugen sich die Bäuche voll. Später kamen die Augustäpfel in den Schrebergärten dran, oder man angelte mit schnell geschnittenen Ruten, mitgebrachten Angelschnüren und Haken, eine Zusatzmahlzeit aus den Bächen, die der Spree zuflossen.
Im Winter wurden ausgedehnte Schlittschuhausflüge auf den zugefrorenen Spreewiesen unternommen. Der Ideenreichtum an Unfug war ebenfalls beachtlich. Da alle Badeanstalten an der Spree lagen, ließen die Burschen in der Heuernte große Heuinseln die Spree herunterschwimmen, die den Badegästen dann überall am Körper hängen blieben. Waren sie bei Operationen in „gegnerischen Revieren“ unterwegs, wurden die Gesichter mit Spreeschlamm unkenntlich gemacht.
Einmal jedoch ab es richtigen Ärger. Die Truppe hatte am nördlichen Spree-Zusammenfluss, der sogenannten „Liebesinsel“, einem sich liebenden Pärchen sämtliche Kleider gestohlen. Sie hatten nur noch ein mitgebrachtes Badetuch, auf dem sie drauflagen, und das war wohl für beide zu klein, um ihre Blößen zu bedecken. Die Geschichte wurde zum Stadtgespräch und sogar in der Lausitzer Rundschau ausgiebig diskutiert. Die Sache an sich wäre ja eigentlich nur eine Lachnummer gewesen, doch die bösen Buben hatten vom „Tatort“ beginnend, bis in die Innenstadt und zum Marktplatz hin, die Wäsche der Opfer aufgehängt und das Ganze so platziert, dass das Liebespaar zuerst ihre Unterwäsche und zuletzt am Markt ihre Oberbekleidung wiederfanden. Das rief natürlich die Polizei auf den Plan, die ein Ermittlungsverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses anstrengte, was jedoch „im Sande“ verlief, weil die Bösewichte nicht ermittelt werden konnten. Das Gelächter darüber war umso größer, weil die ganze Stadt mitlachte.
Ein anderes Mal wurde bei einem unbeliebten Lehrer das Fahrrad in alle Einzelteile zerlegt. Als er losfahren wollte, stand nur noch der nackte Rahmen vor der Haustür. Alle anderen Einzelteile wurden ihm Schraube für Schraube nach und nach mit der Post zugestellt. Den Sattel fand der Hausmeister der Schule auf seiner Werkbank, andere größere Teile wie die Felgen, der Lenker, Schutzbleche und Gepäckträger, fanden sich in der Stadtkirche hinter dem Altar und auf der Kanzel wieder. In der Stadt war die Geschichte nun hinlänglich bekannt geworden. Die Bevölkerung machte sich einen Spaß daraus, dem unliebsamen Lehrer, den sie wohl alle „auf dem Kieker hatten“ – weil sie ihn von ihrer eigenen Schulzeit her kannten – nun alle möglichen und unmöglichen Fahrradteile, auch Kinderwagenteile und vieles mehr, was man loswerden wollte, zustellen, die überhaupt nichts mit seinem Fahrrad zu tun hatten. Der Mann wehrte sich mit Händen und Füßen, doch es half alles nichts, da musste er durch.
Dann erbarmte sich am Ende doch der „Fahrrad-Fritze“ Feiertag und schraubte ihm sein Rad wieder zusammen. Zuletzt fehlten immer noch die Reifen mit den Schläuchen, doch die schwammen eines Tages die Spree runter, mitten durch die beiden Badanstalten, oberhalb vom Weißen Wehr, wo sie von den Badegästen herausgefischt wurden.
9
Die Eltern von Horst Reiner Menzel
Für Hildegard brach die Zeit an, wo sie mit ihren Freundinnen zum Tanzen ging und auch Freunde fand, aber bisher ergab sich noch nichts Ernstes. Dann lernte sie den Tischler Paul Menzel kennen und sie heirateten. Anfangs dachten sie nicht an Kinder, dafür arbeiteten beide hart und sparten für ein Häuschen am Stadtrand, was sie dann verwirklichen konnten. Kurz vor dem Ausbruch des Krieges wurde Horst Reiner geboren, doch das gemeinsame Glück war nur von kurzer Dauer. Schon 1939 musste der Vater Paul in den Krieg ziehen. Als er 1946 endlich von der Krim wieder nachhause kam, brachte er nur noch 46 Kilogramm auf die Waage, und sein Häuschen hatte durch den Russensturm auf Spremberg schwer gelitten. Doch wie schreibt unser großer Dichterfürst Friedrich Schiller:
Einen Blick, nach dem Grabe, seiner Habe Sendet noch der Mensch zurück – Greift fröhlich dann zum Wanderstabe, Was Feuers Wut ihm auch geraubt, Ein süßer Trost ist ihm geblieben, Er zählt die Häupter seiner Lieben, Und sieh! ihm fehlt kein teures Haupt.