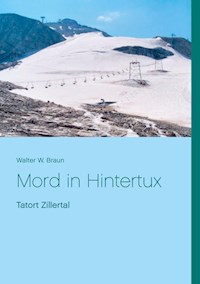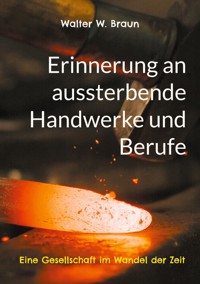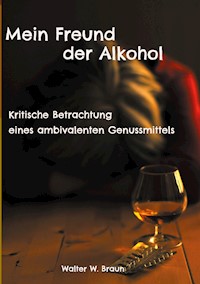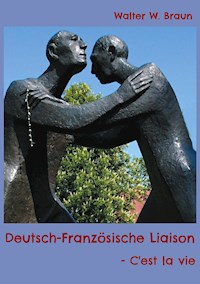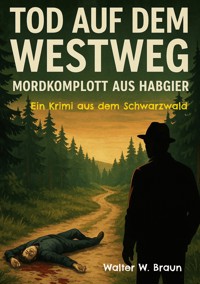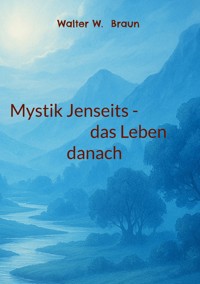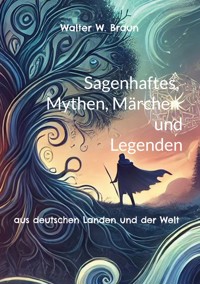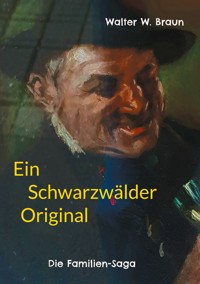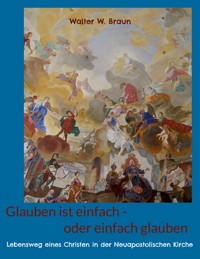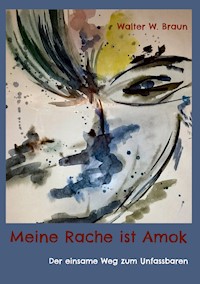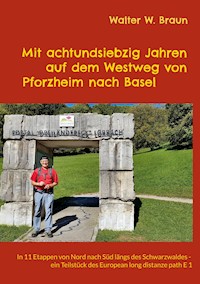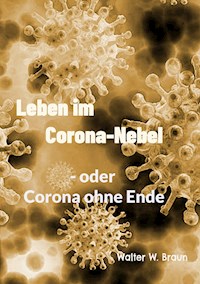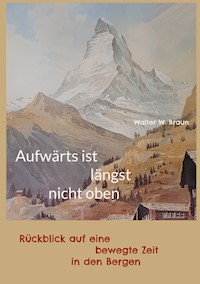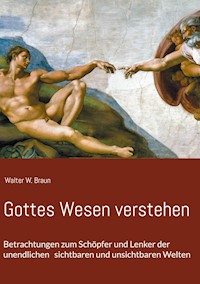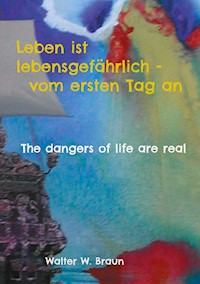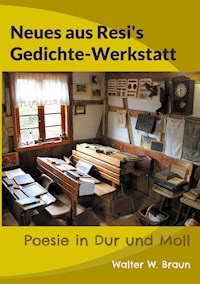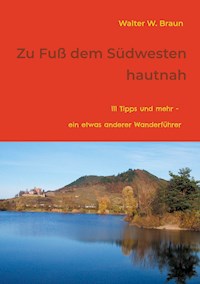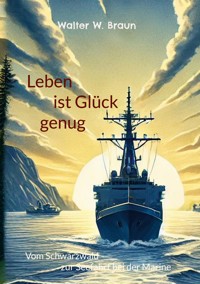
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Biografie über ein spannendes Leben ist nicht nur zeitgeschichtlich interessant. Es führt auch in eine Epoche, die noch nicht allzu fern zurückliegt, sich aber noch in einer völlig anderen Welt zutrug. Beide Großeltern waren alteingesessene Schwarzwälder. Der Autor, Ende 1944 im damals deutsch verwalteten Elsass geboren, war als Kleinkind ein Türöffner für Mutter und Verwandtschaft, die nur dank ihm in die neutrale Schweiz einreisen durften, um nach der Internierung von dort in die ursprüngliche Heimat der Großeltern ins Kleine Wiesental und damit in Sicherheit zu kommen. Dass wegen des Geburtsortes im Elsass später Probleme bei der Staatsbürgerschaft entstehen würde, war weder abzusehen noch erwartet. Die bewegte Kindheit wurde von der Notwendigkeit geprägt, schon als Kind beizutragen, etwas zu verdienen, um Kleidung oder den Schulbedarf kaufen und sich kleine Freuden leisten zu können, ohne die Eltern damit zu belasten. Kaum als Jugendlicher selbständig, rief die Bundeswehr zum Wehrdienst bei der Marine. Nach einem unglaublich brutalen militärischen Drill folgte die Ausbildung zum Sanitäter. Nach den bestandenen Prüfungen wurde das Trossschiff Dithmarschen das Tätigkeitsgebiet. Nun kam die spannendste Zeit auf See. Der Schwarzwälder war Seemann und durfte Gebiete und Häfen im Ausland sehen, die für den Normalbürger damals noch unerreichbare Ziele waren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1Im Elsass
Hanni, ein junges Mädchen
Wilhelm wird schwer verwundet
Walter wird geboren
Rudolf Binoth im Arrest
Hanni und Wilhelm heiraten
2Eine junge Mutter muss sich behaupten
Große Gefahr für den kleinen Walter
Mein Bruder wird verletzt
Umzug ins Dorf
Entwicklung in Bürchau.
Die Schulzeit
Erneuter Schicksalsschlag für den Vater
Schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen
Erneuter Umzug
Verdienstmöglichkeiten
Ein Schulwechsel steht an
Freuden in der spärlichen Freizeit
Weihnachten ist mehr als nur ein Fest
Kur in Friedenweiler
Ende der Schulzeit
3Lehrjahre sind keine Herrenjahre
Probleme mit dem Vater
Abends in Haslach
4Auf eigenen Füßen
Die erste eigene Wohnung
Das Kinzigtal ein Urlaubsparadies
Wehrdienst bei der Marine
Ausbildung zum Sanitäter
Fachlehrgang in Wilhelmshaven und Bad Zwischenahn
Neues Kommando
In Wilhelmshaven zu Hause
Prolog
„Alles Lebendige zeichnet sich durch eine zielgerichtete, formende Lebenskraft (vis vitalis) aus“, lehrt uns der Idealismus.
„Unser Leben währet siebzig Jahre und wenn’s hochkommt, so sind’s achtzig Jahre und was daran köstlich erscheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon“. Psalm 90,10. (Luther-Bibel 1912)
Ist das Leben Schicksal und der Weg vorgegeben? Ist es die führende Hand Gottes, die uns von Anfang an begleitet und unser Leben lenkt? Was ist uns von den Vorfahren, vom Vater, der Mutter und deren Ahnen in den Genen vererbt oder wurde vielleicht noch von anderer Seite hineingespuckt? Welche prägenden Veränderungen nehmen wir aus den Begegnungen mit Mitmenschen, die unsere Wege kreuzen, in formenden Ereignisse und Zufälligkeiten, die wie ein Blitz treffen, der aus heiterem Himmel einschlägt?
Viele dieser Fragen müssen unbeantwortet bleiben oder finden allein im Glauben eine Antwort, wie die Frage auch: Welche Farbe hat der Traum, rosarot oder blau, die Farbe der Hoffnung?
Blicke ich auf meine Lebensgeschichte zurück, so erkenne ich, es wurde mir weder etwas geschenkt, noch ist mir das Glück einfach so in die Wiege gelegt worden, auch wenn ich als Sonntagskind auf die Welt kam. Es war kein Weg vorgezeichnet, aber es fanden sich viele markante Punkte – ich bezeichne sie vielmehr als Wegkreuzungen – an denen gewollt oder ungewollt entscheidende Weichenstellungen erfolgt sind. Nicht alles war von mir so geplant oder gewünscht, aber im Rückblick betrachtet ist es in Ordnung, konnte von mir angenommen werden und ist gut. Mit über achtzig Lebensjahren darf ich mich als sehr zufrieden bezeichnen und Glück bin ich noch sehr fit und leistungsfähig, körperlich und geistig; was wollte ich mehr? „C’est la vie“, sagen die Franzosen: „So ist das Leben“.
1
Im Elsass
Es war ein verlockendes Angebot, das das Hitlerregime um das Jahr 1939 den Bauernsöhnen im süddeutschen Raum unterbreitete. Viele von ihnen hatten keine Aussicht auf das Erbe des elterlichen Hofs. Während in der Thronfolge meist der älteste Sohn den Anspruch auf das Erbe hatte, verhielt es sich bei den Schwarzwaldhöfen genau umgekehrt. In der Regel erbte der jüngste Sohn den Hof. Die übrigen Kinder konnten – sofern möglich – als Knechte oder Mägde auf dem Hof bleiben oder mussten den heimatlichen Hof verlassen und andernorts ihr Auskommen suchen. Dieses Prinzip sicherte nicht nur den Erhalt von Haus und Grund in einer Hand, sondern gewährleistete die Altersversorgung der Altbauern über eine möglichst lange Zeit. Die älteren Geschwister mussten sehen, wo sie bleiben. Viele suchten im Südschwarzwald oder in der aufkommenden Textilindustrie im Wiesental und im Elztal Arbeit oder fanden sie in der aufstrebenden Uhrenindustrie rund um Villingen und Furtwangen. Andere zogen hausierend durchs Land und tausende wagten den Sprung nach Amerika; sie sind ausgewandert.
Die Nazis boten die Möglichkeit einen verlassenen Hof im Elsass zu übernehmen und zu bewirtschaften. Das Elsass war wieder in deutscher Hand. Viele ehemalige Hofbesitzer hatten, angesichts der politischen Verhältnisse, die Region verlassen und waren in den Süden oder ins französische Hinterland ausgewichen. Sie wollten nicht zur Wehrmacht verpflichtet werden. Andere, insbesondere die Juden oder als unerwünscht geltende Personen, wurden verhaftet, enteignet und in Konzentrationslager deportiert. Ihre Höfe lagen verwaist da.
Mein Großvater, Rudolf Binoth, nahm auch dieses attraktive Angebot an. Angesichts der einmaligen Chance löste er alles in der alten Heimat im Kleinen Wiesental 1) auf und zog mit der Familie – seiner Frau Amalie, zwei Söhne und drei Töchter – über den Rhein nach Häsingen (französisch: Hésingue) in den elsässischen Sundgau. Das idyllische Dorf liegt nur einen Steinwurf von der Schweizer Grenze entfernt, eingebettet in einer sanft hügeligen und fruchtbaren Landschaft. Seine Wurzeln hatte Rudolf auf dem mächtigen Binoth-Hof in der Holl, den sein Bruder Max erbte und gemeinsam mit seiner Schwester Frida zeitlebens bewirtschafteten. Beide blieben ledig und auf dem Hof, bis Frida verstarb und Max zehn Jahre später ebenfalls das Zeitliche segnete. Nach dem Binoth-Hof wurde für Rudolfs Familie Bürchau erst einmal die Heimat - ein kleines Dorf im hinteren Kleinen Wiesental, rund 20 Kilometer von Schopfheim entfernt, am Fuße des mächtigen Belchen, der als schönster Berg des Schwarzwaldes gilt – zumindest laut der touristischen Werbung.
Das neue Domizil in Häsigen war also nicht weit von der ursprünglichen Heimat entfernt – nur ein Sprung über den Rhein. Durch verwandtschaftliche Bande blieb die Verbindung zur alten Heimat weiter bestehen. Zudem bewegte man sich im alemannischen Sprachraum, was die Eingewöhnung erleichterte, man sprach und verstand die gleiche Sprache.
Für meinen Großvater Binoth glich das einem Lottogewinn. Ohne zu zögern, ist er mit seiner Familie und all seinem Hab und Gut ins Elsass gegangen. Warum lange überlegen?, der Sundgau, im südlichen Bereich des Départements Haut-Rhin gelegen, ist klimatisch äußerst begünstigt. Dies verdankt er einerseits an der warmen Luft, die vom Mittelmeer durch das Rhonetal und durch die Burgundische Pforte ins Rheintal strömt, und andererseits dem Schutz der Vogesen mit dem Ballon d'Alsace und dem Grand Ballon. Nicht weit entfernt fließt der europäische Strom, der Rhein, erhebt sich der Kaiserstuhl, und die Metropolen Freiburg und Basel sind ebenfalls nicht weit entfernt. Man kann mit Recht von einer gesegneten Gegend sprechen.
Die Elsässer 2) fühlten sich mehr als ein Spielball in der Hand höherer Mächte. Zuerst waren sie Franzosen, nach 1871 Deutsche, dann, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg 1918 wurden sie wieder Franzosen und von 1940 bis 1945 erneut deutsch. Die Pässe wechselten zwar, die Volkszugehörigkeit nicht. „Wir sind weder Franzosen noch Deutsche, wir sind Elsässer!“, so ihre selbstbewusste Ansage.
Nach der Hofübernahme war viel schwere Arbeit und Einsatz nötig. Die lange brach gelegenen Felder und Wiesen mussten auf Vordermann gebracht werden und für einen auskömmlichen Ertrag bestellt. Nebenbei hatten sich die Binoths schnell in die dörfliche Gemeinschaft eingelebt und waren gut integriert. Dies wunderte nicht, denn in der Bevölkerung sprach man Deutsch, oder mehr Schwyzertüütsch, und die Neubürger waren umgängliche Leute. Die Bewohner im Dreiländer-Dreieck sind Alemannen, wie sie im Vorarlberg, der nördlichen Schweiz, im Südwesten Deutschlands und im Elsass angesiedelt sind. Wie es in einem überschaubaren Gemeinwesen guter Brauch ist, half man sich in der Bevölkerung immer schon so gut es ging aus, wenn Not am Mann war. Viele Männer wurden als Elsässer während des Krieges beim Militärdienst in die deutsche Wehrmacht gezwungen, dadurch waren im Ort nur wenige alte und wehrunfähige Männer zurückgeblieben. Auch Opa Binoth ist der Militärdienst erspart geblieben, er war durch die Folgen einer Verwundung im Ersten Weltkrieg wehruntauglich und man konnte ihn nicht mehr einziehen. Gerne und bereitwillig hat er den Bäuerinnen im Dorf bei der Feldarbeit geholfen und oft deren Felder zuerst bestellt, noch vor seinen eigenen, was seine Frau Amalie nicht immer erfreut und gutgeheißen hat. Das rettete ihm aber möglicherweise später das Leben, wie noch zu lesen sein wird.
Häsingen – heute Hésingue – im Sundgau, südliches Elsass
Hier wohnten die Binoths rund 5 Jahre
Hanni, ein junges Mädchen
Johanna, von allen nur „Hanni“ genannt, war eines der fünf Kinder der Familie Binoth. Sie war ein bescheidenes, fleißiges und außergewöhnlich begabtes Mädchen. Doch ihre Hochbegabung fand im Elternhaus kaum Beachtung. Mehrfach wurden ihr Förderung und sogar ein Stipendium geboten, doch ihre Familie lehnte ab – jede helfende Hand wurde auf dem Hof und auf den Feldern gebraucht. Trotz der vielen Arbeit in Haus, Stall und auf den Äckern fand Hanni Trost und Freude in ihrer Lieblingsbeschäftigung: dem Lesen. Besonders verehrte sie den Heimatschriftsteller Johann Peter Hebel 3). Der aus Basel stammende berühmte Dichter und Schriftsteller lebte zeitweise in Hausen im Wiesental – nicht weit von ihrem Heimatdorf entfernt. Sie liebte seine Gedichte und Geschichten in alemannischer Mundart, unter anderem: „Der Mann im Mond“. Noch im hohen Alter konnte sie dieses und andere Werke in der alemannischen Mundart rezitieren.
Wie viele andere deutschen Mädchen war Hanni im BDM (Bund Deutscher Mädel) 4). Diese Organisation vermittelte jungen Frauen eine hauswirtschaftlich Ausbildung und bereitete sie auf ihre vermeintliche wichtigste Aufgabe vor: Haushalt, Herd du Familie. Dem damaligen Zeitgeist entsprechend war das essenziell und ein Muss für die deutsche Frau. In einer Schule im Odenwald absolvierte Hanni eine solide zweijährige hauswirtschaftliche Ausbildung, sie sie zur perfekten Hausfrau nach dem Idealbild der damaligen Zeit machte. Dort lernte sie nicht nur kochen, sondern auch den kreativen Umgang mit heimischen Kräutern und Pflanzen; alles, was die heimischen Wiesen und Gärten hergaben. Diese dienten sowohl zur Verfeinerung von Speisen als auch zur Behandlung von Krankheiten und Beschwerden. Sie wusste, wie man mit einfachen Mitteln nahrhafte Mahlzeiten zubereitete. Besonders oft kamen bei ihr Mehlsuppe und Kartoffelgerichte auf den Tisch – ob als Bratkartoffeln nach Schweizer Rösti-Art („Brägeli“, wie wir es nannten) oder in anderen Variationen. Die „Brägili“ mit Schmalz geröstet schmeckten wie vom Sternekoch. Durch ihre Ausbildung verstand sie es, mit wenig Geld schmackhafte und sättigende Speisen für die Familie zuzubereiten. Sie machte Spinat aus jungen Brennnesseln, zauberte Salate aus Sauerampfer und Löwenzahn und bereicherte damit den Speiseplan.
Hanni als junge Frau
In den 1940er Jahren befand sich die deutsche Wehrmacht in Frankreich in Siegeslaune. Die Soldaten ließen es sich in der Etappe gut gehen und lebten sprichwörtlich wie „Gott in Frankreich“. Einer von ihnen war der 1912 in Nordrach geborene Wilhelm. Das langgezogene, enge Dorf ist in einem Seitental der Kinzig im Mittleren Schwarzwald mit etwa 2000 Einwohnern.
Mangels beruflicher Perspektive hatte Wilhelm sich frühzeitig zum Arbeitsdienst gemeldet und war anschließend zur Wehrmacht gegangen. 1943 kämpfte er mit der 13. Armee im Kaukasus und am „Kuban-Brückenkopf“, später in Sewastopol auf der Krim am Schwarzen Meer. Er galt als mutig und draufgängerischer, was ihm mehrere militärische Auszeichnungen einbrachte, darunter das Eiserne Kreuz 2. und später 1. Klasse. Solche Ehrungen wurden in der Heimat hoch angesehen. Zeitungen berichteten über die „Heldentaten“ der Soldaten, und zu Hause wurden sie entsprechend gefeiert. Wilhelm war nicht nur erfahren, sondern wusste auch, wie er auf Frauen wirkte – insbesondere auf junge Mädchen. Anfang 1944 lernte er Hanni kennen und gewann rasch ihr Herz.
„Ich war, was Männer anging, völlig unerfahren und kannte nur meine Brüder. Wilhelm hat mir einfach gefallen“, erzählte sie später ihren Kindern. In dieser ungewissen Zeit verschwendete man keine Gedanken an eine lange Kennenlernphase – wer wusste schon, was der nächste Tag bringen würden? Zwischen Wilhelm und der 19-jährigen Hanni entwickelte sich eine Beziehung – mit unmittelbarer Konsequenzen. „Das erste Zusammensein hatte gleich Folgen“, erzählte sie später. Sie war schwanger. Für das junge Paar stand fest: „Wir waren uns einig und wollten noch vor dem Herbst heiraten.“ Doch das Schicksal hatte andere Pläne – und stellte die Zukunft vor eine harte Prüfung.
Wilhelm wird schwer verwundet
Wir haben in der Kinderzeit und auch danach nie genau erfahren, was im Sommer 1944 wirklich passiert ist. Der Vater wusste es vermutlich selbst nicht oder nicht mehr. Die offizielle Version war: „Ein Panzerspähwagen hat ihn überfahren.“ Danach lag er mit schwersten Verletzungen 6 Wochen im Koma, und die Folgen der erlittenen Kopfverletzungen behinderten ihn zeitlebens und ließen ihn leiden.
Nicht ausgeschlossen ist, so vernahmen wir es später bei Recherchen unter der Hand, dass er auf dem Nachhauseweg zu seiner Einheit war und ihn unterwegs bewusst oder unglücklich – beides konnte man nicht ausschließen – ein Auto erfasst hatte. Das ab-sichtlich herbeigeführte Unglück konnte man deshalb nicht aus-schließen, weil das häufig vorkam. Die Wiederstandbewegung Résistance 5) war allgegenwärtig und hat in vielfacher Weise die Wehrmacht bekämpft. Da der schuldige Fahrer nicht ermitteln konnte, versuchte man möglicherweise auch einen privaten Unfall als Verletzung im Militärdienst darzustellen, damit zumindest die finanzielle Versorgung gesichert war. Wie gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass der Vater wegen der Schwere seiner Verletzungen selbst nicht wusste, was wirklich geschehen ist. Wie es auch gewesen sein mag, eine finanzielle Entschädigung oder Rente bekam er nach dem Krieg in dieser Sache nie, nicht einmal eine Anerkennung, obwohl ein Rechtsanwalt jahrelang für ihn darum vor Gericht gestritten hat. Warum das letztlich erfolglos blieb, hatte zumindest teilweise einen anderen Grund, und das war nicht nur eine verzwickte Geschichte, das war besonders tragisch. Da war jedenfalls einiges ganz schön schiefgelaufen.
Wilhelm in Militäruniform
Walter wird geboren
Nach dem D-Day 6) am 6. Juni 1944 war es für die deutschen Soldaten in Frankreich aus mit dem Leben in Saus und Braus oder „Dolce Vita“, das süße Leben. Das Blatt hatte sich im Zweiten Weltkriegs für Hitler und seine Schergen diametral gewendet, die Wehrmacht erlitt täglich hohe Verluste. Die Alliierten waren im Vormarsch und drängten vehement die noch nicht aufgeriebenen und vernichteten Armeen im Osten über den Rhein zurück. Mit dem Herbst 1944 kam damit im Süden von Deutschland, und da war das Elsass zuvorderst betroffen, viel Leid über das Land. In der gleichen Zeit sah Hanni dem Tag der Geburt ihres Kindes entgegen. Währenddessen rückten die Franzosen schon massiv vom Westen her über die Vogesen und durch die Burgundische Pforte an. Sie kamen dem Sundgau immer näher, und schon bald kursierten allerorts schaurigste Gerüchte und Geschichten, über die von französischen Soldaten verübten, schlimmsten Gräueltaten unter der Zivilbevölkerung. Vor allem die militärische Vorhut, die Nordafrikaner, waren gleichermaßen gefürchtet, wie verhasst. Angeblich vergewaltigen sie alle Frauen, denen sie habhaft werden konnten, sie stahlen und nahmen ihnen alle Wertgegenstände ab, die sie wegtragen konnten. Wenn eine Person den Ring nicht vom Finger bekam, schnitten sie ohne viel Federlesens einfach den Finger ab. Währenddessen war Wilhelm, der Vater ihres Kindes, mehr tot als lebendig und benötigte noch viele Monate oder eigentlich zwei Jahre Pflege und Rehabilitation, erst im Lazarett und dann in der Psychiatrie. Er konnte in der schweren Zeit der jungen Mutter keine Hilfe sein. Die junge Frau – oder eigentlich war sie ja noch eine Jugendliche – war noch keine zwanzig, unverheiratet und bekam in diesen schweren Zeiten ein Kind. Das war keine schöne Situation, während die Zukunft völlig im Dunkeln lag und ungewiss war.
Die Schwangerschaft ist dafür ohne Komplikationen verlaufen, und der Tag der Geburt kam, wie sie später berichtet hat: „sogar vierzehn Tage früher als erwartet“, und das war ein Glück. An einem nasskalten, nebligen Sonntag erblickte ich am 5. November das Licht der Welt. War die etwas verfrühte Geburt ein gnädiges Schicksal oder Gottes Hilfe? Vielleicht beides. Schon am 7. November konnte mich Großvater Binoth in der Mairie, dem örtlichen Bürgermeisteramt, registrieren lassen. Damals konnte aber niemand ahnen, welche Verwicklung oder negativen Folgen der Geburtsort für mich noch haben sollte. Dieses Problem bekam ich erst Jahre später zu spüren, nachdem das Elsass, und damit auch mein Geburtsort, längst wieder ein ungeliebter Teil, ein Département Frankreichs, geworden war. Mein Geburtsort war in einem französischen Ort, und damit war ich nach französischem Recht ein französischer Staatsbürger. Dass das Dorf zum Zeitpunkt der Geburt unter deutscher Verwaltung stand, das spielte später keine Rolle mehr. Wenn ich eine Geburtsurkunde haben wollte, und das war aus vielfältigen Gründen immer wieder einmal notwendig und zuletzt sogar für die Bundeswehr, musste ich das in schriftlich bei der Mairie in Hésingue anfordern und einen „Internationalen Antwortschein“ 7) über 6 Mark beilegen – das gabs schon damals und heute auch noch, den aber nur wenige noch kennen. Damit wurden die Kosten für das angeforderte Dokument verrechnet, und man konnte das im Postamt kaufen.
Auf den ersten Blick gesehen hatte es das Schicksal noch gnädig mit uns gemeint, doch die Ereignisse überschlugen sich in diesen Tagen. Das französische Militär rückte stündlich näher und sie nahmen schon das halbe Dorf ein. Der Großmutter Amalie, den Tanten Olga, Mathilde und meine Mutter mit mir als Säugling, gelang noch rechtzeitig die Flucht. Sie waren zur nur wenige Kilometer entfernten Staatsgrenze zur Schweiz geeilt und konnten sie unbehelligt überschreiten. Nur wenige Minuten später wurde die einzige Brücke in diesem Bereich zur Grenze gesprengt, somit war auch dieser Fluchtweg fortan passé. Wer kann heute verstehen und begreifen, dass damals eine deutsche Familie in der neutralen Schweiz nicht willkommen war. Die Schweizer ließen an sich keine Flüchtlinge mehr ins Land. Die Grenzer wiesen alle zurück oder, wenn es Juden waren, übergab man sie gnadenlos den deutschen Behörden. Da waren sie unerbittlich und verschlimmerten das unsägliche Leid und Elend unter den jüdischen Emigranten. Die Binoths wurden nach bangen Stunden und Erniedrigungen nur wegen des Säuglings aufgenommen, der etwas schwächlich oder halbtot schien. So durften sie vorerst bleiben, wurden aber sechs Wochen interniert. Die Großmutter und die sie begleitenden Familienangehörigen wollten nur den Transit über das nahe Riehen bei Lörrach, und sie hatten nicht erwogen schwimmend oder im Boot den Rhein zu passieren. Vielleicht war dieser Abschnitt der Grenze auch dicht und zu gut bewacht. Möglicherweise hatte man nicht einmal mit Problemen durch die Schweizer gerechnet?
Wie es auch war, es war eine traumatische Zeit, wie ich später oft zu hören bekam. Die Schweizer sind bei allen diesen Berichten nicht gut weggekommen. Erst nach sechs Wochen der Internierung hat man sie weiterziehen lassen, wurde es ihnen erlaubt, auf die deutsche Seite zu wechseln, und weiter ins Kleine Wiesental zu gehen. Von Basel über Lörrach war es nicht weit nach Schopfheim und von dort noch etwa 14 Kilometer bis Bürchau.
Nach langer Zeit zurück in der ursprünglichen Heimat, kamen sie mit nichts an, wenn man von mir, dem Kleinkind, absehen wollte, und dem wenigen, was sie am Leibe oder in Taschen hatten tragen können. Das war aber zunächst die geringere Sorge. Wichtiger war, die Frauen befanden sich unbeschadet in Sicherheit, sie waren wieder da, wo sie vor über fünf Jahren hoffnungsvoll ausgezogen sind; zurück in den heimatlichen Gefilden. Im Gegensatz zu denen aus den Ostgebieten oder der Mitte Deutschlands, wurden die aus dem Elsass hatten fliehen müssen oder später in Nacht und Nebel über die Grenzen abgeschoben wurden, nie als Flüchtlinge anerkannt. Auch da blieb jahrelanges gerichtliche Bemühen vergeblich. Meine Mutter und ich wurden bei Tante Frieda und Onkel Max – den Geschwistern vom Opa – im Binoth-Hof in der Holl aufgenommen und fanden eine sichere Bleibe, und die anderen kamen bei den Olga und Alber Roser unter. Die älteste Schwester Olga hatte während des Krieges den Bürchauer Albert Roser geheiratet. Ihm gehörte das Elternhaus, auch ein über 300 Jahre alter stattlicher Schwarzwälder Bauernhof. Noch war Albert im Krieg, aber das große Haus bot vorerst ausreichend Platz für alle, und es sollte – mit Unterbrechungen – über eine lange Zeit auch das neue Domizil der Großeltern Binoth werden.
Rudolf Binoth im Arrest
Während die Frauen sich in Sicherheit befanden, wenn auch als Arrestierte in der Schweiz, konnte Rudolf Binoth nicht einfach den Hof verlassen und alles zurücklassen. Kühe im Stall, Schweine sowie Kleintiere wie Hühner und Hasen in den Boxen mussten versorgt werden. Zudem war der Hof seine neue Heimat – das Ergebnis von fünf mühsam aufgebauten Jahren Existenz. Später klagte er mit Wehmut in der Stimme:
„Nachdem die Felder, Wiesen und der Hof endlich so weit waren, dass sie ausreichend Ertrag abwarfen, mussten wir wieder gehen. Man hat uns einfach rausgeschmissen, enteignet und heimatlos gemacht.“
Einer Schuld war er sich nicht bewusst. Weder war er ein Nazi noch diente er im Militär – wegen seiner Verwundungen im Ersten Weltkrieg war er ohnehin nicht mehr einsetzbar. So hoffte er, dass die Plünderungen und all das Schlimme, das der Einzug des feindlichen Militärs mit sich brachte, ohne allzu negative Folgen vorübergehen würden und man später wieder in Frieden im Dorf leben könnte. Das Schicksal nahm jedoch eine andere Wendung: Das Militär entdeckte bei seinem 15-jährigen Sohn Manfred, der bei ihm geblieben war, einige Patronen in der Hosentasche. Wie sollte es in Kriegszeiten bei einem Burschen seines Alters anders sein? Dies reichte dem Feind als Vorwand, den Vater zu verhaften und vorerst im Rathaus (Mairie) in Arrest zu nehmen. Das Urteil schien bereits besiegelt, denn in jenen Tagen galt ein Leben wenig. Letztlich aber retteten ihn die Frauen des Dorfes – Menschen, denen der Großvater über Jahre hinweg so hilfreich gewesen war. Sie gingen für ihn „auf die Barrikaden“, konnten sich in Französisch verständigen und es gab selbst auf Seiten des Gegners noch anständige Menschen mit Herz. Dank ihres Einsatzes wurde Rudolf Binoth wieder freigelassen. Wie genau er das Elsass verlassen musste – ob sie ihn vielleicht über den Rhein oder gar in die Schweiz abschoben – wird heute nicht mehr geklärt, doch irgendwann gelang es ihm, nach Bürchau in die alte Heimat zurückzukehren, wo die Familie bereits auf ihn wartete.
Hanni und Wilhelm heiraten
Die Angehörigen der Binoth-Familie fanden zunächst in der Holl und in Bürchau Zuflucht. Zwar hatten sie alles verloren, doch man half sich in jenen schweren Tagen gegenseitig. Nach dem Jahreswechsel 1945 zog ein kalter, langanhaltender Winter ein, der sich nur unwillig verzog – bis ein neuer Frühling das Land erfüllte. Bei Wilhelm verlief die Erholung schleppend, immer wieder traten aufgrund seiner schweren Kopfverletzung neue Probleme und Rückschläge auf. Ein besonders schlimmer Vorfall ereignete sich während einer ärztlichen Visite: In einem Anfall geriet er außer Kontrolle, sodass fünf Pflegekräfte ihn mühsam bändigen mussten. Er hatte sich einen Arzt gegriffen und erwürgte ihn fast mit dessen Krawatte. Schlimmeres konnte nur durch das koordinierte Eingreifen der Helfer verhindert werden. Glücklicherweise blieb der Vorfall ohne bleibende Folgen, und Wilhelm konnte sich später nicht einmal daran erinnern. Die Genesungsphase zog sich noch lange hin, und die medizinische Versorgung war in den letzten Kriegstagen auch so schon alles andere als optimal.
In einer vergleichsweise günstigen Phase zwischen den stationären Behandlungen heirateten Wilhelm und Hanni am 4. April 1945 standesamtlich in Bürchau – und ich wurde als eheliches Kind legitimiert. Es fand kein großes Fest statt; die amtliche Handlung genügte, denn es ging vor allem darum, einerseits die Mutter im Bedarfsfall abzusichern und andererseits meine eheliche Legitimation zu bestätigen. Damals griff das Fürsorgeamt noch häufig ein, hatte bereits unzählige uneheliche Kinder den Müttern ohne langes Federlesen weggenommen und in Fürsorgeeinrichtungen untergebracht. Eine uneheliche Mutter wurde als unmoralisch angesehen. Der Krieg war immer noch nicht beendet – er dauerte noch über einen Monat –, aber im Wiesental war man relativ weit entfernt vom direkten Geschehen. Die Bewohner blieben von den unmittelbaren Kriegsfolgen und marodierenden Soldaten verschont. In der Holl kümmerte sich Tante Frieda nicht nur liebevoll um ihre Nichte, sondern auch um mich. Vermutlich war es Hanni auch möglich, auf dem Hof mitzuarbeiten – soweit es einer Mutter mit Kleinkind möglich war.
Die Mutter mit mir, als Kleinkind
Der Zinken Holl am Fluss der Kleinen Wiese, nur 4 Kilometer von Bürchau entfernt, war eine kleine Ansiedlung verstreuter Häuser mit Kirche, Gasthaus und Friedhof. Von Tante Frieda und Onkel Max erhielt die Mutter vielfältige Unterstützung, während sich die Tante zugleich um das seelische Wohl ihrer Nichte kümmerte. Frieda Binoth war tiefgläubig und fest in ihrer Kirche verankert – sie besuchte die Gottesdienste der Neuapostolischen Kirche in Schopfheim. Hanni hatte bisher wenig mit der Kirche zu tun, begleitete ihre Tante jedoch zu den Gottesdiensten. Bis dahin hatten weder sie noch ihre Eltern oder Geschwister ein besonderes Interesse am kirchlichen Leben gezeigt – und Rudolf Binoth war und blieb zeitlebens ein überzeugter Atheist. Die Großmutter hingegen war dem Glauben nicht abgeneigt und begleitete Hanni, wenn sie länger bei ihr in Nordrach war, gerne zu den Gottesdiensten – meist im Nachbarstädtchen Zell am Harmersbach. Vielleicht wollte sie ihren Mann nicht unnötig provozieren und hielt sich deshalb zu Hause zurück. Möglicherweise machten die besonderen Umstände dieser Zeit Hanni empfänglicher für seelischen Beistand. In der kirchlichen Gemeinschaft wurde sie jedenfalls herzlich aufgenommen und die warme, geschwisterliche Atmosphäre tat ihr sehr gut.
Der stattliche Binoth-Hof
Die Kirche in Schopfheim bei Lörrach lag 15 Kilometer entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel waren in jenen Tagen kaum verfügbar, sodass die Frauen abwechselnd mit dem Fahrrad fuhren: Wenn eine das Fahrrad hatte, ging die andere zu Fuß und schob den Kinderwagen – auf dem Rückweg wurde dann getauscht.
Am 8. Oktober 1945 wurde ich in Wohnstube der Binoths während einer Hausandacht getauft und am nächsten Tag durch Bezirksapostel Karl Hartmann gemeinsam mit der Mutter in Schopfheim versiegelt – eines der drei Sakramente der Neuapostolischen Kirche neben Taufe und Heiligem Abendmahl. Damit wurden wir Mitglieder der Kirche.
Doch die Geborgenheit im Kreis der Verwandten währte für die Mutter nicht lange. Wilhelm, ihr Ehemann, befand sich noch immer in der Psychiatrie, als der Ruf aus Nordrach eintraf. Der Großvater väterlicherseits, Karl Braun, war schon Jahre zuvor an einer Blutvergiftung (Sepsis) verstorben, und die andere Großmutter, Cäcilia Braun, war pflegebedürftig, gebrechlich und alt. Es war daher selbstverständlich, dass Hanni als Schwiegertochter zu ihr zog, um sich um sie zu kümmern. Schweren Herzens begann für sie eine Zeit beschwerlicher Wochen und Monate bei der Schwiegermutter in Nordrach. Das alte, schlichte Haus in der Nordrach-Kolonie schien – gefühlt – am Ende der Welt zu liegen. Doch ihr kam zugute, dass sie vom Wiesental her bereits die Enge eines Schwarzwaldtals gewohnt war. Die Täler unterschieden sich kaum: Vom Talboden erhoben sich steile Hänge, und auf der Höhe war man von dunklem Wald umgeben. Es war idyllisch, die Luft gesund – doch diese Enge konnte auch bedrückend und düster auf das Gemüt wirken.
Der Großvater Karl und seine Familie waren in Nordrach als die „Korbers“ bekannt und meinen Vater nannten alle nur den „Korber-Wilhelm“. Wie es zu diesem Übernamen gekommen ist, habe ich nie erfahren; solange mein Vater noch lebte und ich hätte nachfragen können, war es für mich ohnehin zweitrangig.
1946 starb die Schwiegermutter. Bis zu ihrem Tod war sie – wie es oft bei bösen Schwiegermüttern der Fall ist – äußerst dominant und herrisch. Sie schikanierte Hanni, wo es nur ging, und machte ihr das Leben schwer, als ob sie nicht schon genug zu tragen hätte. Neben ihren angeborenen und anerzogenen Eigenschaften spielte vermutlich auch altersbedingte Senilität eine Rolle. Zum Glück dauerte dieses Martyrium nur eine begrenzte Zeit, und mit ihrem Tod fand es ein Ende. Ein weiteres Problem war jedoch, dass Hanni kaum oder gar kein Einkommen hatte. Nach dem Ende des Krieges am 8. Mai 1945 fielen auch die Versorgungsleistungen für Wilhelm – der nicht da war – weg. Erst nachdem Wilhelm endgültig aus der Klinik entlassen wurde und heimkehrte, änderte sich die Situation: Seine erste Aufgabe war es, schnell eine Arbeitsstelle zu finden. Für einen kräftigen, gesunden Mann war das kein Problem. Es fehlten in der Nachkriegszeit Männer an jeder Ecke, er war aber nicht gesund und kräftig, doch es musste irgendwie gehen.
Cäcilie Braun in der dörflichen Tracht
Die Verwandtschaft und Geschwister des nun 34-jährigen Wilhelm Braun hatten das Tal längst verlassen und lebten weit verstreut im Land. Sie begegneten ihrer Schwägerin meist mit wenig Sympathie – sie schätzten sie gering, da sie nichts besaß und nichts verdiente. Der Kontakt zu den Geschwistern des Vaters war daher – abgesehen von wenigen Ausnahmen – sehr begrenzt. Wir Kinder lernten nie alle Onkel und Tanten persönlich kennen. Wer sie waren und welche Tätigkeiten sie ausübten, blieb größtenteils ein Rätsel – abgesehen von einem Schuhmachermeister in Tuttlingen. Eine Tante lebte in Niederbühl bei Rastatt, die wir direkt kennenlernten, während Tante Käthe, ursprünglich aus Heidelberg, nach dem Tod ihres Mannes nach Rastatt zog, wo wir sie auch manchmal besuchten. In Zell gab es auch noch einen weitläufigen Verwandten, bei dem ich als Kind einige Tage verbrachte – und damit war es dann auch.
Die familiären Bande innerhalb der „Korbers“ waren nie besonders ausgeprägt – was aus Sicht meiner Eltern verständlich war und von niemandem als Mangel empfunden wurde. Nach dem Tod der Großmutter wurden die vorhandene Wäsche, Geschirr und beweglichen Gegenstände gierig unter den Geschwistern von Wilhelm aufgeteilt. Wie Hyänen stürzten sie sich auf alles, sodass der Mutter letztlich nichts blieb. „Nicht einmal die Nähmaschine haben sie mir gelassen, mit der ich für die Familie und andere im Dorf hätte nähen können, um etwas zu verdienen“, berichtete sie später ohne Verbitterung.
„Wäre der Willi – wie sie ihn im Kleinen Wiesental nannten – dagewesen, hätten sie sicherlich nicht so mit mir umgegangen. Aber ich war noch zu jung und konnte mich nicht wehren. Vielleicht wäre er damals noch in der Lage gewesen, Ordnung zu schaffen und sich durchzusetzen, denn vor seinem Unfall war er ein knochenharter Bursche.“
So gestaltete sich der Alltag in jenen Tagen sehr beschwerlich, bis Wilhelm schließlich dauerhaft zu Hause war, Arbeit fand und ein bescheidenes Einkommen erzielte. Schon damals wurden wir in der Familie als die „arme Verwandtschaft“ stigmatisiert. In dieser Situation zahlte sich Hannis sparsame Lebensweise aus – sie konnte aus wenig viel machen. Sie war unheimlich zäh, geduldig und äußerst leidensfähig.
Es sei hier erwähnt, dass Wilhelm Braun vor und während seiner aktiven Militärzeit ein gutes Einkommen hatte, aber sehr sparsam lebte. Über die Jahre konnte er Ersparnisse zurücklegen und schickte seiner Mutter zweimal Geld, damit sie das gemietete Häuschen kaufen konnte. Doch Großmutter Braun lebte gerne „auf großem Fuß“ und gab das Geld für angenehme Dinge aus, vor allem für Kleidung. Sie liebte es, als „Grande Dame“ aufzutreten. So blieb man weiterhin in Mietwohnungen, bis das Haus 1950 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wurde.
1) https://www.kleines-wiesental.eu/Gemeinde
2) https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Elsass
3) https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Peter_Hebel
4) https://de.wikipedia.org/wiki/Bund_Deutscher_M%C3%A4del
5) https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance
6) https://de.wikipedia.org/wiki/D-Day
7)https://www.deutschepost.de/de/b/briefe-ins-ausland/internationaler-antwortschein.html
2
Eine junge Mutter muss sich behaupten
Die Wohnsituation im alten Haus war selbst nach damaligen Maßstäben äußerst schlicht und bescheiden. Alles war alt und unmodern, die Einrichtung spärlich und einfach. Doch wen hätte dieser Zustand stören sollen? Luxus kannte und erwartete in dieser schwierigen Zeit niemand – schon gar nicht in einem kleinen Dorf, abgelegen am Ende eines engen Tals. Es brauchte viel Mühe, Geduld und ein geschicktes Händchen, um das Zuhause wenigstens einigermaßen wohnlich und gemütlich zu gestalten.
Bis in die 1960er Jahre war Nordrach ein weithin bekannter Kurort zur Behandlung von Tuberkulose. Im Tal gab es vier sogenannte Heilstätten, darunter die große Lungenheilstätte in der Kolonie, später umbenannt in das LVA-Krankenhaus. Patienten aus ganz Deutschland kamen hierher in der Hoffnung auf Heilung.
Hundert Jahre zuvor hatte eine florierende Glasfabrik vielen Arbeitern und ihren Familien ein bescheidenes Auskommen gesichert. Doch als das Holz der umliegenden Wälder in den Schmelzöfen aufgebraucht war, kam die Produktion zum Erliegen, und zahlreiche Arbeiter stürzten in bittere Not und Armut. Anfang des 19. Jahrhunderts sah sich die Gemeinde gezwungen, über 100 Bürger zur Auswanderung nach Amerika zu drängen. Ihnen wurde eine einfache Schiffspassage von Le Havre an der französischen Westküste bezahlt, dazu ein kleines Handgeld – dann mussten sie ihre Heimat verlassen, ob sie wollten oder nicht. Man wollte die „Hungerleider“ einfach loswerden. Mehr als die Hälfte der Vertriebenen überlebte die Überfahrt über den Atlantik nicht, wie Gottfried Zurbrügg eindrucksvoll in seinem Buch „Westwärts, Wellenreiter“ 8) schildert. Nur wenige von ihnen kehrten jemals in das Tal zurück. Viele Jahrzehnte später erwarben der bekannte Arzt Dr. Otto Walther und seine Frau Hoppe-Bridges Adam 9) das große Gelände mit den Gebäuden und bauten es zu einer international renommierten Lungenheilstätte aus. Damit entstanden neue Arbeitsplätze, besonders für Frauen, die zum Unterhalt ihrer Familien beitragen mussten. In den Anfängen kamen die Patienten sogar aus Großbritannien. Das langgestreckte, enge Tal steigt von etwa 300 Metern Höhe im Dorf auf fast 900 Meter an und gilt als weitgehend staub- und nebelfrei – ein entscheidender Grund für die Wahl dieses Ortes als Heilstätte. Noch in den 1950er- und 1960er Jahren war Nordrach ein angesehener Kurort für Lungenkranke und wurde oft mit Davos in der Schweiz verglichen. Tatsächlich trug es den Beinamen badisches Davos.
Das Hintertal und die Siedlung Kolonie liegen abgeschieden, etwa sechs Kilometer vom Dorf entfernt. In dieser verstreuten Ansammlung einzelner Schwarzwaldhöfe und Häuser bot sich kaum Abwechslung – besonders für eine junge Frau. Doch das war nicht ihre größte Sorge. Erst im Laufe des Jahres 1946 kehrte Wilhelm dauerhaft aus dem Dunstkreis der Ärzte zurück, und gleichzeitig wurde ich aus Bürchau oder der Holl heimgeholt. Bis dahin hatte mich meine Mutter in die Obhut von Verwandten belassen, die sich über ein Jahr lang gut um mich gekümmert hatten. Die kleine Familie war jetzt zusammen und Willi hatte Arbeit im etwa einen Kilometer talwärts gelegenen Sägewerk Echtle finden können. Es schien, als könnte sich das Leben allmählich normalisieren.
Der Sommer und Herbst 1946 vergingen ohne größere Ereignisse – bis sich ein neues ankündigte: Das zweite Kind war unterwegs, und im Dezember wurde Rudolf geboren. Stillen war damals selbstverständlich. Doch in der Lungenheilstätte Kolonie gab es unter den Tuberkulose-Patientinnen, die infolge der Mangelernährung – einer Spätfolge des Zweiten Weltkriegs – ohnehin geschwächt waren, auch junge Mütter, die ihre Kinder nicht selbst stillen durften. Muttermilch war jedoch für die Entwicklung der Babys essenziell. Ersatzprodukte wie Milchpulver waren nicht verfügbar. Die Ärzte suchten daher dringend nach gesunden Frauen in der Bevölkerung, die Milch abgeben konnten. Hanni, die selbst eine kräftige junge Frau war, hatte genug Milch, um zu helfen. Regelmäßig wurde ein Teil ihrer Milch abgezapft und zur Klinik gebracht – als Gegenleistung erhielt sie Butter und andere wichtige Lebensmittel aus der Heilstätten-Küche. In diesem Zusammenhang erzählte uns unsere Mutter einmal schmunzelnd eine amüsante Anekdote aus der Großküche: „Eine nicht besonders helle Küchenhilfe hatte die Aufgabe, auf die Milch im Großkessel aufzupassen, damit sie nicht überkochte. Nach einer Weile kam sie mit einem Löffel Milch zur Oberschwester ins Obergeschoss und fragte: ‚Kocht die Milch schon?‘ Als die Oberschwester zurück in die Küche eilte, war das Malheur bereits passiert – die Milch war übergekocht.“
Schon damals halfen meine Eltern Bauern im Hintertal oder Stollengrund während der Ernte oder bei saisonalen Engpässen. Als Lohn erhielten sie neben etwas Geld auch meist Naturalien: ein Stück Speck, einen Ring Schwarzwurst oder Leberwurst, manchmal auch etwas Kesselfleisch oder Schmalz – eine wertvolle Energiequelle in Zeiten harter körperlicher Arbeit. Trotz aller Entbehrungen ging es irgendwie immer weiter. Zum Haus gehörte ein kleiner Garten, in dem Hanni Gemüse anbaute. Im Schuppen stand ein Hasenstall, in dem sowohl junge als auch schlachtreife Stallhasen gehalten wurden – eine weitere, wenn auch bescheidene, Quelle für Nahrung und Selbstversorgung.
Große Gefahr für den kleinen Walter
Die Neugierde war mir anscheinend schon in die Wiege gelegt worden. Als kleiner Knirps erkundete ich ständig das Haus und erforschte die nähere Umgebung. Am Hang, im ansteigenden oder abfallenden Gelände, auf der Wiese am Bach oder im Wasser gab es immer etwas zu entdecken.
An einem sonnigen und trockenen Samstagnachmittag war meine Mutter damit beschäftigt, meinen kleinen Bruder zu baden. Ich hatte das schon hinter mir und tummelte mich draußen ums Haus. Unterhalb des Hauses, nur durch einen Wiesenstreifen getrennt, plätscherte die Nordrach, der Bach, nach dem das Tal benannt ist. Rückseitig am Hang verlief ein schmaler Wasserkanal, dessen Wasser etwa 20 Meter weiter in ein kleines Stauwehr floss. Vom bis an den Rand aufgestauten Wehr führte eine Rohrdruckleitung ab, die im etwa 200 Meter entfernten Gasthaus Adler über eine Turbine und einen Generator Strom erzeugte.
Längs über dem etwa vier mal drei Meter messenden Stauwehr lag eine Holzbohle. Mitten im Wasser sah ich einen Igel, der mit dem Bauch nach oben trieb. Vermutlich wollte ich das Tierchen retten und zögerte nicht. Welches kleine Kind im Alter von etwa drei Jahren kann schon mögliche Gefahren einschätzen? Um den Igel herauszuholen, betrat ich die Bohle und wollte darüber hinweglaufen, doch sie gab nach, kippte seitlich weg, und ich platschte ins Wasser. Reflexartig konnte ich ein Grasbüschel am Rand greifen und mich daran festhalten. Allein kam ich nicht heraus, deshalb hielt ich mich krampfhaft fest und schrie Zeter und Mordio, bis meine Mutter es hörte, herbeieilte und mich klatschnass herauszog. War es wieder Schicksal oder ein wachsamer Engelschutz? Tatsächlich war das sehr knapp gewesen, und es ist noch einmal gut gegangen. Wäre zu diesem Zeitpunkt die Turbine gelaufen, hätte mich der Sog unweigerlich unter Wasser an den Schmutzrechen gesaugt. Da hätte man lange nach mir suchen können.
Tagsüber arbeitete mein Vater im Sägewerk, und damals durften die Angehörigen noch an den Arbeitsplatz kommen. Mittags musste ich ihm das warme Essen im Henkelmann bringen. Das mehrteilige Essgeschirr aus Aluminium war praktisch, und das Mittagsgericht in einzelnen Schüsseln schön getrennt. In Sichtweite des Sägewerks standen das Wohngebäude und Büro, und dort vis-à-vis am Hang ein Bienenhaus im Garten. Unterhalb der Einfluglöcher gab es hölzerne Querbretter mit Leisten, die für mich wie eine Treppe aussahen. In meiner Neugierde wollte ich erkunden, ob ich dort hinaufklettern könnte. Wieder war es ein besonderes Glück, dass ein Sägewerksarbeiter das gesehen hatte, herbeigerannt kam und mich schleunigst wegholte, bevor die Bienen sich bedroht gefühlt und zugestochen hätten.
„Das Leben ist lebensgefährlich, vom ersten Tag an“, ist einer meiner Aphorismen. Vom Wohnzimmerfenster aus konnte ich zur nicht weit entfernten Straße blicken, die parallel zum Bach verläuft. Die Nordrach fließt hier noch als ruhig gurgelndes Gewässer talwärts, vereinigt sich in Zell mit dem Harmersbach aus dem Nachbartal, und beide münden bei Biberach in die Kinzig. Es war ein regnerischer Tag, deshalb war ich auch in der Stube geblieben – oder musste bleiben, damit ich nicht nass und schmutzig wurde. Um etwas sehen zu können, hatte ich mich auf einen kleinen Schemel gestellt und blickte aus dem Fenster zur Straße hinüber. Zuerst hörte ich es, dann sah ich das knatternde Motorrad ankommen, dessen Fahrer eine Person auf dem Sozius sitzen hatte und das Tal hinausfuhren. „Die Beifahrerin hing in der Kurve auf die falsche Seite“, sagte man später. Sie sind in der Kurve gestürzt, wobei es für mich aussah, als ob der Motorradfahrer im Wasserrohr am Straßenrand hindurchgefahren und verschwunden sei. Aufgeregt rannte ich zur Mutter und musste ihr sagen: „Motorrad hed hupe-da g’macht“. Mir war nicht bewusst, und ich hätte es in diesem Alter auch nicht verstanden, dass der Motorradfahrer ums Leben kam.
Mit dem Arbeitsplatz des Vaters hatte die Familie endlich ein regelmäßiges Einkommen, auch wenn der Lohn nicht üppig war. Um das Jahr 1947 bekam ein Arbeiter einen Stundenlohn von knapp über einer Mark. Jedermann war so kurz nach Kriegsende aber froh, wenn er überhaupt eine Beschäftigung hatte und somit ein Einkommen. Das galt besonders im ländlichen Raum, in Dörfern wie Nordrach, abseits größerer Städte, in denen es nur wenig Handwerk und keine Industrie gab. Gut bezahlte Arbeitsplätze waren Mangelware. Doch Hanni hatte mit zwei Kindern zu Hause genug zu tun. Der Haushalt mit allem Drumherum wollte versorgt sein, und wir beiden Buben auch. Wir waren quirlig-lebendig, und das erforderte schon ihre volle Aufmerksamkeit. In jedem Augenblick konnte etwas passieren, denn das schon Geschilderte blieb nicht das einzige Minenfeld in unserem jungen Leben. Schon zeigten sich wieder dunkle Wolken am Horizont, auch wenn nicht gleich alles spektakulär oder gar existenzbedrohend war, Sorgen bereitete es trotzdem. Eines Morgens fütterte Hanni wie alle Tage ein halbes Dutzend ihrer Hasen im Schuppen. Für Haushalte, die keine Kuh im Stall, kein Schwein oder zumindest eine Ziege hatten, waren Stallhasen zur Selbstversorgung mit Fleisch eine gute und kostengünstige Alternative und deshalb wertvoll und wichtig. Bei manchen Familien scharrten und pickten auch noch ein paar Hühner im eingezäunten Gelände. Während sie die Hasen fütterte, stellte sie fest, dass mit einem etwas nicht stimmte. Es kam häufig vor, dass vom Gras verursachte Blähungen für ein Tier tödlich sein kann. Sie musste sofort handeln, bevor der Hase verendet war. Kurzum nahm sie ihn hinter den Ohren, betäubte ihn mit einem kurzen Schlag auf den Kopf, tötete ihn mit einem Schnitt in den Hals und zog das Fell ab. Danach musste sie das Tier aufhängen und ausnehmen, bis am Abend das Fleisch zerlegt wurde. So ist nichts verloren gegangen. Bis am Abend der Vater von der Arbeit heimkam, hatte sie nicht warten dürfen. Es war schade um das Tier, aber so war das Fleisch gut und konnte verwertet werden. Wie viele jungen junge Frauen, so etwa um die zwanzig, sind heute noch in der Lage, einen Hasen zu schlachten? „Chapeau“.
In jenen Jahren war es noch selbstverständlich, dass die Kinder gewisse Aufgaben im Haushalt übernehmen mussten. „Kinderarbeit“ war noch nicht negativ besetzt. Meine Aufgabe war es – wie schon erwähnt – dem Vater jeden Tag das Mittagessen in die Sägerei zu tragen. Auch wurde ich täglich mit der Kanne zum Milch holen zum Bauern geschickt oder hatte Küchenabfälle zu den Nachbarn zu bringen, die sie an die Schweine verfütterten.
Ein sommerlicher Wochentag erfüllte das Tal, es war heiß, die Sonne brannte schon seit Tagen vom wolkenlosen Himmel und sogar der Teer auf der Straße war zähflüssig geworden. Mir machte es unterwegs einen Heidenspaß, barfuß im warmen, zähflüssigen Teer zu waten. Die zähe Masse quoll angenehm zwischen den Zehen hindurch, während ich barfüßig durchstapfte und mit teerverklebten Füßen mit dem Essgeschirr in der Hand schließlich ins Sägewerk kam. Der Vater wurde angesichts meiner Füße ärgerlich und er schimpfte über mein dummes Tun. „Wo bisch du Lusbue wied'r rum glatscht? (wo bist du Lausbube wieder rumgelaufen). Die Strafe folgte doppelt auf dem Fuße. Zuerst nahm er eine Holzlatte und versohlte mir den Hintern, und zu Hause bemühte sich die Mutter mühsam und schmerzhaft den Teer mit einer Sandseife zu entfernen. Den Trick Teer mit Butter zu lösen, kannte sie wohl nicht oder das war ihr dafür zu schade. Ein spezielles Lösemittel, wie Waschbenzin oder so, gab es auch nicht im Haushalt.
Mein Bruder wird verletzt
Die Mutter konnte unmöglich überall gleichzeitig sein, um all unsere Streiche im und außerhalb des Hauses zu überwachen. Sie musste sich auch um die übliche Hausarbeit kümmern, die Hasen im Stall versorgen und den Garten beim Haus bestellen. Mit vier Jahren spielte ich eines Tages mit meinem zwei Jahre jüngeren Bruder Rudolf hinten im Schuppen. Ich bemerkte, dass Rudolf das "Säßle" (Hackbeil) oder „Haumesser“ vom Hackklotz genommen hatte und es triumphierend umhertrug. Da ich wusste, wie gefährlich dieses Werkzeug war, nahm ich es ihm weg. Unter seinem lauten Protest wollte ich es zurück in den Hackklotz schlagen, wo es hingehörte. In diesem Moment fuhr er mit seinem Ärmchen darunter. Vielleicht wollte er danach greifen und es zurückhaben? Zum Glück war nicht viel Kraft oder Schwung dabei, dennoch hing sein dünnes Ärmchen nur noch an Haut und Sehne. Die Lungenheilstätte war etwa einen Kilometer entfernt, und ein Arzt leistete dort erste Hilfe. Dr. Weise im Dorf oder das Krankenhaus in Zell wären viel zu weit entfernt gewesen. Die Wunde wurde fachgerecht genäht und versorgt, der Arm geschient, und „Gott sei Dank“ blieb die Hand meines Bruders erhalten. Zeitlebens erinnerte ihn nur noch eine sichtbare Narbe an das Unglück; eine Behinderung entstand daraus nicht.
Kann es für eine junge Familie noch schlimmer kommen? Ja, das kann es, und wenn es kommt, dann gleich knüppeldick. Wie schon erwähnt, war das Haus alt, das Plumpsklo – das Häuschen mit Herz – befand sich außerhalb hinten beim Schuppen, wie es damals bei vielen älteren Gebäuden üblich war. Auch über den Luxus eines Bades verfügten wir nicht. Wir Kinder wurden draußen am Brunnen vor der Tür gewaschen. In der Küche gab es weder eine Spüle noch fließendes Wasser. Somit musste die Katzenwäsche althergebracht mit dem Waschlappen ausreichen. Wenn die Mutter uns Buben ganzkörperlich reinigen wollte, stellte sie uns in der Küche in einen Kübel oder in die große Waschschüssel, in die sie vorher warmes Wasser vom Herdkessel eingegossen hatte.
Der Tag neigte sich dem Ende zu; es war spätabends, und draußen dämmerte es langsam, während das Tageslicht in die blaue Phase überging. Die Mutter hatte uns Buben längst schlaffertig gemacht und ins Bett gebracht. Wie es bei munteren Kindern oft der Fall ist, musste oder wollte ich nochmals raus aufs Klo. Die Mutter hatte es nicht bemerkt und wähnte uns sicher im Bett. Auf dem Herd standen noch Töpfe, und in einem köchelten Kartoffeln im heißen Wasser. Sie nahm die Kartoffeln vom Herd, schüttete sie in ein Sieb und goss das noch kochend heiße Kartoffelwasser wie immer nach draußen auf den Misthaufen, oder sie wollte das tun. Das tat sie mit Schwung durch die offenstehende Doppeltür. Genau in diesem Augenblick kam ich aber vom WC zurück und wollte flugs durch die Küche ins Schlafzimmer huschen. In diesem Augenblick lief ich direkt in den Schwall des heißen Kartoffelwassers. Die Folgen waren bös und unglaublich schmerzhaft. Das heiße Wasser hatte mich großflächig vom Kopf bis zu den Zehen mehr oder weniger schwer verbrüht. Besonders schlimm traf es die bekleideten Stellen, an denen das heiße Wasser länger auf die Haut hatte einwirken können. Die heute empfohlene Methode, sofort mit kaltem oder lauwarmem Wasser länger zu kühlen, war noch unbekannt. Die Mutter versuchte mich zuerst mit den bekannten Hausmitteln zu behandeln. Sie nahm Kamillenöl mit Johanniskraut und anderen Ingredienzen, die sie stets vorrätig hielt. Andere streuten in solchen Fällen sogar Mehl auf die betroffenen Stellen. Beides ist – wie man heute weiß – ungeeignet. Bei den großflächig betroffenen Stellen reichte das bisschen Öl nicht weit. Um mehr zu besorgen, rannte sie panisch zu den Nachbarn, um dort nachzufragen. In jener Zeit gab es in jedem Haus diverse Haus- oder Heilmittelchen für den täglichen Gebrauch. Die nächsten Häuser, das Forsthaus und das Café Mooseck, waren aber rund hundert Meter entfernt. Dorthin hastete sie übereilt am Vater vorbei, der gerade von der Arbeit heimkam. Vermutlich gab sie ihm auf die Frage: „Was ist los, wo willst du hin?“, nur eine unverständliche Antwort oder gar keine und rannte einfach weiter. Deshalb angesäuert und mürrisch betrat er das Haus und hörte mich drinnen wie am Spieß schreien. Energisch wollte er mich zur Räson bringen und schrie mich an. Damit endet meine Erinnerung an das schreckliche Ereignis. Das Machtwort des Vaters muss bei mir wohl einen Schock ausgelöst haben, oder ich fiel wegen der unerträglichen Schmerzen ins Koma, was gut war. Später kam ein Arzt, und er musste die Reste des Schlafhemdes aus dem Fleisch lösen, wie man mir später schilderte; ich habe nur eine vage Erinnerung daran. Die weitere Behandlung und Wundversorgung dauerten Monate, und diese übernahmen die Gemeindeschwestern, Nonnen der katholischen Kirche. Unüblich war das nicht, denn wir wohnten für den Arzt sehr weit entfernt, und die Nonnen verfügten über gute Kenntnisse in der Krankenpflege. Sie waren geschult und wurden in allen möglichen Bereichen des dörflichen Lebens, vor allem in der Kinder- und Familienbetreuung, gerne eingebunden. Es waren auch Nonnen, die in der Lungenheilstätte tätig waren und ebenso in den Krankenhäusern, so auch in Zell am Harmerbach. Sie versahen als Pflegekräfte ihren Dienst und übernahmen die Kinderbetreuung in den örtlichen Kindergärten.
Die Nonnen sicherten eine regelmäßige und unter den damaligen Verhältnissen bestmögliche Nachsorge. Hauttransplantationen, bei schweren Verbrühungs- und Brandverletzungen heute längst gängig Praxis, gab es im ländlichen Raum noch Jahrzehnte danach nicht. Den Schwestern ist es gelungen, mit der über Monate andauernden fürsorglichen Pflege, mich über den Berg zu bringen. Die Wunden verheilten nach und nach. Dabei nannten sie es ein Wunder, dass ich, neben meiner guten Konstitution, dieses traumatische Ereignis überlebt habe. Wohl blieben dauerhaft sichtbare Narben an der rechten Schulter und am Arm zurück, sowie an weiteren betroffenen Stellen, die sich später nur noch als Hautveränderungen zeigten. Die Narben störten mich später nie, sie haben mich auch weder beeinträchtigt noch behindert. Der Heilungsverlauf dauert über vier Monate und danach musste ich wieder laufen lernen. In der Wohnstube stand ein großer Kachelofen mit einer Chunscht (seitlichen Bank) und die gab Halt. Das war praktisch, ich konnte mich daran hochziehen, festhalten und entlang hangeln, bis meine Füße wieder kräftig genug waren.
Die schichten Verhältnisse im Elternhaus, die in den Nachkriegsjahren bescheidenen Lebensumstände, waren uns Kindern nie bewusst. Uns fehlte nichts, da waren ganz andere Dinge wichtiger und zählten mehr. Die Umgebung am Haus und Hang boten mir als neugierigem Buben unendlich viel Abwechslung und unser Bewegungsradius war groß. In der weiteren Nachbarschaft flocht ein Korbmacher seine Ware. Er flocht aus Weiden Henkel- und Wäschekörbe, die er den Bauern im Tal lieferte. Solche Körbe und „Zainen“ (alemannisch Wäschekörbe) wurden für alles Mögliche beim Transport und lagern benötigt und eingesetzt. Dem erwähnten Wassergraben wuchsen mehrere alte Weidenstöcke, die jedes Frühjahr frische Ruten austrieben und wenn sie lang genug gewachsen waren, schnitt sie der Korbmacher, sie wurden gebündelt im Wasser frisch gehalten, bis er sie für die Körbe verwenden wollte.
Bei dieser handwerklichen Tätigkeit habe ich mit Sicherheit dem Korbmacher interessiert zugeschaut, und clever wie Buben in diesem Alter manchmal sind, wollte ich das nachmachen. Ich nahm Mutters große Schere und schnitt an den Weiden ein Bündel der jungen Weideruten ab; ich wollte auch so einen schönen Korb haben. So ein Körbchen schien mir für viele Dinge nützlich zu sein. Bunte Kunststoff-Förmchen für Sandkuchen und dergleichen Spielzeug kannten wir nicht und solche aus Blech waren teuer, die schenkte uns keiner. Und wie sollte ich in diesem Alter auch wissen, wie man fachgerecht Weiden schneidet, und dass sie fremdes Eigentum sind? Die Haushaltsschere taugte wenig für den Zweck und die Weideruten, die ich abschneiden konnte, waren zu jung. Geeignete Weidetriebe hätte ich mit der Schere aber nicht geschnitten bekommen. Dem Korbmacher hatte mein Aktion nicht gefallen und es gab Ärger. Der Vater musste mit mir zu ihm kommen und ich bekam ordentlich den Hintern versohlt. Vermutlich hatte der Korbmacher hinterher aber doch ein gutes Herz oder er hatte Mitleid mit mir, dem kleinen Knirps. Er flocht einen kindgerechten Korb und schenkte ihn mir. Vielleicht hatte ihm meine Initiative imponiert?
Ungefähr hundert Meter entfernt von uns stand ein stattliches Forsthaus. Zum Wohnbereich führte außerhalb die Treppe nach oben und man kam in den Hausflur, eine für mir als Kind große Eingangshalle und im direkten Blick hing ein ausgestopfter Kopf eines kapitalen Ebers an der Wand. Das Wildschwein erschien mir riesig und jagte mir Angst ein. Die mächtigen weißen Hauer des Keilers sahen sehr gefährlich aus. Wenn es ging, mied ich diesen Eingang und nahm stattdessen lieber den ebenerdigen Nebeneingang mit Doppeltüre ins Haus, durch die „Klöntüre“, wie die Norddeutschen sagen. So musste ich nicht an dem furchteinflößenden Keiler vorbei. Irgendwann musste ich den Eindruck gewonnen haben, dass die Holztüre dringend eine Auffrischung bräuchte und da sollte man etwas dagegen tun. Ich schritt zur Tat und so hoch es ging, bepinselte ich das Holz mit Wagenschmiere. Der Teufel weiß, wo ich die herhatte. Die Verschönerung missfiel dem Förster und er zitierte den Vater mit mir herbei. Zuerst bekam ich wieder den Hosenboden versohlt (eine Tracht Prügel) und dann verdonnerte mich der Förster die Sauerei mit einer Bürste und Wasser zu entfernen. Ob das wirksam war und etwas genützt hat?, ich glaube es nicht. Die Wagenschmiere war sicher nicht so einfach mit der Bürste und Schmierseife abzuwaschen.
Es waren bewegte Zeiten und das tägliche Bemühen zurechtzukommen gehörte zum Alltag dazu, mit allen Aufregungen, die damit verbunden waren. Im Jahr 1948 gab es weiteren Familienzuwachs, Hanni erwartete ihr drittes Kind und im September kam unsere Schwester Waltraud zur Welt. Übergangsweise war Mathilde, die Schwester der Mutter und Schwägerin des Vaters, ein paar Wochen bei uns und kümmerte sich um uns Kinder und den Haushalt. Der Vater musste der Arbeit nachgehen und konnte sich nicht auch noch um uns kümmern. In diesen Tagen entstand ein inniges Verhältnis zwischen Mathilde und dem Vater, wenn es nicht schon vorher bestanden hatte. Wie weit das ging, darüber konnte man nur spekulieren. Sie war jünger als Hanni und ließ allgemein nichts anbrennen. Im Nachhinein gesehen war die Schwägerin aber ein armer Tropf und zu bedauern, sie hatte in ihrem jungen Leben nur Leid und Entbehrung erfahren. Noch lag die Vertreibung oder Flucht aus dem Elsass nicht lange zurück, und dann hatte sie ledig einen Sohn bekommen. Der Bub war behindert und im Umgang sehr schwierig, nach heute gängiger Diagnose hatte er die Entwicklungsstörung Autismus. Das Jugendamt nahm ihr den Buben weg und gab ihn in eine Pflegefamilie. Die Fürsorgeämter machten damals mit ledigen Müttern nicht viel Federlesens, und Mitleid oder Gefühle kannten die Verantwortlichen der staatlichen Stellen nicht. Eine unverheiratete Frau, die schwanger geworden war, galt als Schande, das war unmoralisch. Die Väter und Erzeuger solcher Kinder trugen dagegen keinen Makel, ihnen war offensichtlich alles gestattet, sie mussten lediglich Alimente bezahlen, wenn man ihrer habhaft wurde und der Name bekannt war. Ihn zu ermitteln war damals kurz nach Kriegsende nicht immer einfach, sehr viele vagabundierten unangemeldet durch die Lande. Das Kind war verhaltensgestört und der Umgang schwierig. Häufig wechselten deshalb die Pflegefamilien, und irgendwann war eine normale Erziehung nicht mehr möglich. Die Behörden gaben den Jungen in die anerkannte Einrichtung für Behinderte in Rheinfelden-Herten. Wie wir später hörten, ist er dort im Alter von etwa 35 Jahren gestorben. Uns gegenüber haben sich die Großeltern zu diesem Enkel nie geäußert. Die Sache wurde offensichtlich totgeschwiegen. Vielleicht war es ihnen und der Verwandtschaft peinlich? Ein Kontakt zum Enkel soll aber bestanden haben. Mit diesem erschwerten Schicksal und vielen anderen Widrigkeiten des Lebens ist Mathilde nicht klargekommen. Nur wenige Jahre später hat sie sich mit Gas das Leben genommen.
Wir waren jetzt fünf Personen in der Familie und das Einkommen des Vaters war immer noch bescheiden. Zeitweise war er über längere Phasen infolge der Unfallnachwirkungen auch nicht arbeitsfähig. Eine Lohnfortzahlung, wie wir es heute kennen, gab es nicht und die Krankenkasse bezahlten im Krankheitsfalle immer nur für eine begrenzte Zeit, dann musste er „stempeln gehen“ (Arbeitslosengeld, heute Sozialhilfe beziehen). Das war dann zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. In den Folgejahren gab es oft solche Zeiten. Die Unfallfolgen und weiteres, auf das ich noch eingehen werde, wirkten nach und folglich fehlte es im Haushalt zwar nie am Essen, aber häufig an Geld. Mit Unterstützung eines Rechtsanwaltes und dem VDK, Verband der Kriegsversehrten hat Wilhelm über Jahre geklagt, aber keinen Erfolg erzielt. Er bekam zeitlebens keinen Pfennig, ebenso wenig, wie die Mutter und ihre Eltern keine Entschädigung für das erlittene Unrecht der Vertreibung oder die Flucht aus dem Elsass und den dabei erlittenen Verlusten bekommen haben. Es waren die Fähigkeiten und vielseitigen Kenntnisse der Mutter, die der Familie immer wieder über die Runden verhalfen. Sie verstand es bestens, aus allerlei was die Natur hergab, Essbares zu machen. Sie sammelte Brennnesseln als Spinatersatz, Kräuter, Sauerampfer und jungen Löwenzahn, die den Speiseplan bereicherten.
Wir Kindern wollten das nicht, wir murrten und wehrten uns mit Händen und Füßen, wenn wir das Grünzeug vorgesetzt bekamen. „M'r welle kei Bettseicher-Salat esse“ (Wir wollen keinen Löwenzahn essen), protestierten wir. Heute gehören solche Kräuter längst zur modernen Küche, sie werden von Spitzenköchen zubereitet und der Gast bezahlt gerne dafür. Hungern haben wir trotzdem nie müssen. Die Mutter pflanzte auf gepachteten kleinen Äckern alles Gemüse, das wir brauchten, Kartoffeln, Gelbe Rüben und dergleichen. Und dann waren da noch die Stallhasen, sie sicherten den Fleischbedarf, neben dem, war man von den Bauern bekam. Das Futter wurde mit der Sichel am Wegrand und an den steilen Hängen geschnitten oder Gras mit der Hand gerupft. Das war überall dort erlaubt, an denen die niemand mähen wollte. In der Regel waren wir größeren Kinder es, die das Hasenfutter beibringen mussten.
Wie in den allermeisten Haushalten im ländlichen Bereich wurden im Café Mooseck Schweine im Stall gehalten. Selbstverständlich hat man damals die anfallenden Küchenabfälle noch an die Tiere verfüttert. Das war kein Sonderabfall, wie heute, alles, was im Haus und Garten an Resten anfiel, wurde sinnvoll verwertet. Immer wieder schickte mich die Mutter los, um unsere Küchenabfälle und Reste aus dem Garten, die nicht an die Hasen gingen, der Mooseck-Wirtin und anderen zu bringen. Im Mooseck bekam ich dafür etwas Süßes und manchmal einen Apfel. Später haben sie mich gefoppt, weil ich gebettelt habe: „Gib mir doch noch einen Apfel, sonst muss ich meinem Bruder die Hälfte abgeben.“
Im Hintertal gab es keine oder nur wenige Apfelbäume. Mehr eher im höheren Bereich, oberhalb an den Hängen und den Streuobstwiesen rund um die Höhenhöfe. Deshalb waren Äpfel für uns Kinder immer etwas Besonderes und gab es selten. Bei der Heimfahrt vom Dorf sah die Mutter vom Fahrrad aus unterwegs mehrere reife Äpfel am Rand der anderen Bachseite im Gras liegen. Sie waren offensichtlich von einem Baum oberhalb am Hang heruntergekullert. Damit die nicht verfaulten, stieg sie vom Rad, watete durchs Wasser auf die andere Bachseite und holte sich die Äpfel und brachte sie uns nach Hause; mit nassen Füßen zwar, aber glücklich und wir verzehrten sie mit Wonne.
In dieser Phase und vielleicht mit fünf, war ich gelegentlich über Tage oder vielleicht auch Wochen außer Haus und mir gefiel das. Vermutlich nur, um damit zeitweise aus der Reichweite meines strengen Vaters zu sein. Weshalb, warum ist mir nicht mehr bewusst. Sicher war es für meine Eltern eine gewisse Entlastung, wenn ein Esser weniger am Tisch saß – und pflegeleicht war ich auch nie. Kurzum, ich war in diesen Tagen bei einer älteren Frau in der „Kolonie“, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass sie zur Verwandtschaft zählte. So weit geht aber meine Erinnerung nicht mehr. Etwas anderes spielte da vielleicht auch eine Rolle. Ich verstand mich als Kind bestens mit älteren Frauen, und Frauen jenseits der dreißig waren für mich alle alt oder uralt, was sich noch lange hielt im Empfinden zu älteren Personen. Die Bäuerin war eine gläubige, praktizierende Katholikin und ging regelmäßig in die heilige Messe in der kleinen Kapelle, die zur Lungenheilstätte Kolonie gehörte. War ich bei ihr, wurde ich mich mitgenommen und dann gehörte sich, dass man neben einem Gebetsbuch, auch ein Rosenkranz haben musste. Den bekam dann von ihr geschenkt, denn nur damit konnte ich vermutlich würdig an der Messe oder den Gottesdiensten teilnehmen. Ich weiß noch genau, wie stolz ich darauf war, doch sicher mehr wegen der Glaskugeln oder Glasperlen und dem Kreuz, vermutlich wird es ein nettes Spielzeug für mich gewesen sein.
Forsthaus oben und Café Mooseck unten in Nordrach-Kolonie
Wenn ich heute auf meine Kinderzeit zurückblicke, wundere ich mich manchmal schon, an welche einfachen Details man sich noch erinnern kann. Da taucht eine Familie auf, aus der unmittelbaren Nachbarschaft zur Heilstätte und die hatten Bienen, die ihnen reichlich Honig bescherten. Auch sie gehörten zu den Menschen, die sich noch weitgehend selbst versorgten. Das Gemüse bauten sie im eigenen Garten an, dort gab es auch blühende Sträucher und Obstbäume, ebenso wie Ziegen oder Kühe im Stall und Hühner im Gehege hinter dem Haus. Auf dem Dachboden, der Bühni, lagerte der Heuvorrat für den Winter, das man im Sommer von den Wiesen ums Haus eingeholt hatte. Im Stall wurden Schweine gemästet und im Herbst gab es den Schlachttag, ein Fest für die Familien, und auch die Nachbarn bekamen etwas davon ab. Somit profitierten alle davon.
Die Küchenabfälle und Gartenreste brachte ich nicht nur ins Café Mooseck, sondern ich ab und zu auch zur Familie mit den Bienen. Denkbar ist, die Mutter bekam am Schlachttag dafür etwas Fleisch und Wurst und sehr wichtig und begehrt war in jenen Tagen das vielseitig einsetzbare Schweineschmalz. Butter war rar, deshalb verwendeten die Hausfrauen überwiegend Schmalz beim Kochen und zum Backen. Übrigens ist selbst hergestelltes Griebenschmalz mit etwas Salz ein sehr leckerer und energiereicher Brotaufstrich. Die hart arbeitende Bevölkerung vertrug in der Nachkriegszeit noch gut eine ordentliche Portion Fett, ohne dass man auf die schlanke Linie achten musste.
Wieder hatte ich vormittags einen vollen Eimer hingetragen und gebracht, dafür wollte mir die Oma eine Scheibe Brot mit Butter und Honig drauf auf den Weg mitgeben. Geschickt klemmte sie den frischen Brotlaib zwischen Busen und Arm und schnitt mit einem scharfen Messer eine dicke Scheibe runter. Das frisch-knusprige Bauernbrot hatte sie erst dick mit Butter bestrichen und wollte Honig draufgeben. Üblich war, Bauernbrot im vierzehntägigen Rhythmus zu backen und das machten natürlich die Frauen. Jede Bäuerin verstand sich gut auf dieses Geschäft und ihr ganzer Stolz war eigenes Brot. Jeder Brotlaib wog mindestens ein Kilo, hatte eine knusprige Kruste und war innen locker und luftig. Folglich fanden sich in einer geschnittenen Brotscheibe Luftlöcher wie beim Schweizer Käse. Damit der Honig nicht durchtropften konnte, brach die Oma aus einer zweiten Scheibe eine Krume heraus und stopfte das Loch, jetzt war gut, der Honig blieb, wo er sein sollte. Seelig ging ich damit heim und verspeiste genüsslich das leckere Brot, denn solche Köstlichkeiten bekam ich nicht jeden Tag geboten.
Blick auf Nordrach-Kolonie