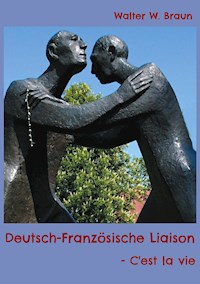Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Erzählung dieser Fiktion beruht auf einem tatsächlichen und außergewöhnlichen kriminellen Fall, der sich um das Jahr 1960 ereignet hat und über Wochen Tagesgespräch in einem Seitental des Mittleren Schwarzwaldes wurde. Viele Haushalte, Bauern, Handwerker waren unmittelbar betroffen und hinterher konnte sich niemand erklären, wie es dazu kam, dass ein einfacher Bauernknecht, der zu Hause eher "eine graue Maus darstellte", im Casino in Baden-Baden weltgewandt auftrat und in der Lage war, eine für die damaligen Verhältnisse riesige Summe Geld einzusammeln zu verspielen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Spektakulärer Kriminalfall im Kinzigtal
Beim Heinerbur im Untertal
Leben als Bauernknecht
Vergnügen in Baden-Baden
Tristes Alltagsleben
Eine zündende Idee
Eine günstige Gelegenheit
Ein Konto bei der Sparkasse
Großes bahnt sich an
Ein unvorhergesehenes Malheur
Eine unerwartete Geste
Ein Gerücht macht die Runde
Stille Teilhaber steigen ein
Riskantes Spiel mit höheren Einsätzen
Die willigen Geldgeber stehen Schlange
Ein schwarzer Sonntag
Das Glück kippt
Das Unheil bricht herein
Jetzt wird es eng
Nordrach bekommt unerwarteten Besuch
Die Mühlen der Justiz kommen in Gang
Das Urteil wird gesprochen
Epilog
Vorwort
In der 8. Klasse der Volksschule gehörte bei uns die Novelle „Kleider machen Leute“ des Schweizer Dichters Gottfried Keller zu den letzten Arbeiten im Fach Deutsch. Die Geschichte handelt von einem armen Schneidergesellen, der gut gekleidet in die Rolle eines Grafen gedrängt wurde und als Hochstapler endete. Doch es folgte ein Happyend, das im Leben nicht oft vorkommt.
Oder denken wir an den Schneider Wilhelm Vogt, dem es als „Hauptmann von Köpenick“ in Carl Zuckmayers Stück mit schicker Uniform und militärisch forschem Auftritt gelang, ein Rathaus zu besetzen und wo er danach alle an der Nase herumführte.
Hinterher stellte sich das Umfeld die Frage, wie es dem Protagonisten gelingen konnte, alle so zu übertölpeln. Wie konnte man sich von einem Menschen so täuschen lassen?
Die Gier nach Macht und Geld hat den Menschen immer schon die Sicht vernebelt und die Augen geblendet. So ist auch diese Fiktion zu sehen, basierend auf einem tatsächlichen außergewöhnlichen Kriminalfall.
Walter W. Braun
März 2015
1
Spektakulärer Kriminalfall im Kinzigtal
Die alteingesessenen Bewohner, die in den Seitentälern der Kinzig leben, sind bodenständige, tief im katholischen Glauben verwurzelte Menschen. Solange ich denken kann, wählten und wählen sie immer schon mit großer Mehrheit konservativ rechts. Nur Nordrach machte in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts zeitweise eine Ausnahme. Der Besitzer des Kurhauses im Dorf, Kurt Spitzmüller, kam 1954 über die Landesliste der FDP als Abgeordneter in den Deutschen Bundestag. Als Persönlichkeit des Ortes hatte er da natürlich einen nicht zu unterschätzenden Bonus, und das ganze Dorf war stolz auf seinen berühmten Bürger.
Die Bevölkerung im Tal ist von Natur aus „bockelhart“, wie man sie gerne beschreibt. Im 15. und 16. Jahrhundert waren die Nordracher noch dem Kloster Gengenbach verpflichtet. Ungern beugten sie sich der klerikalen Bevormundung und leisteten nur unter Protest die aufgezwungenen Abgaben. Zuvorderst die stolzen, wohlhabenden Bauern trotzten vehement der Knechtschaft. Und nachdem dann der Nachbarort Zell zur „Freien Reichsstadt“ und Unterharmersbach zum „Freien Reichsdorf“ erhoben wurde, was mit gewissen Privilegien verbunden war, wollten die Nordracher gleiche Rechte und Vergünstigungen für sich haben, was ihnen aber verwehrt wurde. So zogen sie in den Kampf gegen das mächtige Kloster und verloren. Ihre Aufmüpfigkeit und den rebellischen Geist, ihr Selbstbewusstsein, haben sie trotzdem nie verloren und aufgegeben.
Mitte des 18. Jahrhunderts existierte im ursprünglich noch selbständigen Ort „Kolonie“, weit hinten im Talschluss, eine bedeutende und gut florierende Glasfabrik. Die wichtigen Bestandteile Sand, Quarz und Pottasche fanden sich reichlich in der Umgebung, und die Wälder rundum sorgten für das Feuer in den Öfen. Nachdem aber der Wald abgeholzt und quasi im Glasofen verfeuert war, wurde der Betrieb eingestellt. Die Bevölkerung verarmte und man drängte Anfang des 19. Jahrhunderts mehr als 150 Menschen zur Auswanderung nach Amerika. Das Ziel war, die Hungerleider einfach nur loszuwerden.
Später erwarb Dr. Otto Walther die Gebäude der ehemaligen Glasfabrik und eröffnete 1891 eine Lungenheilanstalt zur Heilung von an Tuberkulose erkrankten Patienten, die anfangs vorwiegend aus England kamen. Im Jahr 1908 verkaufte er das Sanatorium an die Landesversicherungsanstalt Baden.
Eine Industrie gab es bis Mitte des letzten Jahrhunderts nicht im langgezogenen, engen Tal und nur wenige Ein-zwei-Mann-Gewerbebetriebe. Die größten Arbeitgeber waren somit die vier „Heilstätten und Sanatorien für Lungenkranke“, in denen Patienten wegen der Nebelfreiheit und der guten Schwarzwälder Luft, Gesundung suchten und fanden. Sonst gaben nur Bauern und wenige Handwerksbetriebe den Menschen Arbeit und Brot. Wer in der Landwirtschaft blieb, hatte ein hartes und entbehrungsreiches Leben zu erdulden. Die Besitzer der größeren Höfe dagegen waren dagegen durchweg sehr wohlhabend und traditionsbewusst.
Auf den steilen Feldern an den Hängen im Tal wurden Kartoffeln angebaut. Sie wurden nach der Ernte so gut wie in jedem Haushalt als Vorrat für den Winter eingelagert und dienten Mensch und Tier gleichermaßen zur Nahrung. Die Flächen mit Getreide waren dagegen bescheidener und dienten mehr dem Eigenbedarf. Das daraus gemahlene Mehl war die Grundlage für selbst gebackenes Brot und der andere Teil diente den Tieren im Stall als Futterbeigabe. Gemüse zogen die Bäuerinnen im eigenen Garten, wo es dank kräftiger Düngung mit Mist aus dem Stall, reichlich wuchs und gedieh. In den Ställen standen ein paar Kühe, und für die eigene Hausschlachtung züchtete der Bauer jährlich mehrere Schweine. Auch in manchem gewöhnlichen Haushalt wurde mindestens ein Schwein im Stall gemästet, das im Herbst Schlachtopfer wurde. Die Schlachttage wurden Feste für die ganze Familie, und selbst die Nachbarn profitierten ein wenig davon. In diesem Zusammenhang sei das im Tal traditionelle „Säcklestrecken“ erwähnt. Nach altem Brauch stellten überwiegend Jugendliche aus der weiteren Nachbarschaft am Schlachtabend eine lange Holzstange mit daran befestigtem Beutel laut klopfend an ein Fenster. Der Beutel enthielt einen handgeschriebenen Zettel, auf dem in gereimter Form ein gehöriger Anteil vom frisch Geschlachteten erbeten wurde.
Die Schlachtleute füllten den Beutel meist mit je einem Ring Schwarzwurst, Leberwurst, dazu noch ein paar Bratwürste, vielleicht auch etwas Kesselfleisch. Den Beutel befestigten sie wieder an der Stange und stellten sie dann vor das Fenster zurück. Die Hausleute – meistens waren es wiederum die jüngeren Burschen der Familie – legten sich auf Lauer. Wurde die Stange mit dem Beutel abgeholt, versuchten nun die Schlachtleute den „Säcklestrecker“ zu erhaschen. Gelang dies, hat man den oder die Ertappten mit viel Spott in die Küche geführt und dort bekam er einen Teller Metzelsuppe (Suppe mit Fleischbrühe nach der Wurstherstellung) vorgesetzt, und die musste der „Säcklestrecker“ mit auf dem Rücken gebundenen Händen mit dem Mund ausschlabbern. Das Spektakel sorgte natürlich stets für allgemeine Erheiterung, machte Spaß und brachte Gaudi ins Haus.
Die Nordrach, der durchs Tal fließende kristallklare Bach, ist links und rechts von Wiesen umsäumt und weiter oben schließen sich weitläufig Streuobstwiesen auf den waldfreien Flächen an, bis hin zu den Kastanien am Waldrand in den Höhenregionen. Überall stehen heute noch alte knorrige Obstbäume. Fast jeder Bauer besitzt ein überliefertes Brennrecht, brennt Kirschen, Zwetschgen, Rossherdepfel (Tobinambur) oder Zibärtle zu edlem Schnaps. Der Brennvorgang war und ist eine gängige Beschäftigung in den Wintermonaten, wo es außer im Wald Holz fällen und machen, früher auf den Feldern keine Arbeit mehr zu tun gab.
Neben ausreichenden Vorräten an Lebensmitteln aller Art für die Selbstversorgung, lagerten im dunklen Keller fast jeden Haushaltes mehrere Fässer mit selbstgemachtem Most, bekannt als Äppelwoi im Hessischen oder Cidre bei den Franzosen. Es ist vergorener Saft aus gepressten Äpfeln und einem Anteil an Birnen. Bier, Wein oder Mineralwasser wurde in jenen Jahren allenfalls oder ausschließlich, „in der Wirtschaft“, in einem der Gasthäuser im Tal, getrunken. Ausgenommen waren die jährlich stattfindenden dörflichen Feste. Zu solchen Gelegenheiten stand auf dem Dorfplatz hinter der Kirche ein Festzelt. Die im August im Kalender stehende Kilwi (Kirchweihfest) gehörte traditionell dazu, und jährlich gab es ein Musikfest auf der „Kornebene“, wohin es die Dorfbevölkerung in Scharen zog, sowie ein Fest, das abwechselnd die Feuerwehr, der Musik- oder Gesangsverein ausrichtete und deren Erlös die Vereinskasse etwas füllte.
Der Waldbesitz war eine wichtige Einnahmequelle und galt seit alters her „als Sparkasse des Bauern“. Heute machte er wegen der Klimaveränderung allerdings den Waldbesitzern ungewollt große Probleme. Doch einst sind manche Waldbesitzer damit „stinkreich“ geworden, wovon die prächtigen Schwarzwaldhöfe heute noch zeugen. Sie spiegeln den immensen Reichtum wieder, der nicht vom Ertrag der Felder kam. Die gerade und hochgewachsenen Schwarzwälder Tannen waren europaweit ein Begriff und sehr gefragt. Die bis zu 60 Meter messenden gefällten Stämme hat über die Nordrach, die Kinzig und den Rhein bis nach Amsterdam geflößt, und auch in Venedig sollen Häuser und Paläste darauf gebaut worden sein.
Schon Mitte des letzten Jahrhunderts kam ein neuer Erwerbszweig hinzu: Der Anbau von Weihnachtsbäumen in gepflegten größeren Kulturen. Die Vermarktung geschieht in der Adventszeit, wenn die Arbeiten auf den Feldern abgeschlossen sind und ruhen. Mit dem Verkauf der edlen und schön gewachsenen Nordmannstannen erschließt sich heute dem Bauern eine einträgliche und zusätzliche Einnahmequelle.
Im Harmersbach- und Nordrachtal finden sich überall stattliche Höfe, wie hier der Fürstenberger Hof in Zell-Unterharmerbach
Im Bannkreis dieser bescheidenen Lebensverhältnisse konnte wirklich niemand vermuten, dass sich in dieser Region Ende der 1950er-Jahre ein unglaublicher Kriminalfall zutragen würde. Kaum jemand, der über finanzielle Reserven verfügte, soll nicht involviert gewesen sein. Dabei sind die Badener im Grunde noch sparsamer als die Schwaben. Schon immer besaß fast jeder Haushalt einen gut gefüllten Sparstrumpf für alle Fälle. „Man weiß ja nie, was noch kommt“, ist die Devise. „De Gizhals hockt uf sim Geldbütel, seid'mer“ (Der Geizige sitzt auf dem Geldbeutel sagt man). Dabei überlegte es sich der eiserne Sparer zweimal, bevor er eine Mark – oder heute einen Euro – ausgibt.
Einem schlichten, eher etwas einfältigen Mann, war es gelungen, eine – für damalige Verhältnisse – unglaubliche Summe Geld einzusammeln, und die hat er im Casino, in der Spielbank in Baden-Baden verspielt. Über Monate wurde, nach dem Bekanntwerden, der Fall zum Tagesgespräch in den Tälern, und weit darüber hinaus, in den Gaststätten und bei allen möglichen Zusammenkünften. Niemand konnte sich hinterher erklären, wie sowas möglich wurde, und wer nicht direkt betroffen war, feixte offen oder heimlich vor Schadensfreude.
Aber nun erst einmal alles der Reihe nach.
2
Beim Heinerbur im Untertal
Wieder einmal kam ich mit dem Fahrrad zum stattlichen Anwesen des „Heinerburs“ Franz Spitzmüller im Untertal. Dies ist ein typischer Schwarzwälder Bauernhof, mächtig ausladend und mit tief heruntergezogenem Dach, unter dessen Schutz sich der riesige Speicher, und darunter die Wohnräume des Bauern, die Kammern der Mägde und Knechte befanden. Ebenerdig sind die Stallungen für Pferde, ein paar Kühe und ein Dutzend Schweine. Die davon ausgehende Wärme dient den darüber liegendem Wohnbereichen wie eine Fußbodenheizung. Von der Bergseite her kann man über eine Erdrampe direkt in die Scheune einfahren. Ringsum umgaben den Hof sattgrüne Wiesen, die im Frühjahr in allen Farben prächtig blühten und üppig saftige Kräuter für das Vieh lieferten. Auf den sanft ansteigenden Wiesen und den Feldern am Hang wuchsen verstreut ertragreiche Obstbäume aller Sorten. Die Äcker lieferten in jedem Jahr reichlich Kartoffeln, davon ein gewisser Teil an Tobinambur „Rossherdepfel“ genannt, sowie einige Hektar Getreide.
Das Tal ist hier relativ flach, übersichtlich und weitläufig, bis hin zur etwas mehr als zwei Kilometer entfernten Dorfmitte. Weiter hinten im Tal, etwa ab dem „Schrofen“ und in Richtung des Teilorts, der „Kolonie“, wird es enger, da steigt es links und rechts auf beiden Seiten steil an. Durch bewaldetes Gebiet, das sich mit Bergwiesen abwechselt, erreicht man die oberhalb verstreut liegenden Höfe auf dem „Kohlberg“ und im „Merkenbach“. Auf der anderen Bergseite finden sie sich im „Bärhag“, im „Stollengrund“, den „Flacken“ und schließlich im Höhengebiet „Mühlstein“. In diesen Höhenregionen wird bis heute nicht nur sehr weit abseits gelebt, sondern Landwirtschaft betrieben, zusätzlich Schnaps gebrannt, und da und dort Ferienwohnungen für „Urlaub auf dem Bauernhof“ angeboten; kurzum, es ist eine Bilderbuchlandschaft.
Der Heinerbur ist ein alteingesessener und allgemein umgänglicher Mensch, mitten im Leben stehend. Sein Hof gehört zu den Größten im Tal und entsprechend selbstbewusst gab er sich. Ihm zur Seite stand seine Frau, eine gestandene, kräftig zupacken Bäuerin, der zwei Mägde als Helferinnen zuarbeiteten.
Von zu Hause benötigte ich mit dem Fahrrad zwanzig Minuten um zu diesem Hof zu kommen, und von da weiter das Tal hinaus in die Stadt Zell waren es nochmals 5 Kilometer. Rückseitig des Anwesens steigt es leicht an, und der Weg führt durch den „Hutmacherdobel“ aufwärts zum waldfreien Gebiet im Gewann „Mühlstein“, zu den „Flacken“ und auf die Hochfläche „Haldeneck“. Über die Passhöhe „Mühlstein“ kommt man die „Schottenhöfe“, und von da Tal auswärts in den Hambach und nach Unterharmersbach oder Zell am Harmersbach. Hier ist man im etwas offeneren und lichtdurchfluteten Harmersbachtal angekommen. Dieses ist etwas mehr nach Südwesten ausgerichtet und genießt deshalb den Vorteil einer längeren Sonneneinstrahlung.
Wer die Geschichte des Schwarzwaldes kennt, dem ist der damals schon über 200 Jahre alte Hof „Vogt auf Mühlstein“ ein gängiger Begriff. Hier spielte die Tragödie mit dem Vogt, nach der Erzählung des Heimatschriftstellers und Pfarrers von Haslach, Heinrich Hansjakob, die er in seinem gleichnamigen Buch zu Herzen gehend schilderte. Wenn die Tochter des mächtigen und reichen Vogts Anton Muser – die Magdalena – mit wehem Herzen von ihrem Lieblingsplatz ins Tal sah, hatte sie unter anderem genau das große Anwesen des Heinerburs im Blick. Ob sie in ihrer Trauer, weil sie den Öler Joken, den sie liebte, nicht heiraten durfte, sondern dem reichen Hermesbur versprochen war, dafür aber einen Blick hatte, ist nicht sehr wahrscheinlich und auch nicht überliefert.
Immer wenn ich als Bub das Hofgelände betreten musste, näherte ich mich gewöhnlich sehr vorsichtig der Treppe und dem Eingang. In jenen Tagen brachte ich der Bäuerin einmal wöchentlich ein Exemplar „Heim und Welt“, eine Klatsch- und Tratsch-Zeitung, die auch gerne auf den Höfen gelesen wurde. Dazu musste ich über den weder geteerten noch gepflasterten Hofplatz laufen, immer auf der Hut vor dem allgemein an einer Leine angebundenen Hofhund. Nur manchmal lief das Biest frei herum, und hatte mich schon einmal in den Po gebissen, obwohl die Bäuerin in der Nähe war und laut nach ihm rief. Schon der Biss war für mich als 12-Jährigen sehr schmerzhaft, noch schlimmer empfand ich hinterher die Behandlung der fürsorglichen Bäuerin. Sie desinfizierte die Wunde mit Schnaps, was höllisch brannte und mir Tränen in die Augen trieb. Die 10 Pfennig Schmerzensgeld, die ich extra bekam, waren da ein geringes Trostpflaster.
Wenn ich zum Hof kam, waren der Bauer und sein Sohn eher selten anzutreffen. Wohl kannte ich die beiden nicht nur von meinen Besuchen oder gelegentlichen Aushilfen bei saisonalen Tätigkeiten, sondern auch von Begegnungen in den Gasthäusern „Kreuz“ und der „Stube“ im Dorf, wo sie sonntags an den Nachmittagen oder am Abend häufig einkehrten, und selbst im Gasthaus „Vogt auf Mühlstein“ habe ich sie schon sitzen sehen. Wochentags dagegen waren sie tagsüber vorwiegend auf den Feldern und pflügten mit einem Pferdegespann die Äcker um, mähten Grünfutter, ernteten Getreide oder rodeten die reifen Kartoffeln, und was es sonst auf einem großen Bauernhof im Mittleren Schwarzwald in der Zeit vom Frühjahr an bis weit in den Herbst hinein immer zu tun gab.
Im Stall standen ein paar Milchkühe. Schätzungsweise werden es wohl zwanzig gewesen sein, die der Bauer neben vier Pferden besaß, und dann gab es in einem anderen Stall die schon erwähnte Schweinemeute. Man sah auch ein paar Hühner mit ihrem Gockel und mehrere Gänse im Gehege. Natürlich rundeten ein separat stehendes Backhäusle und ein Libdighus (Leibgedinghaus, Alterssitz des Bauern) das Ensemble ab.
Unterstützt wurden Bauer und Sohn bei der Arbeit auf den Feldern von den Mägden, die sonst überwiegend der Bäuerin halfen und für die Versorgung der Wirtschaft (Küche, Waschküche) und das Melken der Kühe zuständig waren. Dann war da noch der Knecht namens Isidor Hermann. Sein Alter konnte ich damals nicht einschätzen. War er schon 60 oder erst 40 Jahre alt? Ich konnte es nicht einmal erahnen, und gefragt habe ich ihn nie. Er sah jedenfalls viel älter aus; nach meinem Empfinden eigentlich uralt. Meine Einschätzung bedeutete aber in diesem Zusammenhang wenig, denn für mich als Kind waren Menschen jenseits der 30 Jahre alle uralt. Dazu beigetragen hat wohl auch, dass ich den Mann immer nur im ungewaschenen, verschlissenen „Blauen Anton“ sah, mit über die Waden reichenden, stets schmutzigen Stiefeln an den Füßen. Wenn er sprach, verstand ich ihn schlecht, denn seine Aussprache klang verwaschen. Ursache war eine nicht behandelte „Hasenscharte“, die zudem sein Gesicht entstellte.
Im Grunde sah ich in ihm einen armen Tropf, so schien es zumindest für mich. Dabei wusste ich kaum etwas über den Mann, und außer über belanglose Dinge, oder was mit der Arbeit zusammen hing, kam ich mit ihm nie ins Gespräch. Wahrscheinlich war ich mit 12 Jahren auch kein akzeptabler Gesprächspartner für ihn, mit dem er sich groß austauschen wollte.
Im Dorf sah ich ihn nur sporadisch, was nicht ausschließt, dass er gelegentlich abends ausging, immer aber erst dann, wenn ich längst zu Hause war. Wurde er sonntagabends, an Feiertagen und den jährlich im Dorf stattfindenden Festen irgendwo angetroffen, dann trank er oft sehr viel, wurde gesprächiger und wirkte ein wenig aufdringlich.
Gelegenheiten gab es dazu öfters. Die Vereine hatten jährlich ihre Feste, und Fronleichnam war so ein Tag, wo das ganze Dorf auf den Beinen sein wollte. Dann gab es jedes Jahr im August die „Kilwi“, auch so ein Pflichttermin in der Region, wo die Bevölkerung aus allen Richtungen zusammenkam. Jeweils an einen bestimmten Sonntag wurde das Kirchweihfest in Nordrach gefeiert, eine Woche später in Oberharmersbach – im anderen Tal – und zuletzt in Unterentersbach bei Zell. Zu diesen Anlässen besuchte die Dorfbevölkerung, wenn irgendwie möglich, auch jeweils das Fest in den Nachbardörfern. In weiten Kreisen gab es verwandtschaftliche Bindungen untereinander und so sah man sich bei solchen Gelegenheiten wieder einmal. Andere kannten sich gut von den Bauernmärkten und freuten sich auf ein Wiedersehen, das dann stets gebührend begossen sein musste.
Tagelang wurde das Fest „St. Ulrich“ ausgelassen gefeiert, zu Ehren des Namenspatrons der weithin sichtbaren spätgotischen Kirche im Dorf. Dann traf man sich an Himmelfahrt, landläufig als „Vatertag“ bekannt. In der Regel bekamen Knechte und Mägde der Bauern an diesen Tag zumindest einige Stunden frei, und außerdem noch ein kleines „Zehrgeld“ (Taschengeld). Zum „Vatertag“ war allgemeines „Besäufnis“ angesagt, die Männer und Frauen trafen sich gerne in Gruppen, und das schloss die Mägde und Knechte nicht aus. Neue Beziehungen und Liebschaften bahnten sich an und die Flucht aus dem Alltag tat zwischendurch allen einmal sehr gut.
Die Feste begannen in der Regel am Freitagabend auf dem weitläufigen, befestigten Dorfplatz hinter der Kirche, auf dem dann ein großes Festzelt stand und sie dauerten bis Montagabend. In dieser Zeit gab es genügend Gelegenheiten für Treffen und zum Austausch von Neuigkeiten, für Klatsch und Tratsch und auch diverse Geschäfte wurden nebenbei getätigt.
Die spätgotische Kirche St. Ulrich in Nordrach
Da blieb nicht aus, dass sich Leichtsinnige auf ein ausgiebiges Zechgelage einließen, und gerne haben sich die Knechte und Mägde freihalten lassen und sie bekamen ein paar Gläser spendiert. So mancher Bauer oder Handwerksmeister gab sich bei solchen Gelegenheiten tatsächlich freigiebig und großzügig. Der Grund, die Spender zeigten gerne, dass man sich das leisten konnte oder sie führten einen anderen Grund im Schilde; mit Speck fängt man bekanntlich Mäuse.
Zu anderen Zeiten kam die Dorfbevölkerung vorwiegend am Wochenende in den Wirtschaften (Gasthaus) des Dorfs zusammen, der schon erwähnten „Stube“, dem „Kreuz“ oder etwas weiter talaufwärts die „Post“. In den Wirtschaften tranken die Männer ihr Bier, spielten „Skat“ oder „Cego“ und diskutierten über die große Weltpolitik.
Zum Gasthaus „Kreuz“ gehörte eine Kegelbahn, wo Gruppen, Mannschaften und Hobbykegler ihre Spiele und Wettbewerbe austragen konnten. Mit meinem Bruder oder mit Schulkameraden durften wir Buben dabei die Kegel aufstellen und ließen die Kugeln zurückrollen. Dafür bekamen wir eine Flasche „süßer Sprudel“, manchmal sogar ein Glas Bier spendiert, und meist noch 50 Pfennig, wenn die Spieler freigiebig und gut gelaunt waren.
Doch wieder zurück zu Isidor, dem Knecht vom Heinerburhof. Mit ihm hatte ich, wie gesagt, bisher wenig zu tun, außer, dass er mir hin und wieder über den Weg lief, wenn ich gerade der Bäuerin Zeitschriften brachte oder wenn ich beim Bauer aushalf und ich dort auf dem Hof etwas Geld verdienen konnte.
Nach Schulende oder in den Ferien war ich gelegentlich bei dem Bauern mit verschiedenen Arbeiten auf dem Hof beschäftigt, führte die Pferde oder Ochsen beim Pflügen, oder plagte mich beim Kartoffeln auflesen, die der Bauer mit dem Kartoffelroder aus dem Boden geholt hatte. Manchmal musste ich mit der Magd gemähtes Gras zusammenrechen, Heu machen und auf der „Bühni“ (Heuboden) einlagern. Das heißt, nachdem es auf den gemähten Wiesen getrocknet war, wurde es Bündel für Bündel mit einer Heugabel auf den Wagen aufgeladen. Zum Schluss kam oben über die Ladung eine massive Holzstange längs darüber, die nach zwei Seiten hinten und vorne mit dicken Seilen verspannt wurde, damit während der Fahrt nichts verloren ging. Während der Heimfahrt saßen die Mägde und wir Kinder stets oben im Heu auf dem Wagen. Zuletzt zogen die Pferde den mit eisenbeschlagenen Rädern, holpernden Wagen gemächlich zum Hof.
Dort angekommen, wurde der Heuwagen über die Rampe in die Scheune eingefahren, alles mit der Heugabel erst vom Wagen auf die Tenne abgeladen und dann im Heustadel aufgeschichtet. Wir Kinder nahmen die gereichten Heubündel ab, verteilten und verdichteten alles gleichmäßig, sowie mit den Füßen feststampfend. Das war eine ungemein staubige und schweißtreibende Geschichte, aber wichtig, damit erstens eine größere Menge auf der „Bühni“ Platz fand und zweitens das eingelagerte Heu gut durchlüftet blieb. Die größte Furcht der Bauern war eine Selbstentzündung, was durch Restfeuchtigkeit im Heu entstehen konnte. Früher kam das häufiger vor, besonders, wenn das Heu in einem verregneten Sommer übereilt eingebracht werden musste. Viele Höfe sind in der Vergangenheit schon deshalb in Flammen aufgegangen und bis auf die Grundmauern niedergebrannt.
Wenn ich beim Bauern auf dem Feld irgendwo arbeitete, sprach ich meistens den Knecht an, er antwortete dann karg und einsilbig. Von ihm aus kam selten etwas. Mit Kindern hatte er vermutlich nichts am Hut und konnte nicht mit ihnen umgehen. Das mag, wie ich von anderen hörte, damit zusammenhängen, dass ihn böse Buben im Dorf öfters hänselten, was wohl mit seinem Aussehen und Behinderung zusammenhing. Kinder können ja bekanntlich sehr direkt und auch grausam sein.