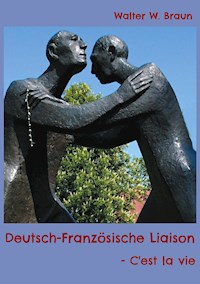Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Carpe Diem, nutze den Tag, sagt der Lateiner, und das gilt insbesondere im Blick auf die Endlichkeit des irdischen Lebens und jedes Individuums. Viele Zeitgenossen, die sich für den Nabel der Welt halten, scheinen das vergessen zu haben oder verdrängen es aus ihrem Bewusstsein. Wie oft wird die Vergänglichkeit des irdischen Lebens übersehen, im unbegrenzten Drang nach Vermehrung des eigenen Vermögens, in der Gier nach Macht, Ehre und Ansehen. In den Religionen, und nicht nur im christlichen Kontext, wird versucht, solchen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken, und man will den Menschen sensibilisieren, er möge doch ein wenig über den Tellerrand des begrenzten irdischen Daseins blicken. Schnell, und oft von einem Augenblick zum anderen, ist die Situation der Existenz völlig verändert, und wer nicht darauf vorbereitet ist, steht unvermittelt vor einem Scherbenhaufen oder streng genommen: vor dem Nichts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Geburt im Elsass
2 Gefahr am Wassergraben
3 Sturz vom Baugerüst
4 Tod eines Schulkameraden
5 Makabre Bemerkung…
6 Sterne im Schwimmbad
7 Ein Stumpen zum letzten Abschied
8 Mutprobe für den „Stift“
9 Blitzstart des Chefs
10 D’Bach na
11 Schock für die Familie
12 Der Smut gibt den Löffel ab
13 Lausbubenstreich
14 Jugendlicher Übermut oder Irrsinn?
15 Tragödie nach einem Fußballspiel
16 Anruf mitten in der Nacht
17 Hindernis auf der Autobahn
18 Vergebliche Liebesmühe
19 Unheilvolle Nacht
20 Denkwürdige Rückfahrt vom Spanienurlaub
21 Unerwartete Vorfahrtsverletzung
22 Rutschpartie im Schneefeld
23 Schreck in den Hohen Tauern
24 Unerfahren in den Dolomiten
25 Eine Begegnung der anderen Art
26 Epilog
Vorwort
„Carpe Diem“ – genieße oder nutze den Tag – sagt der Lateiner, das gilt insbesondere im Blick auf die Endlichkeit des irdischen Daseins und für jedes lebende Individuum. Viele Zeitgenossen, die sich für den Nabel der Welt halten, scheinen das zu vergessen, oder noch schlimmer, sie verdrängten es völlig aus ihrem Bewusstsein. „Heute lasst uns leben, denn morgen sind wir tot“, ist die gelebte Devise.
„Der Umgang mit dem Tod hat viele Ausprägungen – und ist im Wandel begriffen: Neue Bestattungsformen, eine Professionalisierung im Umgang mit dem Sterben und ein Aufgreifen von Vergänglichkeitsmotiven in der Mode sind Beispiele für einen veränderten Umgang mit dem Tod. Die Corona-Pandemie hat noch einmal auf globaler Ebene die eigene Vergänglichkeit vor Augen geführt. 1)
„Hat das durch die Pandemie geschärfte Bewusstsein, dass unser Leben zerbrechlich und von Krankheit und Tod bedroht ist, eine nachhaltige Wirkung? Hat die Pandemie die Menschen gar demütiger gemacht in der Erkenntnis, dass kein Mensch unsterblich ist?“ 2)
Wie oft wurde bisher die Vergänglichkeit des irdischen Lebens bewusst oder unbewusst ausgeblendet, im unbegrenzten Drang nach Vermehrung des eigenen Vermögens, in der Gier nach Macht, Ehre, Ruhm und Ansehen. In den Religionen – und nicht nur im christlichen Kontext – wird versucht, solchen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken, man will den Menschen sensibilisieren, er möge doch ein wenig über den Tellerrand seines begrenzt-irdischen Daseins hinausblicken. Schnell – und oft von einem Augenblick zum anderen – ist die Situation der realen Existenz völlig verändert, und wer nicht darauf vorbereitet ist, der steht unvermittelt vor einem Scherbenhaufen oder streng genommen vor dem Nichts. Der Volksmund sagt es schon: Das letzte Hemd hat keine Taschen. Verzweiflung, gesundheitliche Schäden, wie Depressionen, sind die Folge. Dagegen wirkt der Glaube an Gott und das „Ewige Leben“ in zwei Bereiche hinein. Er vermittelt einerseits eine lebendige Hoffnung, gibt Denkanstöße zur Konzentration auf das Wesentliche und andererseits mitfühlenden Trost bei Verlust, sei es eines werten Angehörigen und lieben Menschen oder existentiell materieller Art.
Jeder Christ sollte sich bewusst machen: Der Mensch, von Gott als „Krone der Schöpfung“ geschaffen und benannt, ist eine Einheit aus Leib, Seele und Geist. Stirbt er am Ende eines kurzen oder langen Lebens, vielleicht sogar erst im biblischen Alter, oder geht er völlig überraschend und unverhofft durch Krankheit, Unfall oder einem anderen tragischen Ereignis aus dieser Welt, wechselt er ultimativ nur in eine andere Daseinsform, was die Religionen als „geistige Welt, das Jenseits“ definieren. Nur der vergängliche Leib, die äußere Hülle, bleibt zurück und wird, nach göttlicher Bestimmung, „Erde zu Erde, Staub zu Staub“. Geist und Seele verbleiben mit allen angeborenen oder angenommenen Eigenheiten. Die Personalität des Menschen bleibt erhalten, mitsamt seinen Wünschen und Bedürfnissen, wie auch mit allen Erfahrungen, sowie das während seines ihm zugemessenen Lebenszeitraumes angesammelten Wissens. Nichts, rein gar nichts geht im Universum, in dieser Welt und grandiosen göttlichen Schöpfung endgültig oder für immer verloren. Materie, Energie bleiben dauerhaft erhalten, und die göttliche Schöpferkraft ist „Materie“ ist „Energie“ in einem unbegrenzten und unvorstellbaren Ausmaß. Wer gerne egoistisch sich als Mittelpunkt der Welt sieht, sollte einmal daran denken: Die unbeschreiblichen Dimensionen des Universums messen bis ans undenkbare Ende – wenn es das überhaupt gibt – fast 15 Milliarden Lichtjahre. Sprengt dieses Bewusstsein nicht jegliches Vorstellungsvermögen eines durchschnittlichen Menschen, und noch mehr der Gedanke, dass Milliarden Sonnensysteme existieren, gleich dem unseren, und unsere „Mutter“ Erde nur ein Staubkörnchen in der unvorstellbaren Unendlichkeit ist?
Wir begegnen heute zunehmend dem Phänomen der sogenannten „Helikopter-Eltern“, das sind solche, die in jedem Augenblick, in jeder Minute ihr Kind eng behüten wollen, ihm keine Luft mehr für kreative Entfaltung und Eigeninitiative lassen. Dadurch fehlen ihm individuelle Erfahrungen im Umgang mit möglichen und allgegenwärtigen Gefahren und wenn solche auftreten, folgt ein tiefer Fall in Depression und gefühlter Hilflosigkeit. Meine feste Überzeugung ist: Kein Mensch kann seinem Schicksal oder seiner Bestimmung entgehen oder ausweichen. Bei übertriebener Vorsicht, verbunden mit einer lähmenden Angst vor möglichen Gefahren, verpasst er möglicherweise nur die schönsten, die spannendsten Augenblicke und unvergesslichen Momente eines erfüllten Lebens. Gerade die sind es aber, welche uns als glückliche Erlebnisse in der Erinnerung haften bleiben, ins Gedächtnis eingraviert sind. Normales, alltägliches wird schnell, zu schnell, von der Aktualität überlagert und verliert sich rasch im Nebel des Vergessens. Mein Lebensmotto ist: „Es kommt nicht darauf an wie lange man lebt, sondern dass man gelebt hat.“ Und da schließt sich wieder der Kreis zum Beginn meiner Betrachtungen: „Carpe diem“.
1) Dr. Ulrike Neurath, BT 16.11.2021 Nr. 265
2) Nikolas Wisser, Kath. Pastoralreferent, Bühl, WO 24.11.2021
1
Geburt im Elsass
War es Schicksal, sollte es Bestimmung gewesen sein oder einfach nur purer Zufall? Diese Frage bewegte mich schon seit ich denken kann. „Du bist vierzehn Tage früher zur Welt gekommen als ursprünglich von der Hebamme berechnet worden war“, verriet mir die Mutter später, und das sollte sich schon kurz darauf für sie und ihre Angehörigen günstig oder als ein Glück und Segen – wie man es auch nennen wollte – erweisen.
In der schlichten, nicht beheizten Kammer unter dem steilen Dach eines kleinen Bauernhofes war es auch tagsüber immer leicht dämmrig-schummrig und während den kühleren Tagen der Herbst- und Wintermonate unangenehm klamm. Der Raum wurde nicht beheizt und das war in Nebenräumen damals weithegend überall so. Nur in der Wohnungstube gab es einen Kachelofen zum Heizen und in der Küche war auch immer warm, zumindest wenn gekocht wurde. Dort standen aber tagsüber immer Töpfe auf der Herdplatte, und im Herd gab es ein sogenanntes Schiff, in dem ein gewisser Vorrat an Wasser heiß gehalten wurde.
Seit Stunden fühlte sich Johanna – genannt Hanni – nicht sehr wohl, Schweiß perlte auf ihrer Stirn, obwohl ihr kalt war und sie fröstelte, trotz zwei kupfernen Bettflaschen, die ihr die Mutter Amalie unter die Decke ins Bett gelegt hatte. Sie zitterte und zwischendurch klapperten ihr sogar leicht die Zähne. Doch das hatte weniger mit der niederen Zimmertemperatur zu tun, sondern mehr mit dem, was der 20-Jährigen unmittelbar bevorstand. Unbehagen, Bangigkeit und Angst hatten sich bei ihr breit gemacht und das Herz klopfte schneller.
Die Tochter der Binoths, meine Mutter Hanni, war erst wenige Tage zuvor zwanzig Jahre alt geworden, damit war sie im Grunde noch eine Jugendliche, eine junge Frau. Nun zeigte sich aber die Geburt ihres ersten Kindes an. „Wenn doch das alles schon vorbei wäre. Warum habe ich mich in diesen unsicheren Zeiten auch nur mit einem Mann eingelassen?“ Zweifel kamen in ihr auf, jetzt half aber weder jammern noch klagen und auch kein beten, sie musste da durch und das aushalten, was vor ihr schon Millionen Frauen durchgemacht haben; einem Wunder der Natur, der Geburt eines Kindes. Ihre Mutter, die selbst fünf Kinder geboren hatte, versuchte sie zu beruhigen, strich ihr über die Stirn, tupfte den Schweiß ab und redete ihrer Tochter immer wieder gut zu, sie wollte ihr Mut machen. „Maidli, mr Schwarzwälder Buere sin üs hartem Holz g‘schnitzt, sott joo scho viel chumme, wenn’s üs umwerfe wott.“ (Mädchen, wir Schwarzwälder Bauern sind aus hartem Holz geschnitzt, da muss schon viel geschehen, bis wir umfallen).
Was zu dieser Stunde zur Unruhe und Unsicherheit beitrug war, die Wehen haben viel zu früh bei dem hochschwangeren Mädchen eingesetzt, und in immer kürzeren Abständen stellten sie sich wieder und wieder ein. Hanni wimmerte und schrie mehr aus lähmender Angst, denn wegen der Schmerzen: „Mami, sisch sowit, d‘Wehen chumme chli und chli. Go widli, hol duzwit d‘Hebamm.“ (Mami, es ist soweit, die Wehen setzen immer schneller ein. Geh und hole eilends die Hebamme). „He aber au, des sott doch no vierzehn Däg dure. Du hesch abr au durend Überraschige parat.“ (So was aber auch, das sollte doch noch vierzehn Tage dauern. Du hast aber auch immer neue Überraschungen parat). Mama Amalie schlug die Hände über dem Kopf zusammen. „Go, Mami, go, lauf widli, i han schieri Angst, wenn doch bloß d‘Willi do wär.“ (Lauf schnell, ich habe solche Angst, wenn doch bloß der Willi anwesend wäre).
Der so sehr vermisste Willi – im Südbadischen die Kurzform für Wilhelm – ist der Erzeuger und Vater des Ungeborenen. Schon längere Zeit verbrachte er in einer Einheit der deutschen Wehrmacht im Elsass, und wie. Über ihn wurde berichtet: „Er sei ein richtiger Draufgänger, ein echter Haudrauf.“ Sein Wahlspruch lautete – und den erwähnte er gerne bei passender oder unpassender Gelegenheit: „Tue recht und scheue niemand.“ Schon beim ersten Kennenlernen, das war bei einer Tanzveranstaltung anfangs des Jahres im Dorf, hatte er Hanni sehr imponiert. Der schneidige Bursche gefiel ihr auf Anhieb, und schon nach dem ersten „Techtelmechtel“ poussierten sie (gingen eine engere Verbindung ein, bis hin zu intimen Beziehungen). Schon in wenigen Wochen sah man sie als ein verliebt turtelndes Paar.
Für die zu diesem Zeitpunkt noch 19-jährige Hanni war es der erste Mann, mit dem sie sich hatte eingelassen und engere Kontakte pflegte, mit dem sie mehr als nur Händchen halten wollte. „Bis dahin habe ich immer nur mit meinen Brüdern zu tun und keinen Kontakt zu anderen jungen Männern gehabt“, verriet sie uns später.
Die junge Frau war hübsch, doch von Natur aus sehr zurückhaltend und eher „schüchtern“, zudem sehr sanftmütig und immer auf Harmonie bedacht. Ihre wahren Stärken lagen eher im geistigen Bereich. Trotz ihres jugendlichen Alters war sie sehr belesen, konnte viele Gedichte auswendig rezitieren. Besonders der Heimatschriftsteller Johann Peter Hebel hatte es ihr angetan. Er lebte in Hausen im Wiesental und das war quasi im Nachbarort ihres Dorfes, wo sie aufgewachsen war, die Kindheit und Schulzeit verbringen durfte. Eines seiner bekanntesten Gedichte: „Der Mann im Mond“, gefiel ihr besonders gut, und natürlich konnte sie es auswendig hersagen. Leider ließ sie der Vater nicht eine höhere Schule besuchen, und studieren war undenkbar. Stattdessen musste sie schon als Schülerin in der Landwirtschaft hart mitarbeiten und als Jugendliche erst recht. Dafür hatte sie dann – politisch gewollt – eine spezielle Ausbildung erfahren, und es auch sehr gerne und engagiert getan.
Getreu der „Blut-und Boden-Ideologie“ der Nazis bekam sie als BDM-Mädchen eine zweijährige Ausbildung zur Hauswirtschafterin im weit entfernten Odenwald. Dabei lernte die junge Frau mit einfachsten Mitteln schmackhafte Gerichte kochen. Dazu wurde alles verwendet, was die Region und der Garten so hergaben. Sie beherrschte bald perfekt das, was in einem Haushalt der 1940er Jahre wichtig war. Eine Frau, die nicht kochen, nähen, stricken und häkeln konnte, das war undenkbar, solche Kenntnisse gehörten wie das kleine Einmaleins dazu. Nach der Ausbildung wieder zurück im Dorf, half sie als fleißige unentbehrliche Kraft im elterlichen Haushalt mit, sie arbeitete im Stall und auf den Feldern. In der kleinen Landwirtschaft mitten im Dorf gab es jahraus, jahrein immer etwas zu tun und das ging manchmal von Tagesanbruch bis zu Dämmerung. Da blieb nicht viel Zeit für ein Techtelmechtel mit dem anderen Geschlecht oder das war meist nur auf die Wochenenden beschränkt und die wenigen Feiertage, die üblichen Feste im Ort oder der näheren Region.
In den unsicheren Zeiten des Krieges hielt man sich allerdings in den zwischenmenschlichen Beziehungen nicht lange mit Nebensächlichkeiten, mit platonischem Geplänkel auf. Mit einem oder zwei „Schmutz“ (Küsse) war Willi nicht zufrieden. Schließlich fühlte er sich im besten Alter und vollen Manneskraft. Das Mädchen war auch nicht aus Eis und erlag bald Wilhelms Werben, ließ sich verführen, und „bereits beim ersten Mal ist es passiert“, verriet die Mutter später. Sie war gleich schwanger geworden.
„Isch joo gued, ich go joo scho Maidli, un hol waidli d‘Hebamm, hoffentlich isch Madame Egeli au d’heim und ii treff sie do an.“ (Ist ja gut, ich gehe ja schon und hole die Hebamme, hoffentlich treffe ich sie auch zu Hause an), erwiderte besorgt Mutter Amalie und wollte ihre Tochter beruhigen. Sie hatte selbst fünf Kindern das Leben geschenkt und wusste genau, wie sich das in so einer Situation anfühlt und wie unkalkulierbar manches ablaufen könnte. Überraschungen sind nie ausgeschlossen. „I han scho d‘Gäul vor d’Apothek kotze g‘sene“ (Ich habe schon viele Überraschungen erlebt), war ein beliebter Ausspruch unter den Einheimischen.
Schnell legte Amalie ihre Kittelschürze ab und eilte aus dem Haus. „Neii, au so ebbis“, seufzte sie und schlug die Tür hinter sich ein wenig lauter zu, wie man es sonst von der zurückhaltenden herzensguten Bäuerin gewohnt war. Das zeigte, wie aufgeregt auch sie als Mutter und angehende Oma war. Eilenden Schrittes verließ sie die unbefestigte Hoffläche des kleinen Bauernhauses und ging mit kurzen schnellen Schritten in den Ort, schnurstracks die Straße abwärts und der Dorfmitte zu.
Die vergangenen Tage anfangs November des Jahres 1944 zeigten sich bisher schon ungemütlich, trüb-grau, nasskalt und dieser Samstag übertraf sie noch alle an Tristesse. Nein, bei diesen äußeren ungünstigen Umständen war das eigentlich kein günstiger Zeitpunkt für einen neuen Erdenbürger, ins Licht der Welt treten zu wollen. Das nasskalte Wetter war wenig geeignet, einen neuen Erdenbürger gebührend zu empfangen. Der Hochnebel hing wie eine Glocke im Rheintal, das Tageslicht ging am späten Samstagnachmittag schon früh in die blaue Phase über, die Temperatur stieg kaum über die Frostgrenze. Wer konnte, der blieb nach getaner Arbeit lieber im Haus, im Geborgenen, und dort möglichst nahe dem wärmenden Kachelofen. Nur ein paar ältere Männer saßen derweil am Stammtisch im Le Cheval Blanc, einer der Traditionswirtschaften im Ort, und sie diskutierten heftig und mit erröteten Wangen über die aktuelle explosive Weltlage, was das für das Elsass, ihrer Heimat, wieder bedeuten würde. Das heraufziehende Unheil hing explosiv wie ein drohendes Gewitter in der Luft. Das ewige hin und her der Meinungen gab zudem genug her, sich ausgiebig über den politischen Wirrwarr auszulassen, speziell was die Region des Sundgaus betraf. Seit der Französischen Revolution war der Landstrich links des Rheins ein Teil des Département Haut Rhin, nach 1871 gehörte man zu den Preußen und zum Deutschen Kaiserreich, dann nach 1918 wieder ein französisches Département. „Immer dieses hin und her, mr‘ sinn ab’r wed’r Franzose noch Dieschte, mr‘ sin Elsässer, mr‘ sinn scho immr Allemane gsi un des blibbe mr‘ au“, hörte man die eigensinnigen Häsinger sagen und einer bekräftigte das mit dem Schlag mit der Faust auf den runden Tisch aus massiver Eiche, dem Stammtisch mitten im Lokal. „Sell monn i au“, bestätigte dies einer.
Die jeden Samstag penibel sauber mit einem aus Birkenreisig hergestellten Besen gefegte Straße – wie es im Alemannischen, gleich den Schwaben üblich ist – führte leicht abwärts, und schon tauchte die das Dorf dominierende Kirche ins Blickfeld der Amalie. In deren Nachbarschaft befand sich das unscheinbare Haus der Egelis, das einmal im Baustil der Region erstellt wurde, wie viele Anwesen des Sundgaus im südlichen Elsass. „Wie das Amen in der Kirche“, gehörte unverzichtbar ein gepflegter Bauerngarten zu jedem der Traditionshäuser und er war der ganze Stolz und die Visitenkarte jeder tüchtigen Hausfrau. Dort im Haus wohnt die örtlich zuständige, sehr erfahrene und allseits geachtete Hebamme, Madame Helene Egeli.
Amalie Binoth klopfe laut pochend und aufgeregt an die Haustüre, dann noch einmal, nachdem sich im Hause nichts geregt hatte. Immer noch tat sich nichts, da lief sie unruhig geworden ums Haus herum, und siehe da, auf der Rückseite des Anwesens entdeckte sie schließlich die gesuchte Frau, die gebückt und mit umgebundener Kittelschürze im Hausgarten werkelte.
„Was bisch au so ufgeregt Amalie, wo um Gods Wille pressierts dr denn so? Ich will mr grad s‘Ligüm (Gemüse) fürs Sonntags-Menü b‘sorge. Sell will ich nochher moche, damit sundigs minner Jack ebbis gueds uf’m Disch steh het.“ (Warum bist du um Gottes willen denn so aufgeregt. Ich will mir gerade das Gemüse besorgen, das will ich nachher vorbereiten, damit morgen – am Sonntag – mein Jakob etwas Feines auf dem Tisch stehen hat). „Helene chumm scho, s‘pressiert, die Wehen hen bi mim Maidli, de Hanni, scho igsetzt.“ (Komm, es eilt, die Wehen haben bei der Hanni schon eingesetzt). „Amalie, ist ja gut, so schnell schießen die Preußen nicht. Aber d‘accord, geh schon mal voraus wieder heim, ich will mir nur schnell noch die Schürze ablegen, mich herrichten und mir die Hände gründlich waschen, dann komme ich schleunigst mit meinem speziellen Köfferchen nach. Das wird nur wenige Minuten dauern bis ich bei euch bin, versprochen.“
Da blieb kein Raum für Widerspruch. Die Egeli-Helene war eine herzensgute, doch aber auch eine resolute Frau; was sie sagte hatte Gewicht, das galt und da blieb kein Platz für Widerreden. Dafür hatte Amalie auch keinen Sinn und keinen Grund. Ihre Art war es auch nie gewesen, unnötige über eine Sache viele Worte zu verlieren.
Das aufgeregte Zwiegespräch hatte alles in allem nur eine, vielleicht waren es auch zwei Minuten gedauert, und nur wenig über eine Viertelstunde war vergangen, dann war Amalie wieder im am Ortsrand stehenden kleinen Bauerngehöft der Binoths zurück und zuhause. Die Kirchturm-Uhr schlug in diesem Augenblick laut vernehmlich 5 Uhr am Nachmittag.
Nur vereinzelt waren an diesem unfreundlichen Tag zu dieser Uhrzeit noch Menschen im kleinen elsässischen Dorf auf den Beinen und auf der Straße zu sehen. Entweder hatten die Frauen spätnachmittags die üblichen Verrichtungen im Stall zu tun, wo sie ihre Kühe versorgen mussten. Sie waren beim Melken oder füttern, andere – wie die Hebamme zuvor – kümmerten sich um die letzten Arbeiten im Hausgarten. In diesen Wochen machten sie allgemein ihre Gärten nach und nach winterfest, oder sie holten etwas vom winterharten Gemüse ein, wie Schnittlauch, Kraut oder Rosenkohl für das Sonntagsmenü. Solches Gemüse darf länger draußen im Acker bleiben, weil es durchaus Frost verträgt oder nach dem Frost noch schmackhafter wird.
Dagegen sah man kaum einen erwachsenen Mann im reiferen Alter im Dorf. Die männlichen Bewohner hatten sie ab 1942 entweder zum Dienst in der deutschen Wehrmacht gezwungen oder sie sind, weil sie davon nichts hielten, sich nicht einspannen lassen wollten und verweigerten, rechtzeitig geflüchtet. Sie hatten sich aus dem Wind gemacht, und sind irgendwo im Süden oder im Westen Frankreichs untergekommen. Ein paar waren von den Nazis auch eingesperrt worden, sie hatten den Kommunisten oder den Sozialdemokraten angehört oder laut an unpassender Stelle eine abweichende Meinung geäußert.
Die meisten Hausfrauen des Dorfes werkelten derweil am Samstagnachmittag in ihrer Küche. Sie schoben vielleicht gerade in der Kasserolle einen Sonntagsbraten in die Backröhre am holzbefeuerten Herd, oder einen selbstgebackenen Gugelhupf. Das elsässische Hefegebäck ist Kult und gehört immer schon unbedingt zur Kaffeetafel am Sonntagnachmittag. Nur die etwas betagte Meyer-Chantal ist Amalie unterwegs begegnet, der sie im Vorbeieilen zurief: „S’isch sowit, bi üsem Maidli hen d’Wehe igsetzt.“ (Es ist soweit, bei unserer Tochter haben die Wehen eingesetzt).
Wieder im Haus, des etwas außerhalb des Ortes an der Peripherie stehenden Hofes angelangt, huschte Amalie schnell durch die Haustüre nach innen. Drinnen knarrten hörbar die Dielen der hölzernen Stiege (Treppe), die ins Zimmer im Obergeschoss führte, während Amalie schon die Schreie oder das Stöhnen von Hanni vernahm. „Keine Sorge, Hanni“, versuchte sie ihre Tochter zu besänftigen und erneut zu beruhigen, „d‘Hebamm isch d’heim gsi un chummt glii, sii isch sicher glich do“, (die Hebamme war zuhause und wird gleich da sein).
Die kleine Gemeinde Häsingen (französisch: Hésingue), ist ein typisch unterelsässisches – damals rund 1500-Seelen-Dorf im Sundgau, ganz nahe der Schweizer Grenze. Die größere elsässische Stadt wäre Saint-Louis in der Nachbarschaft, deren Stadtgrenze unmittelbar bis an den Ort heran reicht.
Alles zeigte sich übersichtlich, ruhig und beschaulich, jeder kannte jeden. Der Sundgau ist sanft hügelig, überwiegend flach, die weiträumigen Felder und Wiesen schmiegen sich klimatisch begünstigt in den Schatten des mächtigen Grand Ballon, des Hausberges der Region – und einer von drei Belchen.
Ein weiterer Berg mit dem gleichen Namen gibt es in der Schweiz und einen anderen gegenüber im südlichen Schwarzwald. Nach der Theorie der Forscher geht der Name „Belchen“ auf die Praktiken keltischer Druiden zurück: Die fünf Berge sollen den hochgeachteten Priestern, Lehrern und Heilern bereits im zweiten Jahrhundert vor Christus als Sonnenkalender gedient haben. Es handelte sich nach dieser Auffassung um ein großräumiges Sonnensystem zur Bestimmung der Jahreszeiten. Betrachten wir die Lage der Belchen auf einer Karte, so lässt sich feststellen, dass der Elsässer Belchen, als auch der Schwarzwälder Belchen, sowie der Jurabelchen in einem rechtwinkligen Dreieck miteinander in Verbindung stehen. 3)
Warme Winde strömen vom Mittelmeer her durch das Rhonetal und Burgundische Pforte in den Rheingraben. Im Zusammenhang mit dem fruchtbaren Schwemmland vom einst mäandernden Rhein, begünstigte das schon seit alters her das Wachstum von allem, was auf den gutbearbeiteten Feldern fleißige Hände gesät und angebaut hatten. Die Ernten fielen damals üppig und ergiebig aus, und das ist sicher heute noch so. Diese äußeren günstigen Bedingungen hätten jedes Bauernherz erfreuen können, wenn nur der verdammte Krieg nicht gewesen wäre, der nun schon das fünfte Jahr andauerte.
Hier im Dreiländereck Schweiz, Frankreich und Deutschland spricht man „Elsässerditsch“ oder Hochalemannisch, ein Dialekt mit leicht schweizerischer Einfärbung. Freiheitliche Einflüsse bestimmten immer schon das Leben und die Kultur, und da sind sich die Menschen in den drei Ländern im Grunde sehr ähnlich. Unverkennbar ausgeprägt ist in der Bevölkerung der Wille nach Liberté und Laisser-faire – die persönliche Freiheit für jeden, und den Dingen ihren freien Lauf lassen – was ohne Frage mit der wechselvollen politischen Geschichte dieses Landstrichs zu tun hat.
„Nai hemmer gsaid“ (nein sagten wir), wurde zum geflügelten Wort, und war nie zu überhören, wenn dem Alemannen eine Sache nicht passte und über die Hutschnur 4) ging. Schon immer war die bodenständige, schaffige (fleißige) Bevölkerung unfreiwillig ein Spielball der Mächte und Politik. Über alles politische Geplänkel hinweg fühlen sie sich landsmannschaftlich untereinander eng verwandt und verbunden. Da gab es keine unüberwindlich kulturellen Unterschiede. Überdies, vom Staat an sich hielt oder erwartete sowieso kein Einheimischer viel – oder genauer gesagt – gar nichts. „Was soll schon von der Obrigkeit Gutes kommen?“, hörte man immer wieder das abschätzige Urteil. Diese einhellige Meinung fand sich sowohl im Elsass, als auch bei den Schweizer Nachbarn und erst Recht bei den zur Sturheit neigenden, „boggelhärten oder eigensinnigen“ Deutschen in Südbaden, dem südlichen Schwarzwald.
Bei nicht wenigen der Süddeutschen musste man allerdings in den Jahren nach 1940 durchaus gewisse Einschränkungen oder Abstriche bei der politischen Einstellung machen, denn es gab viele Sympathisanten, welche Hitler huldigten. Noch vor nicht allzu langer Zeit fuhr dieser durchs benachbarte Markgräflerland bei Müllheim, während Tausende an der „Chaussee“ standen und ihm links und rechts der Straße zujubelten. Sogar Elsässer wurden gesehen, die über den Rhein gekommen waren und „Heil Hitler“ schrien. Vielleicht hatte das Robert Wagner, Hitler willfähriger Statthalter, Gauleiter und Chef der zivilen Verwaltung, gewissen Kolonnen befohlen oder sie schlichtweg gegen Bezahlung jubeln lassen? Das Thema ist aber ein Kapitel für sich.
Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht im Jahr 1940 kam das Elsass unter deutsche Verwaltung. Die Binoths waren dann dem verlockenden Ruf der Regierung gefolgt, sie hatten einen verlassenen Bauernhof in dieser landschaftlich schönen und fruchtbaren Gegend zur Bewirtschaftung übernommen. Seit knapp fünf Jahren lebten sie nun inzwischen hier, hatten für den eigenen Bedarf an Milch und Butter zwei Kühe im Stall, zusätzlich zwei Ochsen, die überwiegend im Gespann bei den Arbeiten mit dem Pflug eingesetzt wurden. Ein Dutzend Hasen tummelten sich in den Stallboxen, und eine Schar Hühner mit stolzem Gockel scharrten und pickten im Hinterhof und zupfte Gräschen für Gräschen aus dem Boden.
Der mehrköpfige Binoth-Clan kam ursprünglich aus dem nicht weit entfernten Kleinen Wiesental im Südschwarzwald aus den kleinen Ortschaften Holl und Bürchau, am Fuße des Belchens. Rudolf Binoth war einer von fünf Brüdern, und nur der Jüngste erbte nach Schwarzwälder Tradition den Hof. Die anderen mussten sehen, wo sie bleiben. Sie arbeiteten als Knechte oder gingen in die Fabriken, in die Weberei im Kleinen Wiesental. Leider lernte ich von Opas Geschwistern in den späteren Jahren nur Onkel Max und Tante Frieda kennen, die in der Holl den ererbten Hof im typisch Schwarzwälder Stil bewirtschafteten. Von den anderen Geschwistern des Großvaters ist mir so gut wie nichts bekannt.
Ebenfalls fünf Kinder zählten zur Familie der Binoths, die ursprünglich mit den Eltern ins Elsass gewechselt sind. Die Älteste war Olga, inzwischen mit dem Bürchauer Albert Roser verheiratet und sie lebte mit dem Mann wieder in Bürchau. Die Rosers bewirtschafteten dort einen über 300 Jahre alten Bauernhof und besaßen auch einige Äcker und Wiesen und ein paar Hektar Wald.
Olga, die ältere Schwester von Hanni wurde später eine gute Köchin und ihr Sohn, mein Cousin, nach der Ausbildung und Stationen in bestens Häusern, sogar ein Spitzenkoch. Das Kochen lag also offensichtlich den Binoths schon in den Genen.
Nach dem Krieg haben die Rosers das stattliche Anwesen dann nach und nach zu einem angesehenen, weithin bekannten und renommierten Hotel aus- und umgebaut.
Zur Familie gehörte der Zweitälteste Arnold, der auch schon verheiratet war und mit seiner Frau in Maulburg bei Lörrach lebte, wo er später als Meister eine leitende Stellung in einem Textilunternehmen innehatte. Und das dritte Kind war Johanna – Hanni genannt – und nun seit fast einem Jahr mit dem Nordracher Wilhelm oder Willi liiert.
Ihr „Schatz“ wuchs im 2000-Seelen-Dorf Nordrach im Mittleren Schwarzwald auf. Mit 32 Jahren war er um einiges älter als die angehende Mutter, auch wenn Hanni inzwischen schon zwanzig Lenze zählte, und jetzt von Wilhelm ihr erstes Kind erwartete.
Dann waren da noch zwei jüngere Geschwister, die Mathilde und der „Benjamin“ Manfred. Der Jüngste befand sich gerade im schwierigen Teenageralter, oder andere sagen treffender „Trotzalter“ dazu, und der sollte den Vater noch richtig in Schwierigkeiten bringen.
Seit Kriegsbeginn tat Wilhelm als Freiwilliger seinen Dienst in der Wehrmacht und gehörte einer Funker-Einheit an. Dabei hatte er sich bisher schon als mutigen Draufgänger erwiesen. Dafür hatten sie ihn mit dem „Eisernen Kreuz“ 1. und 2. Klasse ausgezeichnet, und stolz trug er noch weitere Orden und Spangen an seiner grauen Wehrmachts-Uniform.
Doch zum beginnenden Herbst traf das Schicksal Wilhelm unerwartet hart. Zum Leidwesen von Hanni und der gesamten Familie ist er auf dem Heimweg verunglückt und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Vermutlich hat ihn ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug erfasst und überfahren. Der Schuldige flüchtete und konnte nie ermittelt oder gefasst werden. Vielleicht zählte so ein Unfall in diesen Tagen auch zu den Kollateralschäden, dem man nicht allzu viel Widmung schenken konnte. Schließlich gab es jeden Tag irgendwo Verletzte in den Gefechten und Scharmützeln des Krieges.
Seither lag aber Wilhelm mit schwersten Kopf- und anderen Verletzungen erst wochenlang im Koma im Lazarett, bis er wieder zu Bewusstsein kam. Trotzdem konnte bisher niemand sagen, ob er je wieder auf die Füße kommen würde oder überhaupt noch einmal vollständig gesund wird. Aus diesem Grunde war die vor Wochen geplante Hochzeit geplatzt, und nun sah Hanni ledig und mit sehr gemischten Gefühlen der Geburt ihres Kindes entgegen. Das alleine war schon keine gute Situation, um Glücksgefühle aufkommen zu lassen. Was sollte bloß aus ihr und ihrem Kind werden? Da konnte man ihre Sorgen gut verstehen. Niemand war in der Lage auf ihre Fragen und Ängste eine passende Antwort zu geben, und andere Probleme, die nicht weniger Sorgen bereiteten, klopften schon unüberhörbar an die Türe. Sentimentalitäten durfte sich in diesen Tagen wahrlich niemand leisten.
Nur wenige Minuten waren seit dem aufgeregten Klopfen der Amalie an Madame Egelis Haustüre vergangen, dann war die Hebamme auch schon bei den Binoths im Hof, trat durch die offenstehende Eingangstüre ein und stieg behände die Stiegen hoch. Wo Hanni sich befindet, wo ihr Bett ist, das brauchte ihr niemand zeigen oder sagen, sie war schon öfters da und hatte in der Schwangerschaft nach dem Rechten gesehen. Außerdem hörte sie schon bereits draußen auf der Straße das Schreien. Beim Eintritt ins Zimmer fand sie dann Hanni gekrümmt und mit verzerrtem Gesichtsausdruck im Bett sitzend vor.
Mit geübten Griffen tastete Madame Egeli den Bauch der Schwangeren ab, prüfte, wie das Kind liegt und hörte mit dem Pinard-Rohr (geburtshilfliches Stethoskop) die Herztöne ab. „Es ist alles bestens, Hanni“, bemerkte sie zufrieden, und wollte mit ihrem Hinweis ihr etwas die Angst nehmen. „Ab‘r Maidli, s‘dueret bschtimmt no e‘Wieli, bis des Kindli do sich, do muesch’di scho’no e’wengili g’dulde muese. Kumm, entschpann‘di, ‚swird alli nur halb so schlimm si, i‘bin jo bi’der un helf‘dr. Zsamme schaffe’mr des scho, schließlig isch’s bisher no bi‘ jedem Wiib guedgonge, die’i als Hebamme bedreud hen.“ Und der angehenden Großmutter Amalie gab sie den Auftrag: „Amalie, tauche ein Tuch in kaltes Wasser, damit ich damit der Hanni ein wenig die Stirn kühlen kann, und halte genug warmes Wasser auf dem Herd bereit.“
„Wenn doch bloß der Wilhelm da wäre, aber der liegt schon seit Wochen im Lazarett, und ich weiß nicht einmal, ob ich ihn je nochmals wiedersehe“, jammerte Hanni. „Jo Maidli, ich weiß, du hast schon ein arg großes Pech, bist so jung, und erst diese ungewollte Schwangerschaft in solch einer unsicheren Zeit, dann verunglückt dein Schatz auch noch bevor ihr heiraten konntet. Hoffen wir, dass noch alles gut ausgehen und sich bald einrenken wird.“ „Ja, und wenn doch nur der verdammte, elende Krieg schon zu Ende wäre, wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt. Die Nordafrikaner sollen schon im Anmarsch sein, das pfeifen die Spatzen von den Dächern.“
Die Gespräche der Frauen wurden erneut durch eine schmerzhafte Wehe unterbrochen, und Hanni schrie und wimmerte laut, dass es „Gott erbarmte“. „Komm, entspann dich, immer tief ein- und ausatmen und wieder ein- und ausatmen“, befahl die erfahrene Hebamme energisch: „Immer tief ein- und ausatmen.“ Dann rief sie der Mutter Amalie noch einmal zu: „Bring mir bitte Tücher und eine Schüssel warmes Wasser, ich will mir die Hände waschen.“ Sofort eilte die angehende Großmutter und holte, was die Hebamme wünschte. Warmes oder heißes Wasser gab es nur unten im Wasserschiff auf dem Herd in der Küche und sie hatte zusätzlich noch ein paar Töpfe auf die heiße Herdplatte gestellt, damit genügend bereit steht.
Bis nachts um halb eins mussten sich die Frauen gedulden, bis das Kind endlich da war. Nun lag ein strammer Bub auf der Decke und noch ungewaschen drückte ihn die Hebamme der Hanni auf den nackten Bauch. „Herzlichen Glückwunsch Hanni, du hast schon dein Weihnachtsgeschenk, es ist ein strammer Bube, dein Erstgeborener, und es ist sogar ein Sonntagskind“, wie sie beim Blick auf ihre Taschenuhr soeben feststellen konnte. „Freu dich, was wünschst du mehr? Es ist alles dran und der „Boppel“ sieht gesund und proper aus und wie kräftig der schon schreien kann.“ Die junge Mutter sank erschöpft in die Kissen. Noch gab es für die Hebamme einiges zu verrichten, und hinterher musste der Papierkrieg sein, dann verließ die Madame nach Stunden das Haus. Wieder hatte sie gute Arbeit geleistet und war mit sich vollauf zufrieden. Im Hause Binoth kehrte nach den langen, aufregenden Stunden, die bei allen Spuren der Müdigkeit hinterlassen hatten, jetzt auch endlich Ruhe ein, die restliche Nacht würde eh kurz genug sein, und schon erloschen alle Lichter im Haus.
Einschlafen hatte Hanni trotzdem sehr lange noch nicht können. Erst lag der kleine Bub an ihrer Brust und nuckelte, schlief dabei aber irgendwann ein, dann kreisten ihre Gedanken wie Wirbel im Kopf in der Sorge, was werden soll, was die Zukunft bringen würde. Das alles beschäftigte und beunruhigte sie, bis sie endlich einschlummerte und dann doch wenige Stunden Schlaf fand. Bis der Morgen dämmerte und es hell wurde, dauerte es zu dieser Jahreszeit zum Glück länger. Die winterliche Sonne ließ sich aber auch am neuen Sonntagmorgen nicht sehen. Dafür weckte der Bub lautstark seine Mutter und zeigte ihr deutlich: „Ich bin hungrig.“ Da war es 8 Uhr und Opa Binoth werkelte derweil schon seit zwei Stunden im Stall und kümmerte sich um das Vieh. Kinder und Küche, das war nicht sein Reich, da sollen sich die Frauen darum kümmern. So war das eben noch Mitte der 40er Jahre im letzten Jahrhundert.
Zwei Tage später, am folgenden Dienstag, ließ Opa Binoth seinen Enkel in der Mairie (Rathaus) registrieren und mit dem Namen Walter, Wilhelm eintragen. Warum Walter, habe ich nie erfahren und – ehrlich gesagt – ich war auch nie sehr glücklich damit, Wilhelm ging ja gerade noch, da mein Vater diesen Vornamen trug, oder der frühere Kaiser oder wer auch immer. Lieber hätte ich den Namen Hans oder Peter getragen, die man mit Hansi oder Pit hätte abkürzen können, Jakob, im Elsass als Jack abgekürzt, oder Rudolf, wie auch der Häsinger Opa genannt wurde – der Nordracher hieß Karl, wenn er da noch gelebt hätte – und später mein zwei Jahre jüngerer Bruder, den wir meistens Rudi riefen. Da ich aber zum Zeitpunkt dieser Aktion erst seit zwei Tagen zur Familie gehörte, hatte ich noch nichts zu melden oder zu wünschen, nach meiner Meinung, wenn ich schon eine hatte, bin ich nicht gefragt worden.
Und im Rathaus erfuhr mein Opa gleich auch die allerneuesten Nachrichten, die ihn sehr beunruhigten. Die neu formierte französische 1. Armee, vorwiegend besetzt mit den gefürchteten und rücksichtslos agierenden nordafrikanischen Soldaten, war durch das Rhonetal schon weit in die Burgundische Pforte vorgedrungen, und sie hinterließen in den Dörfern und unter der Bevölkerung Spuren der Verwüstung. Die schlimmsten Gerüchte über schreckliche Gräueltaten verbreiteten sich rasch: „Die Soldaten vergewaltigen die Frauen oder bringen sie gleich um. Was nicht niet- und nagelfest ist, wird gestohlen, mitgeschleppt oder hirnlos zerstört. Bekam eine Person einen wertvollen Ring nicht vom Finger, den ein Maghrebiner begehrte und haben wollte, wurde kurzerhand der Fingen abgeschnitten“, und so gingen die Berichte weiter. „Die militärische Vorhut soll die Stadt Besançon längst passiert haben und schon vor Belfort sein. Bald werden sie in Mülhausen (Mulhouse) einmarschieren oder über den Grand Ballon und Hartmannswillerkopf im Norden oder Altkirch im Süden auf Saint-Louis zustoßen.“ Das verhieß also nichts Gutes.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: