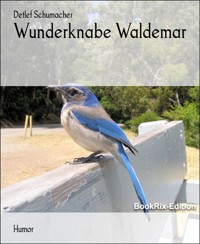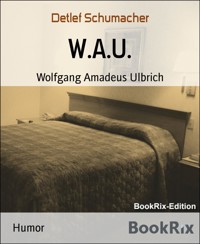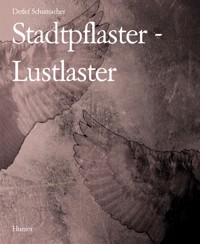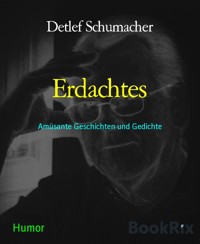0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Melanie ist die dritte der von mir erdachten Teenager-Figuren. Ebenso wie Sandra Sanddorn und Tabea Turtel gibt sie Einblicke in ihr noch junges Leben. Sie beschreibt jedoch nicht nur ihr Lebensumfeld, sondern richtet gegen Ende des Buches den Blick auf ihre Zukunft. Dabei lässt sie der Phantasie freien Lauf, die ihr helfen soll, als künftige Schriftstellerin akzeptiert zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Melanie
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenIch stelle mich vor
Ich heiße Melanie, bin weiblich und noch nicht volljährig - aber bald. Mit meinen Eltern und Großeltern bewohne ich ein Haus, das über mehrere Zimmer verfügt. Eins von diesen ist meins. Das Gebäude steht in einem Dorf, das zur Bundesrepublik Deutschland gehört. Es entstand vor vielen Jahren in Zusammenarbeit meines Vaters mit seinem Vater, also meines Großvaters, unter Einbeziehung meiner Mama und meiner Oma. Weitere Hilfskräfte waren Handwerker, die nach ihrem Feierabend mitwirkten und dafür zusätzlich entlohnt wurden. Die Finanzlage meiner Eltern war bald so geschwächt, dass sie einige Jahre von einem gemeinsamen Urlaub nur träumten. Ihr ganzes Sinnen war darauf gerichtet, den persönlichen Wohlstand zu mehren und irgendwann einen Trabant statt eines Kinderwagens zu fahren. Als das Haus errichtet war, gingen sie daran, mich zu schaffen. Beabsichtigt war ein Knabe, für den bereits blaue Babysachen gekauft waren. Auch sein Vorname war schon erdacht.
Als aber ich zum Vorschein kam, bekam mein Vater melancholische Anwandlungen. Aus diesen ergab sich mein Vorname. In gekürzter Form allerdings, denn eigentlich sollte ich Melancholie heißen.
Die Behörde, die für die Ablehnung oder die Zustimmung von Vornamen zuständig ist, raffte meinen Namen mit der Begründung, dass er unter sozialistischen Bedingungen tragbarer ist, weil er dem landwirtschaftlichen Produktionsbegriff Melioration näher steht als der reaktionären Seelenverklärung Melancholie.
Über die karge Zeit meiner Eltern weiß ich wenig. Was ich weiß, weiß ich vom Hören-Sagen. Mein Vater lobt sie als Diktatur des Proletariats, mein in München ansässiger Onkel Alois als Diktatur des Diktators Honecker. Ich weiß, dass Hitler ein Diktator war und meine Deutschlehrerin eine Diktatorin ist, weil sie Diktate diktiert.
Vielleicht hatten sich Honecker und Hitler die Macht geteilt. Deutschland war ja in zwei Teile gesplittet. Auf unserer Seite befand sich die DDR und auf der Alois-Seite der Goldene Westen. In ihm sollte es Bananen in Hülle und Fülle gegeben haben. Wenn Onkel Alois in Begleitung seiner Gattin Zenzi meine Eltern besuchte, brachte er einige dieser gebogenen Früchte mit. Wenn ich hin und wieder eine Banane verzehre, dann deshalb, weil ihre Vitamine vorzeitiges Altern verhindern helfen. Ansonsten verabscheue ich Bananen, weil sie so schnell schwarz und matschig werden. Unbegreiflich ist mir, dass man wegen dieser Früchte eine hohe Mauer in Berlin zerstörte und die DDR zugrunde richtete. Bananen sind aus meiner Sicht Genussmittel für Affen.
Mein nichtdeutscher Freund Örkan benutzte einmal Bananenschalen, um Personen zu Fall zu bringen. Das war als Scherz gedacht. Als man ihn als Verursacher ermittelt hatte, brach ein Sturm der Entrüstung los. Die Mehrheit der Dorfbevölkerung nahm Aufstellung vor der Unterkunft der Örkan-Eltern. Lautstark wurde die Ausweisung der türkischen Einwanderer gefordert. Zwei Jugendliche mit polierter Schädeldecke riefen: „Deutschland den Deutschen!“ und „Ausländer raus!“ Sie erhielten zahlreichen Beifall. Das ermutigte sie, mit Steinen nach dem Haus zu werfen. Dass dabei zwei Fensterscheiben zu Bruch gingen, störte sie nicht.
Mein Vater verlangte die sofortige Einstellung meines Liebesverhältnisses mit Örkan. Ich würde irgendwann ein Kopftuch tragen müssen, begründete er seine Forderung. Ich wies ihn darauf hin, dass Örkan kein Kopftuch trage. Er blieb unerbittlich, und so war ich vorübergehend wieder Single.
Es werden voraussichtlich noch weitere Ausländer in Deutschland eintreffen, tröstete ich mich. Vielleicht verliebe ich mich dann in einen Afro-Amerikaner. Als ich meinem Vater das zu verstehen gab, bekam er einen seiner berüchtigten marxistisch-leninistischen Wutanfälle. Zornig umkrallte er den Gipskopf Goethes, der auf seinem Schreibtisch steht und von seiner Intelligenz zeugen soll. Ich glaubte, er wolle ihn mir an den Kopf werfen. Das tat er aus väterlichem Verantwortungsbewusstsein heraus nicht, sondern brüllte, ich solle mich nach einem klassenbewussten Deutschen, notfalls einem sowjetischen Komsomolzen umsehen, mit dem ich eine unverbrüchliche Freundschaft eingehen könnte. Liebe würde sich später von selbst entwickeln. Ich linderte seinen Zorn mit dem Hinweis, dass in keiner Klasse unserer Schule ein sowjetischer Konsumbolze sitze. Es seien 75 % Einheimische und 20% Nichtheimische. Er stutzte, rechnete kurz und sagte dann, dass ich 5% unterschlagen habe. Die setzen sich aus Lehrern und pädagogischen Hilfskräften wie Reinigungspersonal und Hausmeister zusammen, machte ich die 100 voll. Er schloss seinen Wutanfall mit dem Satz „Proletarier aller Länder vereinigt euch!“ Ich bin also gezwungen, mich mit einem Proletarier zu vereinigen.
Arnfried
Ich sei sehenswert und begehrlich, meinte mein neuer Freund. Er war keines von beiden, entsprach wegen seiner kräftigen Statur aber den Vorstellungen meines Vaters. Der setzte ihn sofort für muskulöse Arbeiten im, am und ums Haus ein. Die Schule hatte Arnfried, so hieß er, bereits verlassen. Mit mäßigen Abschlussnoten. Das Leben verlange andere Fähigkeiten, nahm mein Vater seine geringe Intelligenz in Schutz. Dann schrie er „Aua!“, weil ihm Arnfried mit dem Hammer auf den rechten Daumen geschlagen hatte. Beide befestigten lockere Zaunlatten. Mein Vater dachte ergrimmt, dass Arnfried nicht alle Latten am Zaun habe, trotzdem sah er in ihm seinen künftigen Schwiegersohn. Von Kopf bis Fuß entspreche er dem Urbild eines Proletariers. Nach getaner Arbeit machte er ihn deshalb auch mit dem Genuss von Bier vertraut.
Meine Mama vertrat eine andere Ansicht. Die ließ sie jedoch nur mich hören. Sie könne nicht verstehen, weshalb ich mich in einen so unschönen und grobschlächtigen Kerl verliebt habe. Ich sei nicht in ihn verliebt, erklärte ich, ich habe nur Papas Wunsch entsprochen. Echte Liebe basiere auf dem Gleichklang zweier Herzen, die freiwillig und ohne Zwang zueinander gefunden haben, meinte Mama. Ob bei ihr und Papa Gleichklang herrsche, fragte ich. In der Anfangsphase ihrer Beziehung sei das so gewesen, behauptete sie. Da war auch noch nicht abzusehen, dass er mal bierschwanger sein wird und sein Haupthaar zurückweicht. Damit wollte sie unterstreichen, dass ihr künftiger Schwiegersohn hübsch sein müsse. Nur ein hübscher Mann könne hübsche Kinder zeugen.
Ob ich hübsch sei, wollte ich wissen. Töchter geraten in ihrer Erscheinung überwiegend nach der Mutter, stellte Mama ihre Reize über die Papas.
Im weiteren Verlauf unseres fraulichen Gesprächs stellte ich klar, dass ich an eine Heirat und ans Kinderkriegen nicht denke. Ich sei ja noch nicht volljährig. Ich wolle mir die Jungfernschaft so lange wie möglich erhalten und mich des Lebens freuen.
„Selbstverständlich“, beeilte sich Mama zu sagen, „das entspricht auch meinem Wunsch. Kindheit und Jugend sind die schönsten Momente im Leben. Genieße sie und lasse dich von Arnfried zu keiner frühreifen Handlung verleiten.“
„Den werde ich nur vorübergehend in Gebrauch haben“, beruhigte ich, „mein Interesse gilt einem bräunlich gefärbtem Jungen der 10. Klasse.“
„Wie bräunlich ist er?“, fragte Mama etwas entsetzt.
„Dunkelbräunlich, fast schwarz. Er wäscht sich aber jeden Tag. Meiner Freundin Susi, die ihn im Moment benutzt, hat er gestanden, dass er beschnitten ist.“
Das Entsetzen meiner Mama wuchs. „Was haben sie ihm abgeschnitten?“
Ich zuckte die Achseln: „Das weiß ich nicht. Ich werde Susi fragen.“
„Und den willst du zu deinem Freund machen? Wo kommt er denn her? Bei uns scheint doch nicht so oft die Sonne, dass er dunkelhäutig ist.“
„Er stammt aus Afrika. Da sind die meisten Menschen so gefärbt. Die kleinen Negerlein – das Wort darf man nicht mehr benutzen -, sehen ganz süß aus.“
Weil ich verzückte Augen machte, bat mich Mama händeringend, mir die geplante Freundschaft mit dem schwarzen Jungen gut zu überlegen. Vielleicht wolle ihn Susi auch gar nicht hergeben.
Ich hatte das Gefühl, dass Mama zehn kleine Negerlein als Enkelkinder nicht wolle. Vielleicht entwickle sich aus der Freundschaft mit Arnfried eine dauerhafte Liebe, meinte sie, unsere Unterhaltung abschließend.
Die ersten Zeilen des Liedes ‚Schwarz-braun ist die Haselnuss‘ singend verließ ich das Wohnzimmer. Ich begab mich in mein Zimmer, das früher Kinderzimmer hieß und nun die Bezeichnung Jugendzimmer trägt. In den Anfangsjahren meines Wachstums war es mit Kuscheltieren und Barbiepuppen vollgestopft. Als ich in mir die ersten Regungen zum anderen Geschlecht spürte, beklebte ich die Wände mit Postern von männlichen Stars. Meinem Vater missfiel das, und er riet mir, das Bild eines führenden Arbeiterführers aufzuhängen. Zum Beispiel Karl Marx. Warum ich den aufhängen solle, der sei doch schon tot, meinte ich.
Er sei über das verblassende Geschichtsbewusstsein der heutigen Jugend entsetzt, knurrte Papa und zeigte dem Poster der Kelly-Familie, die ihn freundlich anlächelte, die Rot-Front-Faust.
Möpsprall
Susi ist in ihrer Geschlechtsreife und Busengröße uns Mädchen voraus. Das weiß sie und nutzt das schamlos aus. Wir, die wir stolz darauf sind, dass sich unsere weiblichen Reize zaghaft entwickeln und bei den Jungen Aufmerksamkeit erregen, werden durch ihr unnormales Handeln emotional geschwächt. Doch wir setzen uns zur Wehr. Ein Anfangserfolg ist der hier: Gestern kam Betty Schminke, die so aussieht, wie sie heißt, ganz aufgeregt zur Schule. Sie wolle uns etwas Erfreuliches mitteilen. Neugierig steckten wir vierzehn- bis sechzehnjährigen Mädchen die Köpfe zusammen. Betty tuschelte uns zu, dass ihre Brust innerhalb einer Woche 2 cm zugenommen habe. Wir wollten ihr das nicht glauben. In einem so kurzen Zeitraum sei das nicht möglich. Doch, doch, beharrte sie auf ihrer Behauptung und zeigte uns mit einem Lineal, wie groß zwei Zentimeter sind.
„Mit oder ohne Brustwarzen?“, wollte Katy Schmal, die Schmalbrüstigste, von uns wissen.
„Natürlich ohne“, zeigte sich Betty stolz. „Wenn das so weitergeht, werde ich einen Büstenhalter tragen müssen.“
Wir waren ein bisschen neidisch, am neidischsten Katy. Wie Betty dieses Wachstum in so kurzer Zeit beschleunigt habe, war ihre verständliche Frage.
Die antwortete: „Mittels einer Flüssigkeit, die die Bezeichnung ‚Möpsprall,‘ trägt. Ich hatte im Internet die Frage eingegeben: Wie vergrößert man eine weibliche Brust? Verschiedene Möglichkeiten wurden genannt. Die wirksamste, mit sechs Sternchen versehen, war, einen Mann täglich zwei Stunden die Brust massieren zu lassen. Das kam für mich natürlich nicht in Frage. Welchen Mann sollte ich mit dieser Aufgabe betrauen? Mein Vater würde das bestimmt nicht tun. Ganz zufällig entdeckte ich die Empfehlung einer Firma, die nach eigenen Angaben hundertprozentiges Wachstum in kürzester Zeit garantiere. ‚Möpsprall‘ sei eine vielfach erprobte Essenz. Täglich drei Tropfen auf einen mit Zucker gefüllten Teelöffel tröpfeln und dann einnehmen. Aus Gründen der Geheimhaltung der Zusammensetzung werden diesbezügliche Angaben nicht gemacht, ist auf dem Beipackzettel zu lesen. Der Preis von 50 Euro für dieses Fläschchen komme eigentlich einem Geschenk gleich. Ganz am Schluss wird mitgeteilt, dass ‚Möpsprall‘ die eingetragene Schutzmarke für ‚Pralle Möpse‘ sei.“
Betty japste ganz glücklich und fuhr fort: „Ich habe mir ein Fläschchen ‚Möpsprall‘ schicken lassen. Die Bezahlung überlasse ich meinem Vater, dessen Konto per PayPal etwas belastet wird. Der bestellt bei Amazon so viel, dass er nicht merken wird, dass ich seine Finanzen ein wenig erschüttert habe. Seit Erhalt des Fläschchens habe ich 21 Tropfen eingenommen. In sieben Tagen 2 cm Wachstum, das ist doch erfreulich.“
Katy, anerkannte Schnellrechnerin, errechnete, dass ihre Brust in einem Jahr die Größe von 104 cm betragen würde, wenn sie ‚Möpsprall‘ einnehme. Sie bedauerte jedoch, dass sie das Konto ihres arbeitslosen Vaters nicht belasten könnte.
Jede errechnete nun ihre in einem Jahr erreichte Brustgröße unter Hinzuziehung der bereits vorhandenen. Ich kam auf 109 cm. Allerdings, so stellten wir uns dann die Frage, wie wir einen solchen Brustumfang unterbringen sollten. Büstenhalter in dieser Größe gibt es nicht. Wir hätten zwar Dolly Busters Silikonbusen überrundet, würden an unserer Last aber schwer zu tragen haben.
Betty beruhigte und sagte, dass pro Monat zehn Tropfen eingenommen werden sollten, die ergäben ein ungefähres Wachstum von einem Zentimeter. Bei 12 Monaten wären das insgesamt 12 cm. Die Größe sei normal, passgerecht für einen BH und eine Männerhand. Mit ihr würden wir auch Susis Aufmerksamkeit erregen.
„Nur ich nicht“, bedauerte Katy.
„Kein Problem“, ergriff ich das Wort. „Ich verpflichte mich, von meinem Taschengeld zehn Euro zu opfern, um deine Möpse wachsen zu lassen.“
In Katys Augen traten Tränen der Freude. Die begannen zu rinnen, als die anderen Mädchen ihren finanziellen Beitrag nannten. Als Susi von unserer Solidarität erfuhr, war sie keinesfalls bereit, sich finanziell zu beteiligen. Sie zeigte sich verärgert, auch deshalb, weil wir ihr den Namen der Wundertropfen nicht nannten. Nun bleibt abzuwarten, ob ‚Möpsprall‘ wirklich Wunder wirkt oder unseren Brustansatz verkümmern lässt.
Wünsche
Ein wichtiger Bestandteil der Familie sind die Großeltern. Sofern sie noch leben, sind sie sehr nützlich. Sie tragen wesentlich zur Erfüllung eigener Wünsche bei. In meinem Falle heißt das, dass sie gebefreudiger sind als meine Eltern. Die zeigen sich oftmals knausrig, wenn sie ein Bedürfnis ihres einzigen Kindes erfüllen sollen. Sie betonen zwar immer wieder, wie lieb sie mich haben, doch die Realität sieht anders aus. Vor allem mein Papa ist ein echter Geizkragen. Eigentlich müsste er meine Wünsche von meinen Lippen ablesen. Wenn er auf sie mal guckt, äußert er ärgerlich, dass ich mich vom Lippenstift fernhalten solle. Vor allem von dem meiner Mutter. Ich sei zu jung, mich farblich zu verunstalten. Ich sagte ihm, dass Küsse besser schmecken, wenn sie von geschminkten Lippen kommen. Ob ich ihn davon überzeugen solle. Ich sei wohl verrückt, meinte er, sich ängstlich umblickend. Wenn das jemand sehe, glaube er, der Vater treibe es mit der Tochter. Für diese Unzucht käme er Jahrzehnte hinter Gitter.
„Als ich jünger war, hast du mich oft geküsst: auf Stirn, Mund und selbst den Bauchnabel. Sogar in Mamas Beisein“, erinnerte ich ihn.
„Als ich diese Liebesbekundungen von mir gab, warst du noch nicht schulpflichtig.“
„Ach so“, fragte ich, „das Küssen eines Kleinkindes hätte dich nicht hinter Gitter gebracht?“
„Dieses Küssen gehört zum Pflichtprogramm eines jungen Vaters.“
Meine Mama hingegen küsst gern. Vor allem auch Personen, die nicht zu unserem Verwandtenkreis gehören. Wenn sie dabei versehentlich die Lippen eines fremden Mannes erwischt, entschuldigt sie das mit dem zufälligen Fehlen ihrer Kontaktlinsen.
Als ich sie dabei einmal überraschte, erklärte sie, dass mir ihr Falschkuss als Beispiel dienen solle, wie ich mich nie verhalten soll. So bliebe meine reine Mädchenseele von Lastern frei. Ich versprach, so zu werden wie sie und außerehelich nur Männer zu küssen, die mir zufällig an die Lippen geraten.
Zurück zu meinen Großeltern und deren Güte. Um sie mit meinen Wünschen nicht zu überlasten, denn Mama und Papa sollen sich nicht übergangen fühlen, habe ich meine Wunschvorstellungen in zwei Gruppen eingeteilt. Zu der einen, die den Geldbeutel weniger belastet, gehören meine Eltern; zu der anderen mit finanzieller Mehrbelastung meine Großeltern.
Da ich ein penibler Mensch bin, nehme ich die Eintragungen in der entsprechenden Liste sehr sorgfältig vor. Zwei Beispiele sollen das belegen. Habe ich von meinen Eltern 5 Euro erbeten, um mir wieder einige Süßigkeiten leisten zu können, denn ich bin eine richtige Naschkatze, dann vermerke ich diese Summe mit dem Datum des Erhalts in genannter Liste. Meinen Großeltern darf ich mit 5 Euro nicht kommen. Die würden sie als Beleidigung auffassen. Ihre Rente ist zwar nicht üppig, doch ausreichend, ihrer Enkeltochter ausgefallene Wünsche zu erfüllen. Hierzu gehört die Anpassung meines Outfits an die aktuelle Teenie-Mode. Ich würde mich zum Gespött meiner Mitschülerinnen machen, wenn ich in bäuerlicher Kluft und nicht in Markenklamotten daherkomme. Die kosten natürlich ein Sümmchen. Auch das erfasse ich mit genauem Erhaltsdatum in der Liste.
Eine diesbezügliche Finanzierung rief einst ein kleines Missverständnis hervor. Oma wollte wissen, welches Bekleidungsstück ich zu kaufen gedenke. Ich antwortete, dass es eine Jeans sein soll. Sie hatte verstanden, dass es eine von James Dean sein soll. Mit dem Begriff James Dean konnte ich nichts anfangen, weshalb ich konkret erklärte, dass es eine Mustang sein wird.
„Kuhstank?“, fragte Oma, sich beide Hände hinter die Ohren haltend. Etwas lauter wiederholte ich die Jeansmarke und fügte hinzu, dass eventuell austretende Darmdüfte der Hose rasch entweichen können, weil sie zerschlissen sein wird.
„Beschiss…“.
„Zerschlissen, Oma“, korrigierte ich laut, „eine Hose mit Löchern und Schlitzen.“
Nachdem sie diese Erklärung geistig verarbeitet hatte, wunderte sie sich, dass nun auch Lumpen wieder in Mode seien. Nach dem II. Weltkrieg hätte sie solche getragen. Die Löcher und Schlitze wurden allerdings notdürftig gestopft.
Ob wieder ein Krieg geplant sei, wollte sie wissen. In Deutschland nicht, erwiderte ich, denn hier hat eine friedfertige Frau das Sagen. Angela Merkel wird auch weiterhin Putin die Stirn bieten oder sie küssen.
Zwei Zauberwörter
Meine Eltern erachten es als ihren größten Erziehungserfolg, dass ich „Bitte“ oder „Danke“ sage, wenn es erforderlich ist. Als ich einem geäußerten Wunsch zum allerersten Male das Wörtchen „Bitte“ voranstellte, waren sie außer sich vor Freude. Meine Mutter eilte glücksstrahlend in den Tante-Emma-Laden, das einzige funktionierende Geschäft unseres Dorfes, und teilte den anwesenden Klatschweibern diese vier Buchstaben mit. Ich war zu diesem Zeitpunkt fünf Jahre jung. Mein Vater verhielt sich zurückhaltender; er verinnerlichte seine Freude mit einigen Flaschen Bier.
Meine Großeltern schenkten mir einen Puppenwagen mit inliegender Barbiepuppe. Als ich dafür „Danke“ sagte, fiel Oma in Ohnmacht und Opa goss sich zwei Schnäpse hinter den Knorpel.
Man mag es kaum glauben, aber diese beiden Wörter revolutionierten das Erziehungswesen in unserem Dorf. Die Familien wetteiferten miteinander, welches eigene Kind die beiden Zauberworte ebenfalls in den Sprachgebrauch übernimmt. Die Knaben zeigten sich beim Erfassen schwerfälliger als die Mädchen. Eine typische Erscheinung, die bis ins Mannesalter reicht.
Der Wetteifer nahm allerdings unerfreuliche Züge an. Einige Eltern zeigten sich in der Hervorhebung ihres Kindes so verbissen, dass es nebensächlich wurde, ob es tatsächlich die Wörter „Bitte“ oder „Danke“ beherrschte. Es kam zu Streitigkeiten, die in einigen Fällen mit Fäusten ausgetragen wurden. Die kinderreiche Familie Popp behauptete sogar, drei ihrer zwölf Kinder hätten schlagartig das Wortmaterial zu ihrem Umgangston gemacht. Eines der drei Genannten war erst ein Jahr alt. Weil die Popps wegen ihres Kinderreichtums staatlichen Schutz genießen und ihr Weiterpoppen durch Gewalteinwirkung nicht beeinträchtigt werden darf, schluckte man deren Falschbehauptung zähneknirschend.
Bald war es soweit gekommen, dass sich die Kinder des Dorfes mit „Bitte“ und „Danke“ vernünftiger zeigten als die Eltern. Die lagen sich nicht nur in den Haaren, sondern riefen sich auch unflätige Worte zu, verwüsteten gegenseitig die Vorgärten und vergifteten in drei Fällen einen Hund und zwei Katzen.
Als diese Ausschreitungen das polizeilich genehmigte Höchstmaß überschritten, sah sich der Ortsbürgermeister gezwungen, eine öffentliche Einwohnerversammlung einzuberufen. In der kam es, wie nicht anders zu erwarten, zu hitzigen Debatten. Die gerieten schließlich so aus dem Ruder, dass nicht mehr festgestellt werden konnte, weshalb man sich hier stritt.
Einige übereifrige Ehefrauen warfen sich vor, den Ehemann verführt und zur Untreue gezwungen zu haben. Als die Fensterscheiben des Versammlungsraumes zu Bruch gingen und einige geworfene Blumentöpfe die Köpfe der Anwesenden erreichten, forderte der Bürgermeister per Notruf die Polizei an. Die rückte mit zehn bis an die Zähne bewaffneten Bullen an, die die erschrocken innehaltenden Versammlungsteilnehmer mit schussbereiter Maschinenpistole umzingelten.
Da ein Polizeieinsatz der übergeordneten Dienststelle als Erfolg gemeldet werden muss, knüppelte ein Bobby den betrunkenen Adolf Hiller nieder, der laut gelallt hatte: „Heil – hupp – ihr – hick – Nazischergen!“
Wäre dieser demokratiefeindliche Ausruf gütig hingenommen worden, wäre der ganze Tumult recht bald vergessen gewesen sein und die Bürger unseres Dorfes wären wieder die geworden, die sie mal waren.
Ein hinterhältiges Subjekt hatte den Aufruhr aber an die große Glocke gehängt. Wie sich erst später herausstellte, war der Verräter ein ehemaliger Informant der Staatssicherheit der DDR.
Kaum also war des Volkes Aufbegehren über die Grenzen unseres Dorfes hinaus bekannt geworden, erschien ein Journalist der Bild-Zeitung und befragte einige Senioren, die geistesabwesend auf der Bank unter der alten Dorflinde saßen. Am nächsten Tag prangte auf dem Titelblatt der Bild in großen schwarzen Lettern die Überschrift Mord und Totschlag in Trottelsdorf!
Trottelsdorf ist der Ort, in dem ich beheimatet bin. Es lässt sich denken, dass sofort auch die anderen Medien auf uns aufmerksam wurden. In Scharen drangen sie in unser Dorf, interviewten und filmten jeden und jedes mit der Absicht, die Bild-Zeitung an Übertreibung zu übertreffen. Dass die Auslöser dieses Spektakels zwei kleine deutsche Höflichkeitswörter waren, blieb ungenannt, da unbekannt.
Erst nach Wochen hatten sich die Wogen geglättet und still ruhte wieder der Dorfteich.
Die gute alte Zeit
Unser Dorf ist wesentlich kleiner als Berlin, Hamburg oder Köln. Es weist auch eine geringere Einwohnerzahl auf, die durch den sexuellen Fleiß der Eheleute Popp nicht wesentlich erhöht wird.
Das ganze Gegenteil macht sich bemerkbar, denn manche junge Leute verlassen unseren Ort, weil er ihnen zu dürftig geworden ist. Lohnenswerte Arbeitsstellen mit zufriedenstellender Lohnzahlung bietet er nicht mehr.
Die Alten schwärmen von der Zeit, als hier noch verschiedene Handwerker ihr Handwerk ausübten.
Selbst der Sargtischler konnte sich über Kundenmangel nicht beklagen. Einige Kleinbetriebe waren sogar doppelt vorhanden, so zum Beispiel Bäcker, Schmied und Bauunternehmer. Die Jugendlichen, die nach sechs- oder achtjähriger Schulzeit die Schule verlassen hatten, konnten im Dorf bleiben und mussten sich nicht in der weiten Welt nach einer Lehrstelle umsehen. Nur zwei von ihnen gingen auf die Walz, wie man die Wanderjahre nannte, und kehrten nach drei Jahren mit beträchtlicher praktischer Erfahrung und mit Syphilis zurück. Die Bindung an die eigene Scholle, denn die verbreitetste Tätigkeit war die landwirtschaftliche, hielt Söhne und Töchter der Groß- und Kleinbauern sowie die der Landarbeiter hier fest. Ihr geistiger Horizont reichte nicht über die Ackergrenzen hinaus. Nur einmal im Jahr verließen die jungen Männer Haus und Hof und begaben sich zum Nachbardorf, in dem Kirmes gefeiert wurde. Hier kamen sie in Kontakt mit anderen Jungfrauen, die anschließend keine mehr waren. Diese körperlichen Annäherungen wurden jedoch mit großer Schlagkraft von den Burschen des Nachbardorfes unterbunden, weil es denen missfiel, dass in ihren sexuellen Machtbereich eingedrungen wurde. So blieben die Zeugungen auf unseren Dorfbereich beschränkt. Das Ergebnis waren in einigen Fällen Kinder, die als geistige Tiefflieger eingestuft wurden. Bei Dreien von ihnen wusste man nicht einmal, ob man ihnen einen Mädchen- oder Jungennamen geben sollte. Körperliche Verformungen gab es auch. Die geistesschwache Elsbeth hatte einen überlangen Hals, nur etwas kürzer als der einer Giraffe, und konnte den nach allen Seiten hin drehen. Man nannte ihn Korkenzieherhals. Mit ihm vermochte sie, ohne Körperdrehung nach hinten zu sehen. Das brachte ihr weltweite Berühmtheit ein, weil sie in vorwärts gerichteter Körperstellung rückwärtsgehen konnte. Ihr Bauchnabel zeigte nach vorn, ihre Nasenspitze aber nach hinten. Mit einem Male schämten sich alle die Eltern, die ein Inzuchtprodukt zur Welt gebracht hatten, nicht mehr.
Sie zeigten sich im Gegenteil sehr stolz, dass sie trotz ihrer Minderheit ein größeres Interesse erweckten als die in der Mehrzahl befindlichen Familien, deren Kind „Mama“ bzw. „Papa“ brabbeln konnte, als es erkannte, wer ihm die Windel wechselte.
Meine Darlegungen zu diesem brisanten Thema fußen auf Mitteilungen meiner Großeltern, die froh sind, dass deren Eltern außerdörflich ein Paar wurden. Mein Urgroßvater, der während des 2. Weltkrieges Soldat war und als solcher an der Ostfront Russen totschießen musste, wäre beinahe selbst eine Leiche geworden, weil er seinen Kopf zu weit über den Schützengraben gehoben hatte. Ein blutrünstiger Russe sah das und wollte ihm mit einem Fernschuss den Stahlhelm durchbohren. Als es knallte, zog meine Uropa sein Haupt zurück. Da die Kugel aber schneller war als sein schnell gefasster Entschluss, riss ihm das russische Projektil das linke Ohr ab. Urgroßvater merkte das erst gar nicht, erst als seine Kameraden ihn darauf aufmerksam machten, wurde ihm das bewusst.
Weil seine Hörfähigkeit als vorgeschobener Horchposten nun eingeschränkt war, nahm er das Nahen des Feindes zu spät wahr. Man überführte ihn deshalb in ein Lazarett in Berlin, in dem ihm ein von einem verstorbenen Soldaten entferntes Ohr angenäht wurde. Erst nach Kriegsende erfuhr er, dass es ein russisches Ohr war. Die verfügbaren deutschen Ohren passten ästhetisch nicht zu seinem vorhandenen. Seinen Lazarettaufenthalt versüßte ihm eine Krankenschwester, die sich hingebungsvoll um ihn mühte. Weil sie das auch des Nachts tat, und nicht nur neben, sondern auch in seinem Bett, wollte er nach seiner Heilung nicht mehr in den Krieg zurückkehren, sondern bei ihr bleiben. Welch ein Zufall, dass der Krieg im Augenblick ihres höchsten Glück zu Ende ging. Bevor Uropa in russische Gefangenschaft kam, versprach er der Krankenschwester, sie anschließend zu heiraten. Das geschah, nachdem er aus dieser entlassen war. Aus einem erfolgreichen Beischlaf erwuchs meine Oma, die in Trottelsdorf das Licht der Welt erblickte.
Werbeflut
Das Fassungsvermögen unseres Briefkastens ist beschränkt. Die Postzustellerin auch. Meine Eltern haben sie schon x-mal gebeten, keine Werbung mehr in den Briefkasten zu stecken.
Agneta, so heißt die Zustellerin, reagiert darauf, als habe sie Bohnen in den Ohren. Schon am nächsten Tag quillt der Briefkasten wieder über. Das einzige Familienmitglied, das sich über die Füllung freut, ist Oma. Die aktualisiert ihr Wissen über das unterschiedliche Warenangebot durch das Studium der Werbeprospekte. Sehr zum Missfallen ihres Sohnes, meines Vaters. Der hatte sie in einem vertraulichen Zwiegespräch zu überzeugen versucht, dass die Werbeflut den deutschen Verbraucher zum willfährigen Zugpferd des kapitalistischen Ausbeutungssystems macht.
„Du bist und bleibst eine rote Socke“, tadelte Oma meinen Papa. „Mir ist es egal, ob ich ein kapitalistisches Zugpferd bin. Wichtig ist, dass ich keinen Zug bekomme; ich erkälte mich so leicht.“
Meinen Vater erzürnte die Halsstarrigkeit seiner Mutter, doch zähmte er seinen Groll, weil er merkte, dass er ihre Einstellung nicht ändern kann.
Seine Anti-Werbe-Haltung hat einen triftigen Grund. Als junger Mann hatte er die Tochter des Großbauern Schrot umworben. Das geschah aber weniger aus Liebe zu Helga, so hieß das Bauernmädel, sondern vielmehr aus Zuneigung zum Vermögen ihres Vaters. Damals war mein Papa körperlich noch stracks, reinen Gewissens und nicht kommunistisch verseucht. Als er mich diesen Abschnitt seiner Jugendzeit wissen ließ, sprach er vom wachsenden Klassenstandpunkt eines Heranwachsenden. Die Formulierung Kommunistische Verseuchung verbat er sich.
Helga Schrot widersetzte sich dem Liebeswerben meines Papas nicht, denn ihr machte ein junger Mann den Hof, der neben dem Hof auch sie im Blick hatte. Ihr geschah zum ersten Mal, dass jemand Interesse an ihr bekundete. Helga war weder schön noch klug. Wäre sie meine Mutter geworden, hätte ich meinem Leben ein frühes Ende gesetzt.
Vielleicht ahnte er das und stieß Helga deshalb aus seiner Empfindung. Verursacher seines Gefühlswandels war der führende Genosse der Ortsgruppe der SED. Die SED war zu DDR-Zeiten eine Partei, die immer Recht hatte. Ähnlich wie die NSDAP zu Hitlers Zeiten. Wer das anzweifelte, verschwand für einige Zeit von der Bildfläche. Auch Großbauer Schrot verschwand - in den Westen Deutschlands. Die SED hatte ihn nämlich vor die Frage gestellt: Eintritt in die LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) oder Vegetieren als ein von den fortschrittlichen Kräften verachtetes Überbleibsel kleinbäuerlichen Denkens und Handelns. Schrot entzog sich dem aufblühenden Sozialismus in der DDR und verließ Trottelsdorf bei Nacht und Nebel. Tochter Helga nahm er mit.
Meinen Papa betrübte das nicht. Im Gegenteil. Er dankte dem führenden SED-Ortsgenossen, der es verstanden hatte, die Schrot-Family von Grund und Boden zu vertreiben. Weil dem Papas einfaches Dankeschön nicht reichte, fragte er ihn, ob er als SED-Genosse dem Sozialismus ebenfalls zum Sieg verhelfen wolle.
Nachdem er Papa darüber aufgeklärt hatte, worin sich Sozialismus und Faschismus unterscheiden, war Papa bereit. So war er einem Partei-Werber in die Fänge geraten. Er wurde auch gleich zum stellvertretenden Ortsgruppenführer ernannt, weil außer ihm und dem Vorsitzenden noch niemand in die Reihen der SED-Ortsgruppe gefunden hatte. Trotz Mund-zu-Mund-Propaganda fand sich niemand bereit, den Sozialismus in Trottelsdorf zu stärken. Selbst die Intelligentesten des Ortes, die Lehrer und der Pfarrer, wollten parteilos den Kapitalismus überrumpeln. Der Pfarrer meinte, dass das Reich Gottes auch ohne Sozialismus in Trottelsdorf Fuß fassen werde. Der Herrgott sei parteilos, deshalb sei für einen Gottesfürchtigen eine Parteizugehörigkeit nicht erforderlich.
Mein Papa, bei dem die Zugehörigkeit bereits Spuren hinterlassen hatte, verpflichtete sich, dem Arbeiter-und Bauern-Staat bis zum letzten Blutstropfen zu dienen. Die DDR war ein Arbeiter-und-Bauern-Staat, weil in ihm mehr Arbeiter und Bauern lebten als andere Menschen.
Mein Papa war protestantisch getauft worden. Deshalb, weil er unter Protest – heftigstes Strampeln mit Händen und Füßen – sich der Benetzung mit Taufwasser widersetzte. Die Abwehr dieses klerikalen Willküraktes sei erster Ausdruck seines erwachenden Klassenbewusstseins gewesen.
Er erzählte noch weitere Episoden aus seinem bisherigen Leben und bat mich, ihm nachzueifern.
Das werde ich nicht tun, denn eine Jungfrau besitzt andere Chromosomen wie ein alternder Mann.
Der Fremde
Gestern traf ich einen Fremden, der unser Dorf wegen seiner Reize aufsuche, behauptete er. Auch über meine Reize zeigte er sich nach einem Blick auf meine in Entwicklung befindliche Brust entzückt. Wir waren uns rein zufällig begegnet, und zwar auf dem Dorfplatz, auf dem wie jeden Mittwoch ein vietnamesischer Obst- und Gemüsehändler seine Ware feilbietet. Er sei Vegetarier, sagte der Fremde und kaufte ein Bund Radieschen und eine Banane. Er führte mich etwas abseits und fragte, ob die Banane bestimmte Regungen in mir entfache. Ich erwiderte, dass ich mit ihrer Schale jemanden zu Fall bringen könnte, bis er sich nicht mehr rege. Er lächelte dünn, schälte die Banane, biss von ihr ab und schob sie vor jedem weiteren Biss zwischen den Lippen vor und zurück. Als er sie aufgegessen hatte, fragte er, ob sein Essverhalten in mir etwas wachgerufen habe. Ich bejahte und sagte, meine Erinnerung an einen Affen sei wachgerufen worden, den ich im Zoo beim Bananenessen beobachtet hatte.
Diese Antwort schien ihm nicht zu gefallen, weshalb seine nächste Frage auf mein Alter zielte. Ich antwortete, dass mein Alter im Garten sei und Grabungsarbeiten tätige. Ein großes Beet müsse für die neue Aussaat hergerichtet werden.
Sein Lächeln wurde noch dünner. Er wollte wissen, wieviel Lebensjahre ich zähle und ob ich schon einen Freund habe. Ich nannte meine Lebensjahre und die Anzahl meiner bisherigen Freunde. Dann drehte ich die Frage um und fragte ihn nach seinen Lebensjahren. Ich erfuhr, dass er fünf Jahre älter sei als ich. Ich betrachtete ihn genauer und erkannte, dass sich seine Nasenspitze gerötet hatte. Er hatte also gelogen. Ich schätzte ihn so zwischen Dreißig und Vierzig. Gestützt wurde meine Vermutung durch sein Aussehen. Er hatte lange Haare, die er zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Das veranlasste mich zur Frage, ob er teils männlich und teils weiblich sei. Er lachte wiehernd wie ein Pferd und erklärte, dass er vollständig männlich sei. Ob er mir das beweisen solle. Er zog den Reißverschluss seines Hosenstalls nach unten. Das veranlasste mich zum Hinweis, dass er zum Pinkeln hinter die alte Eiche gehen solle, die auf dem benachbarten Dorfanger stehe.
Er zog den Reißverschluss hoch und erkundigte sich, wo ich zu Hause sei. Ich sei in diesem Dorf zu Hause. Diese Antwort genügte ihm nicht, weshalb er das Haus meines Zuhauses wissen wollte.
In mir keimte der Verdacht, dass er ein Einbrecher sein könnte, der für seinen nächsten Knack unser Heim auswählen wolle. So etwas Ähnliches war kürzlich der Witwe Tratsch passiert, die auf die Verlockungen eines Mannes mittleren Alters hereingefallen war. Bei Witwen haben Betrüger mehr Chancen als bei Nichtwitwen.
Ich testete den Pferdeschwänzigen deshalb auf Herz und Nieren. Ich erkundigte mich, weshalb er unser Dorf tatsächlich aufgesucht habe. Außer meinen Reizen sei es nämlich reizlos. Es biete nichts Interessantes. Sein Interesse gelte einem Schatz, der hier verborgen liege. Ob ich von ihm wüsste.
Ich bejahte und verwies auf den Friedhof. Wieso dort, wollte er wissen. Ich erklärte, dass dort der Schatz unseres Dorfschmieds begraben liege. Als dessen Ehefrau gestorben war, jammerte er, er trage nun seinen Schatz zu Grabe.
Der Fremde war mit meinen Ausführungen nicht ganz zufrieden. Er meine einen anderen Schatz, einen richtigen, so einen aus Gold. Von so einem Schatz wisse ich nichts, sagte ich. Doch widerrief ich meine Aussage sofort und sagte, der Geschichtslehrer unserer Schule habe mal von einem Goldschatz gesprochen. Sofort wurde der Pferdeschwänzige aufmerksamer. Den meine er, meinte er. Ich erklärte mich genauer und sagte, dass hier irgendwo im Erdreich der Goldzahn Napoleons liege. Der sei ihm abgebrochen, als er im Dorfgasthof Rast machte und ein Fleischstück verzehrte, dass ihm der Wirt gebraten hatte. Es war aber kein Fleischstück, sondern ein Stück der Lederhose seines Sohnes. Der Wirt hasste die Franzosen. Wo sich der Dorfgasthof befinde, wurde der Fremde noch neugieriger. Der befinde sich in der Dorfchronik, sagte ich, weil er vor hundert Jahren ein Raub der Flammen geworden war. Ob ich ihn zu dieser Stelle führen könnte, fragte er. Ich führte ihn und wenig später standen wir vor einem Denkmal.
Was das sei, fragte er verdutzt. Ich antwortete: „Das ist das Denkmal für die Opfer des Faschismus.“
Er erkannte, dass sich das Denkmal nicht verschieben lässt, um an den Goldzahn zu kommen.
Ich beruhigte ihn: „Hätte Napoleon geahnt, dass es mal den Faschismus geben wird, hätte er nicht in das falsche Fleischstück gebissen.“
Wahlrummel
Alle Jubeljahre findet in unserem Dorf ein Dorffest statt, das für Jubel, Trubel, Heiterkeit sorgt. Besser gesagt, sorgen soll, weil der Bürgermeister die Einwohner bei Laune halten will. Die sind nämlich nicht immer so heiter, wenn sie ihren täglichen Sorgen begegnen. Am meisten ärgert sie, dass in naher Zukunft unser Dorf mit vier anderen Dörfern vereinigt werden soll. Verwaltungsmäßig, damit sich die Menschenmasse von einem Schreibtisch aus regieren lässt. Jedes dieser vier Dörfer liegt von uns aus gesehen in einer anderen Himmelsrichtung, also im Norden, Süden, Osten und Westen. Ich sage das, damit der Leser weiß, welche Himmelsrichtungen uns umgeben. Auf die Nennung der Dörfer verzichte ich größtenteils, weil mir vor Schmach und Schande der Mund zuwachsen würde, denn nur der Name unseres Dorfes ist wichtig. So denken und empfinden auch meine Eltern, Großeltern und die übrigen Bewohner unseres Ortes. Die geplante Eingemeindung hassen wir wie die Pest, obwohl sich an sie – die Pest - niemand erinnern kann, weil sie vor 700 Jahren grassierte.
Nun soll ein Oberbürgermeister über uns herrschen. Diesen Posten begehrt unser Ortsbürgermeister, der den Spitznamen ‚Kuller‘ trägt, weil er einen Kullerbauch hat. Wäre er weiblich, wäre er mit Drillingen schwanger, behaupten gehässige Leute. Seine Frau hingegen ist dünn und lang wie eine Bohnenstange und trägt ihre Nase deshalb hoch. Kinder hat sie nicht. Wo hätten die in ihrer Figur auch Platz haben können.
Dorffeste sollen das Gemeinschaftsgefühl der Einwohner stärken. Das nächste, das die ‚Kuller‘ für nächsten Monat eingeplant hat, soll die Bürger stimulieren, ihn zum Oberbürgermeister zu wählen. Jawohl, zu wählen, denn ganz demokratisch soll entschieden werden, welcher der fünf Bürgermeister die Gunst der Wähler erlangt. Ganz einfach wird die Sache nicht, denn einer der zur Auswahl stehenden Bürgermeister ist eine Frau. Sie unterscheidet sich von ihren Kollegen in drei Punkten:
a) sie ist weiblich b) sie ist annähernd hübsch und c) sie ist energisch. Drei Ehescheidungen hat sie schon erfolgreich hinter sich gebracht.Wenn sie bei Gemeinderatssitzungen den Mund aufmacht, klappt der der Ratsmitglieder zu, weil die nichts zu sagen haben. Wer dennoch eine Lippe riskiert, muss eine ausführliche schriftliche Erklärung abgeben, weshalb er ihr ins Wort fallen wollte. In der Kreiszeitung wird er als Frauenfeind angeprangert, was zur Folge hat, dass er die längste Zeit Ratsmitglied gewesen ist.
Mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel steht die Bürgermeisterin in herzlichem Briefaustausch und wird von ihr ständig ermutigt, sich nichts gefallen zu lassen. Die Männer seien alle Hosenscheißer, so die Kanzlerin, und müssten zu spüren bekommen, dass die maskuline Macht vorüber ist. Hätte Eva Braun den braunen Adolf sechs Jahre früher geheiratet, wäre es nicht zum Krieg, sondern zu einem harmlosen Lippenstiftgeplänkel gekommen.
Es lässt sich also denken, dass Annerose Schmidt, die Bürgermeisterin der Gemeinde Krummbach, die nördlich von uns liegt, große Chancen hat, den Wahlkampf zu gewinnen. Weil die Ehefrau unseres kullrigen Bürgermeisters die Absicht hat, die First Lady des geplanten Gemeindeverbandes zu werden, stachelt sie die Mitglieder des Kirchengesangsvereins, dessen Solosängerin sie ist, an, Annerose Schmidt das Ja-Wort zu versagen. Einzig und allein ihr Mann sei fähig, die Bürde eines Oberbürgermeisters zu tragen.