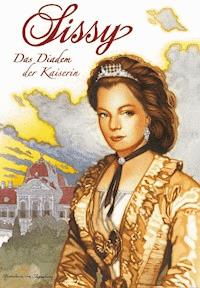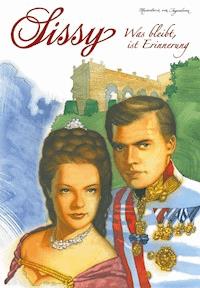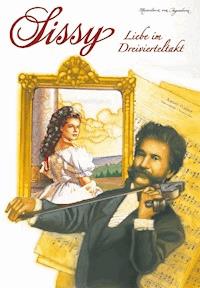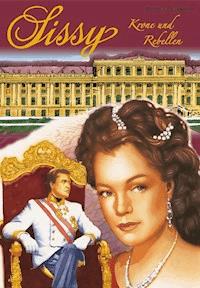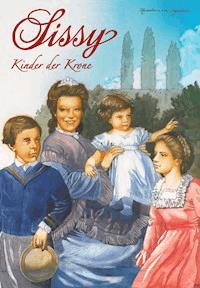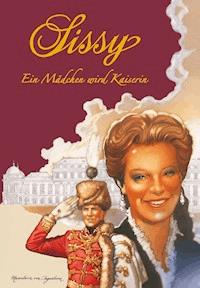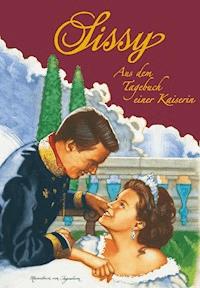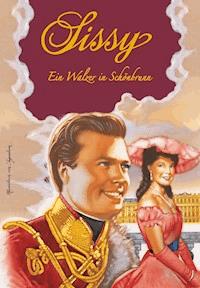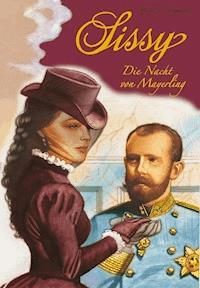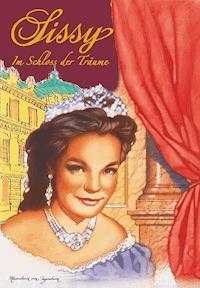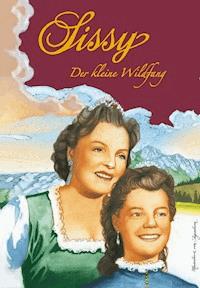
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Breitschopf Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sissy
- Sprache: Deutsch
Am Heiligen Abend des Jahres 1837 kommt im Palais der Wittelsbacher in München ein goldiges Mädchen zur Welt. Die glücklichen Eltern, Herzog Max von Bayern und seine Gemahlin Ludovica, ahnen nicht, dass Prinzessin Elisabeth in den Strudel der Ereignisse im Machtzentrum Europas geraten wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARIELUISE VON INGENHEIM
Sissy
Der kleine Wildfang
Autorin: Marieluise von Ingenheim
Illustration Überzug: M. Pleesz
Copyright der E-Book-Ausgabe von hiStory Publications:© Copyright 2016 by Verlagsbuchhandlung Julius Breitschopf GmbH,A-3420 Klosterneuburg bei WienAlle Rechte vorbehalten.Das Werk ist weltweit urheberrechtlich geschützt.All rights reserved throughout the world.
ISBN: 978-3-7004-4431-2EAN: 9783700444312
Inhalt
Prolog
01 - Sissy kommt zur Welt
02 - „Wieder a Madel"
03 - Die ersten Erdentage
04 - In der Schönheitsgalerie
05 - Possi
06 - Papa macht Geschenke
07 - Vier kleine Afrikaner
08 - Gackel und Schackel
09 - Irene
10 - Geisterstunde
11 - Strafe muss sein
12 - Das Jahr 1846
13 - Die spanische Tänzerin
14 - Freud und Leid
15 - Unruhige Zeiten
16 - Wiedersehen mit Irene
17 - Gespräch mit David
18 - Fieberträume
19 - Weihnachtsvorbereitungen
20 - Münchener Weihnachtsüberraschung
21 - Revolution
22 - Bedeutsame Tage
23 - Junge Liebe
24 - Wünsche und Hoffnungen
25 - Alles Theater
26 - Auf den Schwingen der Liebe
27 - Alles tanzt Walzer
28 - Wie die Welt sich dreht
29 - Neue Bekanntschaft
30 - Irrungen und Wirrungen
31 - Eine Verabschiedung
32 - Dem Tod entronnen
33 - Überraschung in Ischl
Prolog
Am Heiligen Abend des Jahres 1837 kommt im Palais der Wittelsbacher in München ein goldiges Mädchen zur Welt. Die glücklichen Eltern der kleinen Prinzessin, Herzog Max von Bayern und seine Gemahlin Ludovica, ahnen nicht, dass Prinzessin Elisabeth in den Strudel der Ereignisse im Machtzentrum Europas geraten wird.
Sissy kommt zur Welt
Es war das Jahr 1837, ein düsterer Himmel hing über der bayrischen Königsstadt. Es schneite nicht, war aber bitterkalt, das Jahr ging schon zur Neige. Durch die Straßen der Residenzstadt München eilten geschäftige Menschen, Männer und Frauen, in dicke Mäntel und Pelze gehüllt und mit vor Kälte geröteten Wangen. Viele von ihnen waren mit großen und kleinen Paketen behangen, und die Vorfreude auf den brennenden Lichterbaum, unter welchem der Inhalt der Päckchen das Entzücken der Beschenkten hervorrufen würde, leuchtete aus ihren Augen. Denn es war der Heilige Abend, und für die Kinder war das Christkind unterwegs...
Im Palais der Wittelsbacher in der Münchener Ludwigstraße aber wartete man auf eine Bescherung besonderer Art. Es herrschte ein nervöses Kommen und Gehen, und im ersten Stockwerk ging alles bis herab zur Dienerschaft nur auf Zehenspitzen durch die Gänge.
Eben hielt eine Droschke vor dem Portal, und eine dickliche, der Kälte wegen gänzlich vermummte Frauenspersonkletterte schnaufend ins Freie. Der livrierte Türsteher stürzte herbei und half der Frau, eine umfängliche Tasche in Empfang zu nehmen, welche ihr der von seinem Bock gekletterte Droschkenkutscher aus dem Inneren des Gefährtes herausreichte.
„Na endlich, Frau Sirninger”, begrüßte sie der Portier erleichtert. „Drin sind schon alle aus dem Häusl! Haben S' Ihnen denn net ein bissel beeilen können?”
„Beeilen? Heut, am Heiligen Abend? Ich hab' Kinder und einen Mann!” erwiderte die also Gerügte empört.
„Na, die Frau Herzogin kann sich den Tag schließlich net aussuchen, net wahr? Das muss man halt nehmen, wie's kommt und wie's der Himmel will”, versetzte der Portier. „Gehn S' nur schnell rauf, man wart' schon sehnsüchtig!”
„Auf mich warten immer alle sehnsüchtig”, wehrte Frau Sirninger schmunzelnd ab. „Aber zu spät kommen bin ich noch nie, meistens is' noch Zeit g'nug. Also regen S' Ihnen net auf, Herr Steinpichler, ist schließlich net das erste Mal, dass mich die Frau Herzogin rufen lasst.”
Resolut nahm sie die Ledertasche wieder an sich, und Steinpichler ließ sie ein. Er wagte keinen weiteren Widerspruch, und abgesehen davon, hatte Frau Aloisia Sirninger ja auch ganz Recht.
Die Einfahrt war erleuchtet, der Aufgang zur Linken wies auf den steinernen Treppenstufen viele feuchte Trittspuren auf. Die Sirninger hatte nichts anderes erwartet, dennoch seufzte sie mitleidig. Man war eben in einem herzoglichen Haus, in welchem die Tradition selbst zu Zeiten regierte, wo sie hätte besser der Vernunft Platz machen sollen.
Die beiden Linien der Wittelsbacher hatten nun seit beinahe siebenhundert Jahren in Bayern das Sagen. Dieses Palais hatte der König erbauen lassen; nun residierte darin Herzog Max in Bayern aus der Birkenfelder Linie. Und seine Gemahlin, die resolute Herzogin Ludowika, war ausgerechnet heute in die Wehen gekommen. Sie hätte sich nach Frau Sirningers Ansicht recht gut noch ein paar Tage Zeit lassen können, beispielsweise bis nach dem Stephanitag. Aber wie schon der Portier Steinpichler bemerkt hatte, die Frau Herzogin hatte sich's eben nicht aussuchen können, und so würde denn das kleine Erdenwürmerl, das da ans Licht wollte, ein richtiges kleines Christkindl werden.
Seufzend blieb die Hebamme auf dem Treppenansatz stehen, um kurz zu verschnaufen. Ihre Tasche, in welcher sie alle Utensilien, die sie benötigte, mit sich führte, wog nicht gerade leicht. Glücklicherweise überholte sie eben den Diener Ferdinand.
„Ferdinand, laufen S' doch net an mir vorbei, helfen S' mir ein bissel, ich bin ja reinweg ganz außer Atem!”
„Jösses, die Frau Sirninger!” erbarmte sich Ferdinand augenblicklich und riss ihr förmlich die Hebammentasche aus den Händen. „Kommen S' nur gleich, der Doktor ist schon da, der Frau Herzogin geht's miserablich, die ganze hoch-wohlgeborene Sippschaft macht s' ganz nervös.”
„Kein Wunder, Ferdinand”, sagte sie schnaufend und stapfte nun eilig neben ihm die restlichen Stufen der Feststiege empor, die mit Tannenreisern geschmückt war, welche einen festlichen Duft verströmten, „Ich bin heilfroh, dass ich net als Herzogin zur Welt 'kommen bin. Mich hat meine Mutter net in aller Öffentlichkeit gebären müss'n. - Wo ist 'n Seine Hoheit?”
„Beim G'sind' unten, er trinkt grad sein' Kaffee. Der lasst sich net aus der Ruh' bringen. Ich komm' grad von ihm - die Frau Herzogin hat mich g'schickt und ihn fragen lassen, ob er was braucht. Die lasst die Zügel net aus der Hand, net einmal an einem Tag wie heut.”
„Das schaut ihm ähnlich”, brummte die Hebamme. „Sitzt beim G'sind' und trinkt Kaffee, während die arme Frau...”
„Aber was sollt' er denn machen, Sirningerin? Er kann ihr ja doch net helfen, und's Kind statt ihr zur Weh bringen kann er auch net”, verteidigte Ferdinand seinen Herrn. „Der Doktor ist bei ihr, und jetzt kommen auch noch Sie! Und die ganze unnötige G'sellschaft sitzt vorm Paravent und wart', bis es soweit ist. Der Doktor schimpft wie ein Rohrspatz, wenn sich einer untersteht, sich ein Zigarrl anzuzünden!”
Jetzt erreichten sie die Vorhalle. Die Gebärende hatte man in den Roten Salon verlegt, der eine größere Anzahl von Personen fassen konnte. Das Prunkbett - das man eigens zum feierlichen Anlass aus dem Mobiliendepot hatte kommen lassen - stand hinter einem mächtigen Paravent, dessen einzelne Flügel anmutige Schäferszenen mit herzigen kleinen Putten zeigten. Der Paravent gewährte der in den Wehen hegenden Herzogin Ludowika ein kleines bisschen Intimität, denn jenseits dieses Schutzschirms waren an die zwanzig Personen versammelt, die sowohl der herzoglichen Verwandtschaft als auch dem Königlichen Hausministerium angehörten. Der zu erwartende Erdenbürger konnte Thronanspruch erben; es war diese Geburt also ein offizieller Akt ebenso sehr wie ein familiäres Ereignis. Ja, letzteres war es sogar erst in zweiter Linie.
Der Leibarzt des Königs, Doktor Reichhardt, saß an der Seite der Leidenden, welche ihr Weh mit Anstand ertrug. Solange es ging, Verbiss sie ihre Schmerzen, die freilich in Abständen immer heftiger wurden. Aber bisher war immer noch alles gutgegangen. Sie vertraute den geschickten Händen der Hebamme ebenso wie dem Doktor und vor allem auch der Hilfe der Heiligen Muttergottes, die sie mit zusammengepressten Lippen immer wieder in Gedanken anflehte, dass es doch möglichst bald vorüber sein möge.
Das Gemurmel der Wartenden drang an ihr Ohr wie ein fernes Brausen, aber sie blieb sich stets des Umstandes bewusst, dass hier sie die Hausfrau war und als solche Pflichten wahrzunehmen hatte.
Herzogin Ludowika war eine sehr resolute und standesbewusste Person. Ihr Gatte hingegen, der Herzog, war da ganz anders, er war ein vierschrötiger, gemütlicher Geselle, der nichts so sehr hasste wie Standesdünkel und Zeremoniell.
Wäre die Hebamme nicht die Treppe emporgestiegen, sondern hätte sie das rückwärtige Tor der Einfahrt benutzt, welches in den Hof des Palais führte, dann wäre sie vor einer winterlich verschneiten Zirkusarena gestanden. Eine solche samt den Holzbänken für Zuschauer ringsum hätte man normalerweise nicht in einer Residenz eines Herzogs in Bayern vermuten dürfen. Herzog Max hingegen hatte sich hier eine solche bauen lassen. Er ritt höchstpersönlich die Hohe Schule und produzierte andere „Kunststückln” angesichts eines besagte Bänke füllenden, in seiner Zusammensetzung höchst gemischten Publikums, dessen Applaus zu seinen höchsten Genüssen zählte. Es waren etliche seiner Kumpane aus dem Hofbräuhaus darunter, und sie waren keineswegs von Adel; und auch aus dem Künstlerviertel Schwabing kamen durchaus nicht hoffähige Leute zu des Herzogs Privatvorstellungen, der offen zugab, er wäre am liebsten nicht Herzog, sondern Zirkusdirektor geworden, wenn er die Wahl gehabt hätte.
Herzog Max in Bayern war ein, wie man zu sagen pflegte, „leutseliger Herr”, und genau das, was seine Gemahlin Ludowika mit schierem Entsetzen erfüllte, machte seine Popularität bei der Münchener Bevölkerung aus. „Müsst's mich halt nehmen, wie ich bin”, pflegte er allen jenen zu erklären, die an seiner Lebensweise Anstoß nahmen. Bis auf die Herzogin hatten sich schließlich alle daran gewöhnt, dass Herzog Max ebenso war und nicht anders, und selbst der König nahm keinen Anstoß mehr daran, dass Max mit genagelten Bergschuhen und in Lederhosen im Schloss aufkreuzte. Frau Ludowika hingegen gab in gewohnter Hartnäckigkeit noch nicht die Hoffnung auf, ihn zu bessern, so dass er, um ihren steten Nörgeleien zu entgehen, immer häufiger auf die Jagd und auf Reisen ging.
Inmitten der freien Natur fühlte er sich überhaupt am wohlsten, und den Kontakt mit der Landbevölkerung liebte er. So war er denn im wahrsten Wortsinn ein leutseliger Mann, und dass er die Gesindestuben den Gesellschaftsräumen in seinem Palais vorzog, war die logische Folge davon.
Ludowika liebte er auf seine Art. Sie tat ihm leid, er machte sich Sorgen um sie, sagte sich aber genau wie Ferdinand, dass er ihr jetzt nicht helfen könne und nur die Zahl der im und vor dem Roten Salon herumstehenden Leute vermehren würde. Er trank also seinen Kaffee und suchte sich einzureden, dies sei ein Tag wie jeder andere. Aber das war schwer genug, denn es war eben kein gewöhnlicher Tag, sondern noch dazu Heiliger Abend!
Im Familienzimmer stand ein geschmückter Weihnachtsbaum. Ludowika hatte noch selbst beim Schmücken der Tanne mit Hand angelegt, so gut sie es vermochte. Ein zweiter, kleiner und bescheidenerer Christbaum stand im Erdgeschoß, dort, wo das Gesinde zusammenzukommen und seine Mahlzeiten einzunehmen pflegte. Auf zwei Gabentischen lagen die Geschenke bereit.
Ludowika hatte auf nichts und niemanden vergessen. „Auch nicht beim Kinderkriegen”, dachte Herzog Max und ließ diesem Gedankengang einen kräftigen Schluck aus der Kaffeetasse folgen. Und daran schloss er die Hoffnung an, dass es diesmal wieder ein Bub werden möge. Denn Buben konnte es in einem herzoglichen Hause nicht genug geben.
Der Erstgeborene, Prinz Ludwig Wilhelm, war 1831 zur Welt gekommen. Luis, wie er gerufen wurde, war jetzt sechs Jahre alt und verständig genug, um zu wissen, dass heute nicht nur das Christkind, sondern auch der Storch erwartet wurde, doch, ehrlich gestanden, das Christkind mit seinen Geschenken interessierte ihn mehr.
Das zweite Kind, das ihm Ludowika schenkte, war wieder ein Bub gewesen, doch Wilhelm lebte nur wenige Monate, dann war er „ein unschuldiges Engerl 'worden”, wie Ludowika zu sagen pflegte, wenn sie in schmerzlicher Erinnerung seiner gedachte. Zwei Jahre nach Wilhelm, 1834, kam Karolin-Therese zur Welt. Sie hatte noch einen dritten Namen: Helene. Den liebte sie besonders, wohl deshalb, weil er am leichtesten auszusprechen war. Um ihn sich noch mundgerechter zu machen, hatte das kleine, herzige Plappermäulchen ihn zu „Nené” verkürzt. Und „Nené” sollte sie auch bis an ihr Lebensende heißen.
Nené war jetzt fast vier Jahre alt und ein aufgewecktes Kind. Anders als Bruder Luis war sie neugieriger auf das Geschenk des Storches. Was würde er ihr wohl bringen, ein Brüderlein oder ein Schwesterlein?
Nachdem Mama Ludowika sich bisher mit schöner Regelmäßigkeit alle zwei Jahre ins Wochenbett gelegt hatte, Heß sie sich nach Neues Geburt ein Jahr länger Zeit. Daran mochte wohl eine längere Reise von Papa Max schuld gewesen sein.
Doch nun stand der 24. Dezember 1837 auf dem Kalenderblatt, und es war wieder einmal so weit. Und dieser 24. Dezember fiel außerdem auch noch auf einen Sonntag! Ob das ein gutes Omen war?
„Es hat auf jeden Fall etwas zu bedeuten”, brummte Max und tat seinen letzten Schluck Kaffee. Es war halb sechs Uhr abends, ein wenig spät für die Jause und doch zu früh für die Bescherung, die er mit den Kindern würde alleine bestreiten müssen, wenn sich Ludowika Zeit ließ. Denn bevor nicht alles vorüber war, durften die Kinder natürlich nicht zu ihr.
„Weihnachtsabend ohne Mutter”, brummte Max fast vorwurfsvoll und schlug ähnliche Gedankengänge ein wie vorhin auf der Treppe Frau Sirninger Ludowika hätte sich noch ein paar Tage Zeit lassen können. Und damit fühlte er nun auch ein wenig Mitleid für das noch gar nicht geborene Wesen. „Dem fallen ja Geburtstag und Heiliger Abend auf einen Tag z'samm'“, räsonierte der werdende Vater. „Net zu beneiden, wegen die Geschenk' ...” Er, Max, ließ sich gerne beschenken.
Um sieben Uhr abends, der Herzog hatte sich inzwischen nach einem kurzen Besuch im Kreißzimmer in die Bibliothek verkrochen, in der sich, durch Foliantendeckel getarnt, ein Likörschrank mit besonderen Spezialitäten befand, ließ ihn die Herzogin durch den Diener Josef wissen, es sei noch immer nicht soweit mit ihr und dem Kind, doch da es die gewohnte Stunde der Bescherung sei, möge er die Kerzen auf den Christbäumen anzünden lassen, sich mit Luis und Nené zum Gabentisch begeben und dem Gesinde auch in ihrem Namen ein frohes Fest wünschen.
Der Herzog freute sich über die ihm von seiner Gattin zugedachte Meerschaumpfeife. Luis erhielt Trommel und Trompete und eine kleine Ziehharmonika (letztere von Papa), und Nené war überglücklich über ein richtiges Puppenhaus mit vielen Zimmern, die allesamt komplett eingerichtet waren. Dazu kamen noch ein Springreifen und ein Ball von Papa.
Die Päckchen, die das Christkind für Mama gebracht hatte, blieben vorerst noch unberührt.
„Wann kommt Mama sie denn anschauen?” fragte Nené mit großen Augen. „Und wann sieht sie denn den wunderschönen Weihnachtsbaum?”
„Ja, wann denn? Es wird ja schon spät!” mahnte auch Luis.
„Ich gehe einmal rasch noch zu Mama und erzähl' ihr, wie schön hier alles ist!” sagte Papa Max.
„Dann kannst du ihr aber auch gleich ihre Geschenke mitbringen!” riet Nené.
„Die will sie sicher selbst unterm Christbaum auspacken”, tröstete sie der Papa ein wenig verlegen. „Spielt nur inzwischen. Nachher essen wir, ich krieg' langsam Hunger.”
Da war es halb acht. Frau Sirninger hatte absolut Recht, sie war auch diesmal nicht zu spät gekommen.
Den Gästen vor dem Paravent wurden Erfrischungen gereicht.
„Wieder a Madel!”
Die Gesindebescherung war durch die Gäste im Haus und das „große Ereignis” empfindlich gestört. Zwar zeigte sich der Herzog jovial wie gewöhnlich, doch er war nicht bei der Sache. Der Besuch bei seiner Frau hatte ihn besorgt gemacht, obwohl ihm der Arzt versicherte, dass zu Befürchtungen kein Anlass bestehe.
Ludowika und er waren gleichaltrig, standen nun beide im neunundzwanzigsten Lebensjahr. Eine Frau von neunundzwanzig Jahren war schon nicht mehr die Jüngste, während sich ein Mann dieses Alters in seinen besten Jahren befand. Aber Ludowika war kerngesund, würde sich, wie Max hoffte, noch etliche Male ins Wochenbett legen.
Der Herzog brachte seine beiden Kinder zu Bett. Gemeinsam beteten sie und schlossen besonders die Mama in ihre guten Wünsche ein. Die Geschwister wollten nicht recht einschlafen. Die Bescherung und die damit verbundene Freude über die Geschenke war es nicht allein, was ihre Unruhe bewirkte. Es lag ein großes Geheimnis über diesem Haus und diesem Abend.
Es wurde zehn Uhr, halb elf. Die Luft im Gebärzimmer war zum Schneiden dick, der Raum überheizt, jedermann gereizt. Nach einer kurzen Ruhepause, welche auf eine Phase der Ermattung folgte, setzten die Wehen mit erneuter Heftigkeit ein, und Ludowika stöhnte und schrie schließlich zum Erbarmen. Es war keine leichte Geburt. Der Arzt sorgte sich um die Gebärende, aber die Hebamme behielt die Nerven und schickte Josef, den Herzog zu holen. „Sagen Sie ihm, er soll schnell kommen, jetzt ist es soweit!” Sie wischte der Herzogin den Schweiß von der Stirn, während der Diener hinauseilte.
Zielsicher strebte Josef der Bibliothek zu, wo er den Herzog bei seinem geheimen Likörschrank zu finden hoffte. Er hatte sich nicht getäuscht.
„Königliche Hoheit”, begann er gemessen.
Der Herzog schnitt ihm mit einer heftigen Handbewegung das Wort ab. „Sagen Sie schon”, rief er ärgerlich, „ist es endlich soweit?”
„Sehr wohl.” Josef nickte steif. „Die Frau Herzogin geruht niederzukommen.”
„Dann geruhe ich, zu ihr hinaufzukommen”, sagte der Herzog erleichtert und machte so große Schritte, dass ihm Josef kaum zu folgen vermochte. „Pfui Deibel”, rief er aus, kaum dass er das Zimmer betreten hatte, in dem sich die Herzogin in ihrem Bett wand. „Macht denn hier kein Mensch ein Fenster auf?!” Er wandte sich einem Fenster zu.
„Um Himmels willen, wollen Sie Ihre Hoheit umbringen?” Ein Sekretär trat ihm entgegen.
„Na ja”, mahnte der Herzog brummend, „manche Leut' erfrieren halt eher, bevor sie im G'stank ersticken!”
In diesem Moment stieß die Herzogin einen langgezogenen Schrei aus, und dann hielt der königliche Leibarzt das neugeborene Menschenbündelchen in seinen Armen und konstatierte lautstark für die Stenographen, während sich die Hebamme „um die hochwohle Nachgeburt kümmerte”:
„Geboren ist am Sonntag, dem 24. Dezember 1837, ein wohlgestaltet Menschenkind weiblichen Geschlechtes um zehn Uhr abends und dreiundvierzig Minuten hernach...”
Die Gesellschaft vor dem Paravent brach in Beifallskundgebungen aus und gratulierte dem Herzog. Der aber murmelte enttäuscht in seinen Backenbart hinein: „Wieder a Mädel!”
Was das eine Freude und ein Gratulieren ringsum - auch wenn es „nur a Madl” war. Die kleine Prinzessin, ein rosiges, etwas runzeliges kleines Bündelchen Mensch, war aber auch von Anbeginn an offenbar schon recht lebhaft. Der königliche Leibarzt hatte es nicht nötig, ihr mit dem obligaten sanften Klaps auf das rosige Hinterteil den ersten Schrei zu entlocken. Den tat sie auch so, und als der Herr Papa sein Prinzesslein im Arm hielt, tat sie es gleich noch einmal recht kräftig. Der Papa hob sie empor und zeigte sie allen, die sie bestaunen wollten, und sie ließ ihr gar nicht so zartes Stimmchen hören, als wolle sie damit sagen: Seht her, hier bin ich, ihr Lieben! Fröhliche Weihnachten, allesamt!
Max betrachtete das kleine Stimmwunder nun endlich selbst näher, und als sie wieder einmal den Mund auftat, entfuhr ihm eini höchst erstauntes „Sapperlot!” Und dann holte er sich auch gleich den mit der Mutter beschäftigten Doktor herbei und zeigte ihm sein Wunderkind. „Doktor, seh' ich recht oder täusch' ich mich? Gucken S' ihr doch einmal genau in den Mund, wenn sie wieder schreit!”
Der Doktor rückte seine Brille zurecht und tat, wie ihm geheißen. Und als sich das Mäulchen nach einem weiteren kräftigen Lebenszeichen wieder schloss, meinte er: „In der Tat, in der Tat, Eure Hoheit, es ist außergewöhnlich!”
„Nicht wahr, sie kriegt ja bereits einen Zahn! Man sieht's ganz deutlich, wie er durchs Kieferl durchkommt. Mein armes Kind, ja mein, es kommt ja reinweg grad mit Zahnschmerzen zur Welt!”
„Da kann ich aber wirklich nix dafür, Hoheit, und die Frau Gemahlin auch net”, versicherte der Leibarzt, als fühle er sich für den Umstand verantwortlich gemacht, dass das kleine Prinzess lein in Bezug aufs Zahnen gewissermaßen seiner Zeit voraus war.
Sicherlich war dieser Umstand eine Erklärung dafür, dass das Kind in der letzten Zeit im Mutterleib reichlich unruhig gewesen und die Geburt ein wenig umständlicher verlaufen war, als es der Mutter lieb gewesen sein mochte.
„Aber wenn sie schon einen Zahn kriegt, dann ist das ja ein Glücksomen”, versicherte die weißhaarige Gräfin Hohenstein, indem sie das Baby mit dem Lorgnon in Augenschein nahm. „Sie ist ein Sonntagskind und hat noch dazu einen Glückszahn - und das alles am Heiligen Abend! Sie wird einmal ein ganz besonderer Mensch werden, das lässt sich heute schon voraussagen”, versicherte sie dem Vater.
„So”, meinte der zweifelnd. „Und woher woll'n S' denn das nachher so genau wissen?”
„Aber, Herzog, das sind doch uralte chinesische Weisheiten”, sagte die Gräfin leicht pikiert.
„Ja mein, wir sind aber in München und net in Peking”, brummelte Max kopfschüttelnd. „Aber das mit'm Heiligen Abend, da erinnern S' mich wahrhaftig an was.”
„An was denn, wenn ich fragen darf?”
„Gewissermaßen an ein väterliches Versäumnis. Bei der ganzen Remasuri hat kein Mensch daran gedacht, verstehen S'? Dass wir nämlich für das Kleine hier noch gar kein Weihnachtsgeschenk haben!”
Die Gräfin schlug lachend die Hände zusammen. „Aber, liebster Herzog, ich glaube, das wird sie ganz bestimmt noch nicht vermissen!”
„Sie vielleicht nicht, aber ich”, erklärte Herzog Max ernsthaft. „Und eine Ordnung muss sein! Ich werd' mich gleich morgen früh darum kümmern!”
Schließlich gab er auch noch der erschöpften Mutter einen herzhaften Schmatz auf die Stirn. „Brav warst, Vicka”, lobte er. „Auch wenn's nur ein Madl ist, werden wir doch an ihr unsere Freud' haben!”
Seufzend lächelte Mama Ludowika: Nun ja, Taktgefühl hatte er nicht gerade, ihr Herr Gemahl, aber ansonsten war er doch, alles in allem genommen, ein recht braver Kerl.
Das Ärgste war ja nun überstanden. „Heilige Muttergottes, hab Dank und nimm das Kleine in deinen besonderen Schutz!” sandte sie ein Stoßgebet zum Himmel.
Eine halbe Stunde dauerte es immerhin noch, bis der letzte gegangen war und die Wöchnerin ein Hühnersüppchen zu sich nehmen konnte. Und während sie die warme Brühe wohltuend und magenwärmend durch ihre Kehle rinnen spürte, überlegte ihr waches Hirn schon allerhand.
„Wie werden wir sie den nennen, Max?” fragte sie ihren Mann, der jetzt an ihrem Bett saß. „Und die anderen beiden? Schlafen sie und waren sie mit den Geschenken zufrieden?”
„Die zwei schlafen fest”, versicherte Max. „Da brauchst dir keine Sorgen net zu machen, Vicka. Und zufrieden waren s' auch - bloß für die Neue haben wir noch nix.”
„Brauchen wir doch noch nicht”, meinte Ludowika kopfschüttelnd.
„Brauchen wir schon, wo s' doch nicht nur Weihnachten, sondern auch Geburtstag haben tut. Sie soll ihrem Vater net eines Tages vorwerfen können, dass er darauf vergessen hat.”
Die Namensgebung war freilich auch so eine Staatsangelegenheit. Für den Fall, dass es ein Bub geworden wäre, hätte sie bereits festgestanden. Doch dieser Wunsch war leider nicht in Erfüllung gegangen. Das kleine Wesen lag jetzt neben der Mutter unruhig in seiner Wiege und machte sich weder über seine Her- noch über die Zukunft irgendwelche Gedanken. Aber es war eben kein Kind wie alle anderen. Sie war eine Wittelsbacherin.
Der Herzog fühlte jetzt Bettschwere in den Gliedern. Ganz verschwommen tauchte in seinem Hirn die Vision seines Stammtisches im Hofbräuhaus auf. Den wollte er morgen zum Frühschoppen aufsuchen. Seine Kumpel waren ja auch schon neugierig und sie waren ihm fast noch wichtiger als die hochgeschraubte Gesellschaft von heute Abend.
„Gute Nacht, Vicka”, sagte er noch, „und bleib g'sund, wir brauchen dich alle.”
Das kam ihm ehrlich von der Seele. Auch hochgeborene Mütter starben am Kindbettfieber. Dieses Fieber war eine rätselhafte Krankheit, die junge Mütter grausam dahinraffte, gerade wenn ihre Neugeborenen sie dringend brauchten. Die Angst vor dem Fieber begleitete das Kinderkriegen bei arm und reich, und niemand schien davor gefeit zu sein. Man konnte nur hoffen, dass es einen verschonte.
Anderntags hörte der Herzog mit seinen Kindern die Feiertagsmesse in der Hauskapelle. Danach, als er sich vom guten Befinden seiner Ludowika überzeugt und ihr eine kostbare Halskette als Geschenk überbracht hatte, hielt es ihn wirklich nicht länger zu Hause. In seinen einfachen Lodenmantel gehüllt, stapfte er los in Richtung Hofbräuhaus.
Wie ein Magnet zog ihn die populäre Gaststätte an, wo in einem sogenannten „Extrazimmer” ein Tisch für den Herzog und seine Runde reserviert war und wo er bereits erwartet und mit lautem Hallo willkommen geheißen wurde.
„Ein Madl ist's 'worden, damit ihr's nur gleich wisst!” rief er zur Begrüßung. „Und einen Zahn hat's auch schon! Sie wird eine Weibsperson mit Biss.” Alle lachten, und der Herzog nahm gemütlich Platz.
Schon wurde ihm auch ein Maßkrug serviert, in dem das Bier überschäumte und der auf das Wohl der Neugeborenen geleert wurde.
Die Runde bestand aus einem Apotheker, einem Gymnasialprofessor, einem Kunstmaler, einem Fuhrwerksbesitzer, einem Holz- und Kohlenhändler, einem Tierarzt und einem Kaufmann - sie waren die „guten sieben” des leutseligen Herzogs, allesamt Angehörige des sogenannten guten Bürgerstandes. Bis auf den Professor waren sie auch durchaus wohlhabende Leute, aber dessen ungeachtet nahm Professor Gutenbrunner doch eine Sonderstellung ein, weil er eben ein „Gstudierter” war.
„Weiß es schon der König?” fragte denn auch Gutenbrunner als erster.
„Ich glaub', der hat's sogar schon vor mir und vor der Ludowika g'wusst”, sagte der Herzog grinsend. „Im Ernst, wenn er das Protokoll von gestern Abend schon g'lesen hat, dann weiß er alles. Womöglich auch, dass die Kleine schon ein Zahnderl kriegt. Jetzt kommt's nur noch darauf an, mit was er sich einstellt und ob er die Spendierhosen anzieht.”
„Das woll'n wir doch hoffen”, erklärte der Kaufmann. „Wir - die Runde, mein' ich - werden uns jedenfalls erlauben ...”
„Ich hab' ein Problem”, unterbrach ihn der Herzog, während Ober Max die zweite Runde Bier sowie das obligate G'selchte mit Kraut und Knödeln auftrug.
„Was hast denn für ein Problem?” fragte der Kaufmann.
„Es war doch gestern noch Heiliger Abend, wie sie auf d' Welt 'kommen ist”, erklärte der Herzog und langte kräftig zu. „Und ich hab' doch kein G'schenk für sie g'habt, und für einen ordentlichen Vätern g'hört sich das net. Ich weiß reinweg net, was ich da machen kunnt.”
Ein allgemeines „Ahhh!” entrang sich der verständnisvollen Runde.
„Net wahr?” mampfte der Herzog hervor und sah sich hilfesuchend im Kreise um.
Die ersten Erdentage
„Hm”, brummte schließlich der Fuhrwerksunternehmer. „MirTag...” Er stockte.
„Was denn?” fragte der Herzog, hellhörig geworden. „Red nur grad heraus!”
„Ein Hutschpferd”, sagte der Fuhrwerker zögernd. „Ein Hutschpferd hätt' ich von meinem Buben, wie er noch klein war. Jetzt braucht er's nimmer. Jetzt hutscht er sich aufm Stiefelknecht.” Die Runde lachte.
„Was gibt's da z' lachen?” Der Herzog schüttelte den Kopf. „Ein Hutschpferd... War' gar net schlecht, als Vorbereitung für das Pony, das sie g'wiß eines Tages von mir kriegt.”
„Aber jetzt kann sie doch noch kein Hutschpferd brauchen”, wandte der Professor zweifelnd ein.
„Warum nicht?” wandte der Herzog ein. ,Mit'm Reiten kann man gar net früh genug anfangen. Alois, ich nehm' es!”
„Aber es wird ganz staubig sein”, sagte der Fuhrwerker. „Und vielleicht hat's auch da und dort einen Knacks.”
„Dann bringen wir's zum Tierarzt! Wozu haben wir einen in unserem Kreis”, sagte der Herzog lachend.
„Da war' aber besser ein Tischler”, wandte der Tierarzt ein. „Der kennt sich besser aus mit'm Leim.”
„Ich nehm' das Pferd”, zeigte sich der Herzog entschlossen. „Ganz egal, was meine Vicka dazu sagt!”
„Auslachen wird s' dich”, prophezeite der Professor.
„Ist mir Wurscht”, erklärte der Herzog, „Hauptsach', die Kleine kriegt was!”
Die Gattin des Fuhrwerksunternehmers Alois Strampferman rief sie Gundl, obwohl sie doch auf den schönen Namen Kunigunde getauft worden war - fiel aus allen Wolken, als eine gute Stunde später die achtköpfige Herrenrunde einschließlich Seiner Hoheit, des Herzogs Max in Bayern, gleich einer Räuberbande in ihr Haus einfiel und kurz darauf auch noch den Dachboden auf den Kopf stellte.
„Ja, meine Herren, seids denn allesamt narrisch 'worden?!” rief sie, die Hände in die drallen Hüften gestemmt. „Ja mein, was soll denn dös nachher? Alois, bist denn reinweg übergeschnappt? Ja, Hoheit, was woll'n denn Sie auf unserm Dachboden droben, und noch dazu am Heiligen Christtagmorgen? Den ganzen Schneedreck von der Straßen tragt's ihr mir durchs ganze Haus und die Treppen hinauf, als ob ich reinweg net putzt hätt' für die Feiertag, krutzitürke-numeinand?”
„Weibi, halt die Pappen”, bat der gute Alois zärtlich. „Wir kommen nur ums Ross.”
„Um ein Ross? Um was denn für ein Ross? Das einzige Ross im Haus bist du, und dich braucht man g'wiß net suchen, schon gar net aufm Dachboden, höchstens im Wirtshaus, von wo ihr grad alle miteinander herkommen seid!”
„Weibi”, sagte Alois besänftigend, „es geht um das Hutschpferd von unserm Ferdinand. Bei den Dragonern braucht er's net. Und deswegen kriegt 's hölzerne Ross jetzt das neuche Töchterl von der Hoheit, das was gestern Nacht auf d'Welt'kommen ist.”
Frau Gundl verschlug es daraufhin zur Erleichterung ihres Gatten die Sprache.
„Ja mein”, brachte sie schließlich heraus, „lauter narrische Mannsleut' halt!” und verschwand kopfschüttelnd in ihrer Küche, wo schon ein festtägliches Mittagsmahl brutzelte.
Das Schaukelpferd war zwar staubbedeckt und spinnwebverhangen, aber sonst leidlich erhalten. Der Kunstmaler Alex Hinteracher erklärte sich bei seinem Anblick bereit, die Farben in künstlerischer Manier aufzufrischen. „Damit es wieder wie neu ausschaut.”
„Das möchst wirklich für meine Kleine tun, Alex?” fragte der Herzog gerührt.
„Aber freilich! Ich bring's gleich selber in mein Atelier. Die Farben müssen nachher freilich noch a bissel trocknen, gelt, aber morgen hat s' es, das Pferd. Ich komm' damit zu dir, Hoheit.”
„Da stellen wir uns auch mit ein”, erklärte Magister Felix Stangl, seines Zeichens Hofapotheker „Zur Himmlischen Dreifaltigkeit”.
„Ja, wann denn?” wollte sich Herr Professor Gutenbrunner vergewissern.
„Sagen wir, um halb elf?” fragte Hinteracher. „Hoheit, ist's dir so recht?”
Es war dem Herzog recht.
Daheim fand er Ludowika in einer den Umständen angemessenen halbwegs guten Verfassung. Sie fieberte ein wenig, aber nach Ansicht des Doktors sei dies ganz normal und habe nichts zu besagen. Und die noch namenlose kleine Prinzessin schlief in der gleichen Wiege, in der schon vorher ihre Geschwister geschlafen hatten, als sie noch so klein gewesen wären wie sie. Die Wiege stand neben dem Bett der Mutter, die hin und wieder einen zärtlichen Blick darauf warf.
„Wie wird sie wohl heißen?” Diese Frage bewegte sie noch immer.
„Darüber wird wohl dein Bruder Ludwig, mein königlicher Herr Vetter und Schwager, befinden”, meinte Herzog Max nachdenklich.
In der Tat war Ludowika eine Stiefschwester König Ludwigs I. Ihr hatte dieser quasi als Hochzeitsgabe dieses Palais errichten lassen, in dem sie in München die Wintermonate zubrachten. Die verwandtschaftlichen Verhältnisse waren reichlich kompliziert. Max und Ludowika waren nämlich auch noch Cousin und Cousine, und für einen Außenstehenden war es mitunter recht schwer, die einzelnen verwandtschaftlichen Konstellationen innerhalb der beiden Wittelsbacher Erblinien - die der Birkenfeld-Zweibrücken und jene der Birkenfeld-Gelnhausen - auseinanderzuhalten.
Beide Linien waren Nachkommen aus der Ehe des Pfalzgrafen Christian von Birkenfeld mit Magdalene von Zweibrücken. Dieser im Jahre 1630 geschlossene Ehebund bildete den Anfang. Der Pfalzgraf Christian allerdings war einer aus dem Wittelsbacher Geschlecht, das seine Vorfahren bis ins elfte Jahrhundert zurückverfolgen konnte.
Die Wittelsbacher waren Herzöge, Kurfürsten, Gelehrte und Künstlernaturen. Maximilian I. Joseph, Ludowikas Vater, war von Napoleon 1806 zum König gemacht worden; Napoleon brauchte einen Verbündeten und Vasallen. Doch der große Korse hatte nicht mit der Wittelsbachischen Bayernschläue gerechnet; während er selbst vom Wiener Kongress in Acht und Bann getan wurde, gelang es Maximilian I. Joseph, seine Königswürde zu behalten; auch Metternich konnte einen Verbündeten gut gebrauchen! Maximilian I. Joseph starb 1825, und nach ihm regierte nun sein Sohn, Ludowikas Stiefbruder, als König Ludwig I.
Ludowika war die siebente Tochter dieses ersten bayrischen Königs, der es nach und nach verstanden hatte, alle ihre Schwestern in „erste Häuser” zu verheiraten. Elisabeth war Königin von Preußen und Maria Königin von Sachsen geworden. Karoline wurde die Gattin Kaiser Franz' I. von Österreich, und Amalia heiratete nach Italien; ihr Gatte, Eugene de Beauharnais, war Napoleons Stiefsohn und von diesem eingesetzter Vizekönig. Nur Ludowika war es bestimmt, einen „Herzog in Bayern” - ihren eigenen Cousin - zum Ehemann zu bekommen, der seinerseits bei der Eheschließung versicherte, wie willkommen sie ihm sei.
„Denn”, so erklärte er, „ich kenn' ja die Vicka schon von klein auf, und so brauch' ich mich net erst an ein fremdes Frauenzimmer zu gewöhnen!”
Kurfürst Max Joseph, dem Napoleon im Jahre 1806 als Maximilian I. Joseph die Königswürde verlieh, nutzte die Gelegenheit, seinen Cousin Herzog Wilhelm von Birkenfeld-Gelnhausen, mit dem ihn eine enge Freundschaft verband, besser zu „etablieren”. Jedoch sollten seine Nachkommen fortan den Titel „Herzöge in Bayern” tragen, während der König seiner eigenen, älteren Linie den Titel „von Bayern” vorbehielt.
Insgesamt zeugte der erste Bayernkönig innerhalb zweier Ehen zwölf Kinder. Er war der Großvater mütterlicherseits des kleinen Kindes in der Wiege an der Seite Ludowikas, der nunmehr regierende Ludwig I. dessen Stiefonkel.
Am Stephanitag kamen dann tatsächlich des Herzogs Freunde aus dem Hofbräuhaus mit dem frisch lackierten Schaukelpferd, welches der Maler Alex Hinteracher stolz präsentierte. Die ganze Herrenschar stellte sich vor der Herzogin und der Wiege auf, in welchem das kleine Prinzesschen schlummerte.
Ludowika fühlte sich nicht sonderlich; es ging ihr schlechter als tags zuvor, aber diese „Glückwunschcour” brachte sie doch zum Lachen. Hatten die Herren doch auch ihr, jeder einzelne von ihnen nach seinem Vermögen, Blumen mitgebracht.
„Wie soll ich Ihnen danken, meine Herren?” sagte sie gerührt. „Sie sind Freunde meines Mannes und daher auch die meinen. Was das Geschenk anbetrifft, so wird sich meine Tochter sicherlich daran erfreuen - zu gegebener Zeit. Es beweist jedenfalls Ihren Weitblick, meine Herren.”
Der Professor biss sich auf die Lippen, und auch der Herr Magister empfand diese Dankesworte peinlich, die anderen Herren aber verabschiedeten sich frohgemut mit Handkuss, nicht ohne die beschenkte Kleine bewundert zu haben.
„Sie ist ja reinweg dem Papa wie aus dem Gesicht geschnitten”, fand der Holz- und Kohlenhändler beim Hinausgehen. „Die gerat' ihm ganz sicher nach!”
„Das will ich nicht hoffen”, bemerkte Ludowika halblaut.
„Na”, sagte daraufhin der Tierarzt, „die Natur lehrt uns die Wandlungsfähigkeit alles Äußerlichen. Eines Tages wird sie gewiss so schön sein wie ihre Frau Mutter Herzogin!”
Der Herzog fand es nunmehr für angemessen, seine Herrenrunde hinauszukomplimentieren und zu einem Schnäpschen in seine Zimmer einzuladen. Als sie allesamt gegangen waren, entrang sich Ludowika ein Seufzer der Erleichterung. „Was hast du dir bloß für einen Vater ausgesucht, arme Kleine”, seufzte sie.
Doch schon ein paar Jährchen später waren gerade diese beiden ein Herz und eine Seele.
Patin wurde Ludowikas Schwester, Preußens Königin Elisabeth. In der königlichen Schlosskapelle wurde das Kind unter großer Assistenz auf die Namen „ Elisabeth Amalie Eugenie” getauft. Doch es fiel niemandem ein, sie auch tatsächlich so zu rufen. Es blieb beim einfachen „Sissy”.
Als der Frühling kam, waren die Sorgen um Ludowika und das Kind durchgestanden. Die Mutter wie auch Sissy hatten sich gut erholt. Als der Schnee von den Dächern Münchens troff und allenthalben in den Straßen und Gassen die Baulust König Ludwigs lärmend vernehmbar wurde, fühlte sich Herzog Max tagtäglich weniger wohl. Es hielt ihn nicht in dem Häusergewimmel. Von seinen Vorfahren hatte er den Hang zum Wandern geerbt. Fing erst die Sonne an, so richtig zu scheinen, und sprossen das Gras und die Blumen wieder, erwachte sein unruhiges Wittelsbacher-Blut. Ludowika bemerkte es mit Sorge.
„Ich bin reif fürs Land”, versicherte ihr Max. „Mich hält es nicht länger hier in der Stadt.”
„Du willst doch nicht etwa schon wieder auf Reisen gehen?”
„Warum nicht? Griechenland, Ägypten, das wäre jetzt wohl das Richtige.”
„Griechenland und Ägypten! - Und was wird aus uns? Die Kleine ist jetzt drei Monate alt. Sie braucht die Mutter. Eine Amme ist kein Ersatz. Nein, Max, ich könnte dich diesmal wirklich nicht begleiten.”
„Musst du auch nicht, Vicka. Schließlich haben wir Possi. Auch die kleine Sissy gehört jetzt aufs Land. Die Luft in der Stadt tut ihr gewiss auch nicht gut. Man hört und liest von vielen kleinen Mädchen, die die Schwindsucht haben. Das kommt von dem Mief zwischen den Häusern. Und vom Staub! München erstickt im Staub. Mein königlicher Herr Cousin und Schwager lässt halb München niederreißen und wieder aufbauen. Das geht nicht ohne Dreck und Staub ab. Ich will nicht, dass unsere Sissy was abkriegt davon!”
„Ach, Mann, es geht dir ja nicht um Sissy und um die anderen Kinder! Ich kenne dich, in dir steckt ein Zigeuner. Das letzte Mal, als ich mit dir reisen musste, war ich schließlich fast am Ende meiner Kraft, du aber wolltest und wolltest immer noch weiter. Bis heute frage ich mich: Wohin?”
„Wohin?” Max sann ein wenig nach. „Ich glaube, das wirst du nie begreifen, Vicka. Eben immer dorthin, wo man gerade nicht ist! Die Flüsse entlang, über Hügel, Täler, Berge, durch Wälder und über Meere - immer so dahin.”
„Aber warum denn nur bloß, Mann, kannst du mir sagen, warum?! Ich begreife das nicht. Man kann es doch viel schöner und gemütlicher zu Hause haben!”
„Ach, Vicka, zu Hause, das ist nicht dasselbe”, sagte er versonnen. „Was das Zuhause ist, das hat man. Aber anderswo lockt vielleicht das große Glück, wartet das Geheimnis, warten auf dich alle Wunder dieser Welt, die der Herrgott geschaffen hat - auch für dich und mich, Vicka. Und auch für unsere kleine Sissy . . .”
Und es sollte sich in einigen Jahren erweisen, dass der Holz- und Kohlenhändler Alfons Löbl mit seiner Prophezeiung, das Kind gerate dem Vater nach, recht gehabt hatte.
In der Schönheitsgalerie
„Servus, Ludwig!”
„Servus, Max. Na, wie geht's meiner Schwester?”
„Dank' der Nachfrag'. Allweil ganz gut geht's ihr.”
„Und meiner kleinen Nichte?”
„Auch gut. Schreien tut's halt alleweil. Kriegt einen Zahn nach dem andern. Früh dran ist's damit! Hat ja schon bei der Geburt einen heraußen g'habt. Sonst ist's recht herzig und bakschierlich. Kannst sie dir ja anschaun kommen, wennst Lust hat. Oder die Vicka kommt halt mit'm Kinderwagen zu dir, damit dir die Sissy ihre Reverenz macht - dem Herrn Onkel König halt. G'hört sich ja wohl so, oder?”
Der Herzog Max in Bayern hielt seinem königlichen Schwager gemütlich die Rechte entgegen, und der drückte sie ganz formlos, wie eben unter Verwandten, die einander auch freundschaftlich zugetan sind. Sie trafen einander im königlichen Arbeitszimmer. Max hatte die Residenz aufgesucht und sich dort, ganz ungezwungen und ohne sich um irgendwelche vorherigen Anmeldungen und Formalitäten zu kümmern, einfach in das Zimmer begeben, in welchem König Ludwig I. hinter seinem Schreibtisch saß.
Doch, angeklopft hatte er schon vorher an die Flügeltür, aber nicht etwa zaghaft, das stünde ihm nicht an, sagte er sich. Es war ein lautes, selbstbewusstes Pochen, das sagen wollte: Jetzt komme ich!
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: